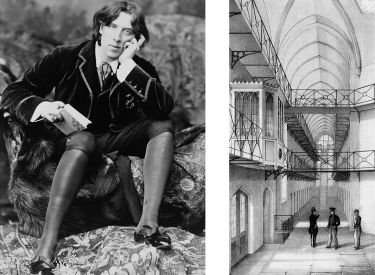Der Wickedest Man in Town
Es wurde viel geschimpft im US-amerikanischen Journalismus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Meinungsverschiedenheiten trugen die Autoren probaterweise ad hominem aus, was die Zeitungslektüre zu einem kurzweiligen Vergnügen werden ließ, allerdings auch immer wieder zu Komplikationen führte, wenn einer der Streithähne schließlich doch zu anderen als den verbalen Waffen griff und die Sache nach alter Pioniers-Art ins Reine brachte.
Ambrose Bierce, Mitte zwanzig und trotz seiner Jugend bereits ein mit Tapferkeitsmedaillen dekorierter Veteran des Bürgerkriegs, schickt sich an, in San Francisco, dem nordamerikanischen Presse-Mekka der Zeit, der Lauteste seiner Zunft zu werden.
Es ist kurz nach seiner Entlassung aus der Armee. Mit Erzählungen, vor allem aber satirischen und polemischen Feuilletons macht er auf sich aufmerksam und übernimmt bald im News Letter, einer der führenden Zeitungen der Stadt, die viel gelesene Kolumne »The Town Crier«. Der Titel ist Programm. Bierce schreit seinen während seiner puritanischen Kindheit und im Krieg erworbenen Welt- und Menschenhass mit solchem Sarkasmus hinaus, dass er selbst diesen hartgesottenen Gemütern Respekt, noch häufiger freilich einiges Ressentiment abnötigt - und geht alsbald nicht mehr ohne Trommelrevolver aus dem Haus.
Der Klerus ist von Anfang an seine liebste Zielscheibe. Er nimmt sich vor, »die ungeheure Diskrepanz zwischen dem religiösen Ideal, das den Geistlichen vorzuleben aufgetragen ist, und der tatsächlichen Lebensweise der Menschen vor Augen zu führen«. Das geschieht mit aller gebotenen Häme und oft genug geschmackloser Ranküne: »Rev. Mr. Fitch, Professor der Theologie in Yale«, vermeldet er da, »ist in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Der Gedanke, dass dem Gelehrten die Gelegenheit zuteil wurde, die Richtigkeit seiner theologischen Theorien im Hauptquartier einer eingehenden Prüfung zu unterziehen, erfüllt uns mit freudiger Genugtuung. Nachdem er uns über viele Jahre das Neue Leben gepredigt hat, scheint es nur gerecht, es ihm nicht länger vorzuenthalten. Für seine sämtlichen Kollegen erbitten wir das gleiche Privileg.«
Solche Texte bringt die in der Mehrzahl gläubige Leserschaft gegen ihn auf, die Redaktion ertrinkt in einer wahren Springflut von empörten Leserbriefen - und es vergeht kein Sonntag, wie Bierce in einer anderen Kolumne belustigt feststellt, da nicht einige der in die Mangel genommenen kirchlichen Würdenträger »von ihren Kanzeln blendende Leuchtfeuer aus dem Evangelium gegen unseren armseligen Viehstall richten, damit sich auch bestimmt kein frommes Lamm in dessen Nähe verirrt und von unseren Mäulern zerfleischt wird«.
Neben den Invektiven gegen die Honoratioren der Stadt, neben Klatsch und anderen Belanglosigkeiten, neben Kritik am anmaßenden Gebaren der lokalen Polizei, wüsten Artikeln gegen die erst zaghaft in Gang kommende Frauenemanzipationsbewegung und passionierten Apologien für den Selbstmord, lässt er immer mehr eine morbide Faszination für das Makabre, ein beinahe pathologisches Interesse für das Sterben in allen seinen absurden, grotesken und lächerlichen Facetten erkennen - eine Affinität, die später auch seine Schauergeschichten und seine Erzählungen vom Bürgerkrieg grundieren wird.
Er spielt die Rolle des mitleidlosen Bösewichts, der - mit viel Sinn für die theatralische Geste - einen blanken Totenschädel auf seinem Schreibtisch platziert und dem moralische Kategorien einerlei sind, weil es sich seiner Ansicht nach dabei nur um idealistische, mit der Wolfsnatur des Menschen unvereinbare Hilfskonstruktionen handele. Und er wird damit langsam zu einer Attraktion der Stadt: zum »Bitter Bierce«, »The Wickedest Man in San Francisco« oder auch »The Devil's Lexicographer« - diesen Ehrennamen bekam er für eine Reihe von teils grandiosen satirischen Worterläuterungen, die er erstmals im News Letter, dann aber auch in anderen Zeitschriften abdrucken und später gesammelt unter dem Titel »The Devil's Dictionary« innerhalb seiner »Collected Works« erscheinen ließ.
Dass Bierce ein Einzelgänger, Kauz und Misanthrop war und von daher ein gerüttelt Maß an Zynismus und Schwarzgalligkeit mitbrachte, ist das eine. Dass es sich aber vornehmlich um Rollenprosa handelt, hinter der sich eben doch eine tiefe Humanität versteckt, zeigen nicht zuletzt seine engagierten Parteinahmen für Minderheiten wie die Mormonen oder chinesische Einwanderer. Letztere waren in San Francisco besonders unbeliebt - und gewaltsame Übergriffe beinahe an der Tagesordnung. Bierce schlug sich mit Vehemenz auf ihre Seite und kommentierte die Pogrome auf seine Weise: »Letzten Sonntagnachmittag wurde ein Chinese, der arglos die Dupont Street entlangging, von den Stufen der First Congregational Church aus mit einem Schauer von Ziegeln und Steinen überfallen. Nach Vollendung dieser Andachtsübung zogen sich die Sonntagsschüler in die gebenedeiten Portale des Heiligtums zurück, um dort von Christus Jesus und Seiner Kreuzigung zu vernehmen.«
Aber obwohl er immer wieder Rassismus, politische Klüngelei und Regierungskorruption brandmarkte, sich die »Kritik sämtlicher gesellschaftlicher Einrichtungen« sowie »menschliches Leid und menschliches Unrecht« zu untersuchen vorgenommen hatte, obwohl er seinen Journalistenberuf also im besten Sinne aufklärerisch verstand, war er doch auch ein Konservativer und Reaktionär. Vermutlich wider Willen behielt Bierces puritanische Erziehung ihre geheime Wirkungsmacht: Er gab sich durch und durch prüde und predigte eine längst obsolete Sexualmoral, obwohl er die Institution der Ehe im Grunde ablehnte (wahrscheinlich auch, weil seine eigene unglücklich verlief und schließlich scheiterte).
Zudem lässt er auch schon mal anijüdische Sottisen vernehmen, die sich jedoch eher seiner generellen Glaubensfeindschaft subsumieren lassen. Und sogar gewisse Animositäten gegenüber den Schwarzen, für deren Befreiung er ja immerhin in den Krieg gezogen ist, sind nicht zu leugnen. So lehnt er eine Unterstützung der kubanischen Rebellen durch die Vereinigten Staaten in ihrem Befreiungskampf gegen Spanien auch deshalb ab, weil er sie zu den »Negern oder Negroiden« zählt, die »allesamt ungebildet, unfassbar abergläubisch und äußerst brutal« seien. Mit anderen Worten, es lohne nicht, sich für solches Pack die Hände schmutzig zu machen.
Auch seine einstmals republikanische Gesinnung weicht späterhin einer tiefen Verachtung für dieses seiner Ansicht nach unpraktikable »System zur Regierung eines Volkes»; und schließlich kommt er zu der Überzeugung, »dass dieser Staat es nicht wert ist, verteidigt zu werden, und dass die Sklaven nicht reif für ihre Beferiung waren«.
Kurzum, wir haben es hier mit einem durch und durch ambivalenten Charakter zu tun, mit dessen bisweilen obskuren Meinungen und Ansichten Bierces Biograf Roy Morris seine Mühe hat. Morris neigt in seinem detail- und faktenreichen, Bierces Lebensweg skrupulös und dennoch spannend nachzeichnenden Buch schon ein wenig zur Apologetik, wenn sein Protagonist sich wieder einmal allzu unkorrekt gebärdet, aber er zitiert dann auch genug Originaltext, sodass der Leser selbst entscheiden kann, ob er der harmonisierenden Deutung des Autors folgen will, oder eben nicht.
Als Militärhistoriker schätzt Morris Bierce vor allem als unbestechlichen Beobachter der Bürgerkriegsereignisse und für dessen von keiner schwärmerischen Apotheose verzeichneten Skizzen der bis dahin blutigsten Schlachten in der amerikanischen Geschichte. Seine erbarmungslosen, jede Allegorisierung vermeidenden Berichte »Was ich von Shiloh sah« und »Chickamauga« sowie die halluzinatorische Exekutions-Geschichte »Ein Vorfall an der Owl-Creek-Brücke« sind denn auch Musterbeispiele des Realismus und einer Anti-Kriegsliteratur, an denen sich John Dos Passos, Norman Mailer und Joseph Heller erst einmal abzuarbeiten hatten. Diesen Texten widmet Morris zu Recht besondere Aufmerksamkeit, aber zu mehr als einer recht oberflächlichen Interpretation reicht es dann leider doch nicht, da fehlt dem gelernten Schlachtenmaler offensichtlich das hermeneutische Besteck. Ganz bei sich ist er jedoch, wenn es gilt, den Verlauf des amerikanischen Bürgerkriegs und - eher am Rande, gleichsam anekdotisch - Bierces Geschicke darin zu skizzieren. Man fragt sich nur, ob dafür nun wirklich die ersten 150 Seiten nötig waren und ob es nicht auch mit etwas weniger pastosem Farbauftrag gegangen wäre.
Ganz sachlich und abgewogen diskutiert er indes die gängigen Hypothesen, die Bierces mysteriöses Verschwinden im mexikanischen Bürgerkrieg erklären sollen, um nach Sichtung aller Fakten noch eine weitere hinzuzufügen. Morris hält Bierces Vorhaben, sich als Korrespondent mit den Revolutionstruppen Pancho Villas zu verbinden, für eine gut vorbereitete Inszenierung des ausgebrannten, durch den Verlust seiner beiden Söhne und der meisten seiner Freunde lebensüberdrüssigen 72jährigen Melancholikers. Die Öffentlichkeit, so Morris, habe glauben sollen, dass er auf einem Schlachtfeld einen ehrenvollen Tod fand, stattdessen sei er in den Grand Canyon geritten und habe sich mit einem finsteren Lächeln die Knarre an die Schläfe gesetzt. Ob es so war? Die Indizien sprechen jedenfalls nicht dagegen. Und ein Bierce gemäßer Tod ist auch das allemal.
Roy Morris: Ambrose Bierce. Allein in schlechter Gesellschaft. Biografie. Aus dem Amerikanischen von Georg Deggerich. Haffmans Verlag, Zürich 1999. 488 S., DM 58