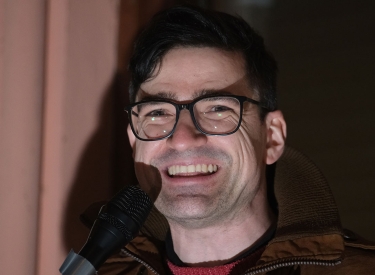Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus!
Geht in der außerparlamentarischen Linken etwas zu Ende, so veranstaltet sie meist einen großen Kongress. Keinen Abschlusskongress, sondern einen Kongress, auf dem Strategien für die Zukunft beschlossen werden. Die Antifabewegung der neunziger Jahre veranstaltete diesen Kongress im Jahr 2001 unter dem Titel: »Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen«. Kurze Zeit später beendeten nicht nur die vorbereitenden Gruppen des Kongresses, die Autonome Antifa (M) aus Göttingen, das Bündnis gegen Rechts (bgr) aus Leipzig und die Antifaschistische Aktion Berlin (AAB), ihre Zusammenarbeit, auch die Gruppen selbst brachen auseinander.
Der Beschluss des Kongresses war ein anderer gewesen: »Der Kongress soll ja nur der Auftakt und nicht das Ende der Diskussionen über eine Neubestimmung linksradikaler Politik sein.« Eine neue Organisationsform der radikalen Linken sollte gefunden werden, die neben den Verbindungen zur antirassistischen Bewegung der Antifa eine Rolle in der Antiglobalisierungsbewegung verschaffen sollte; nach Seattle 1999 und Prag 2000 standen die Proteste gegen die Gipfel in Göteborg und Genua unmittelbar bevor. Außerdem sollte aus den Fehlern der vor dem Kongress eigens aufgelösten Antifaschistischen Aktion/Bundesweite Organisation (AA/BO) gelernt werden, dass der inhaltlichen Auseinandersetzung mehr Raum zu gewähren sei.
Bald aber wurde kritisiert, dass die Ziele einer inhaltlichen Vertiefung und einer organisatorischen Verbreiterung einander ausschlössen. Die AA/BO und das gleichzeitig bestehende Bundesweite Antifatreffen (BAT) hatten gezeigt, dass die bloße Sammlung von Gruppen, die lediglich ihre jeweiligen Demonstrationen bewerben, schnell zu Stagnation führt.
Die Forderung nach einer Auseinandersetzung überstand der Minimalkonsens aber auch nicht. Erst zogen sich viele der einst organisierten Antifagruppen in ihre Provinzen zurück, dann verloren sie sich in der Bedeutungslosigkeit. Es begann die Ära der Postantifa. Die Antifabewegung brach auseinander, aber nichts Neues entstand. Eine Weile war dieser Zustand gut auszuhalten. Die rot-grüne Bundesregierung hatte im Sommer 2000 die Bekämpfung von Neonazis zur Chefsache erklärt und seitdem immer wieder Programme aufgelegt, die bezahlten, was früher die Antifa machte: das Recherchieren von rechtsextremen Strukturen, die Lobbyarbeit gegen Neonazis und für ihre Opfer und die Organisation von Protesten gegen Aufmärsche.
Auch die direkte Konfrontation mit den Neonazischlägern übernahmen nun öfter mal die Polizei und der Bundesgrenzschutz (BGS). Staatsanwaltschaften wurden erstmals wirklich aktiv, und nur wegen der Einwände der Gerichte wurden im Antifakampf des Staats die demokratischen Spielregeln nicht völlig außer Kraft gesetzt. Das Bundesverfassungsgericht verhinderte das Verbot der NPD, die von V-Leuten des Verfassungsschutzes durchsetzt war, und die Verbote von Neonaziaufmärschen wurden oft erst von Oberverwaltungsgerichten aufgehoben.
Zunächst gab es Zweifel an der Dauerhaftigkeit und dem Erfolg des staatlichen Engagements. »Aber unabhängig davon sollten wir diese Veränderung im gesellschaftlichen Umgang mit Neonazismus als Chance begreifen, unsere bisher doch stark auf den direkten Anti-Nazi-Kampf reduzierte Politik wieder für andere Inhalte zu öffnen«, meinte im Jahr 2001 die Autonome Antifa (M). Doch dann ging mit den Anschlägen vom 11. September die gemeinsame inhaltliche Grundlage endgültig verloren. Plötzlich gab es zwei nicht länger zu vereinbarende politische Richtungen in der Antifabewegung.
Die eine folgte der alten Strategie der Antifa (M), in großen Bündnissen die Möglichkeit linksradikalen Widerstands symbolisch zu erhalten. Vor dem Jahr 2001 wurde in Göttingen auf Demonstrationen ein »Schwarzer Block« durchgesetzt, was außerhalb des liberalen Milieus der niedersächsischen Kleinstadt faktisch nirgends mehr möglich war. Nach 2001 versuchten antikapitalistische Gruppen, sich der gesellschaftlich bereits vorhandenen Bewegung gegen Sozialabbau und Krieg anzuschließen; sie setzten die Politik des »revolutionären Antifaschismus« fort.
Die Aktionen gegen Neonazis waren für sie nur der Ausgangspunkt eines angestrebten Politisierungsprozesses. Das Ziel war die Kritik des Kapitalismus. »Wir gehen nämlich davon aus, dass es im gesamtgesellschaftlichen Rahmen eine relative Bedeutungslosigkeit der Neonazis gibt. Wir gehen vielmehr davon aus, dass wir in dieser Gesellschaft hier ein Demokratenproblem haben«, erklärte die AAB auf den so genannten Verstärkerkongress im Jahr 1999. Folgerichtig gab es zu dieser Zeit neben der Antifa-Arbeit auch andere Methoden, junge Menschen zu gewinnen: etwa Popantifa-Partys mit Riesentrucks zum »Revolutionären 1. Mai« in Berlin. Das machte die Antifa schicker und ansehnlicher, aber politischer wurde sie dadurch nicht.
Das Gegenmodell zum »revolutionären Antifaschismus« vertrat nach dem Jahr 2001 das Leipziger Bündnis gegen Rechts (bgr). Es erweiterte die These vom »rechten Konsens«, mit der seit dem Jahr 1996 versucht wurde zu erklären, warum einer erstarkenden Neonaziszene kaum Widerstand entgegengesetzt wurde. »Rechter Konsens« sei eine Übereinstimmung rassistischer Ansichten mit den autoritären Ordnungsvorstellungen, die sich in großen Teilen der Gesellschaft wiederfänden.
Kritisiert wurden zunächst die zivilgesellschaftlichen Aktionen gegen Rechtsextreme; sie wurden als Reklame für das »bessere Deutschland« verstanden, das mit diesem Engagement auch den Angriffskrieg gegen Jugoslawien rechtfertige. Später wurde die Bewegung gegen den Irak-Krieg als Ausdruck einer antiamerikanischen Suche nach der europäischen Identität gewertet. In den Protesten gegen Hartz IV sah das Bündnis gegen Rechts vor allem den Wunsch nach Integration ins nationale Kollektiv durch Arbeit und die Grundlage für die Wahlerfolge der NPD in Sachsen im Jahr 2004. Neue Bündnisse ergaben sich aus diesen Analysen selbstverständlich nicht.
Das Urteil der Geschichte über diese beiden Strömungen in der Antifa fällt ambivalent aus. Der »rechte Konsens« bleibt weiterhin ein Modell, mit dem erklärt werden kann, warum die millionenschweren Programme des Bundes die Neonaziszene nicht dauerhaft schwächten – im Gegenteil. Praktische Politik folgt aus den Analysen allerdings kaum mehr. Früher war das noch der Fall, wie etwa im Jahr 1996 in Wurzen oder 1997, als in Leipzig mit dem »dezentralen Konzept« erstmals auf eine eigene Demonstration verzichtet wurde, um einen Naziaufmarsch zu verhindern, statt sich in traditioneller Weise selbst darzustellen. Dagegen beweisen der »Schwarze Block« und die Proteste in Heiligendamm den Zuspruch für die konzeptionelle Mischung aus Bündnispolitik und linksradikalen Widerstandsformen der Antifaschistischen Linken Berlin (ALB), die in direkter Nachfolge der Antifa (M) steht.
Alles richtig zu machen, versucht neuerdings das von der Autonomen Antifa (F) aus Frankfurt initiierte Bündnis » … ums Ganze!«. Der bundesweite Zusammenschluss entscheidet sich im Zweifel für Kritik und Protest und hofft, damit auf der richtigen Seite zu stehen, statt zwischen allen Stühlen zu sitzen. Bisher hat das noch nicht geklappt. In Rostock war » … ums Ganze!« nicht nur die kleinere Kopie des »Schwarzen Blocks« der ALB, sondern ging auch inhaltlich unter.