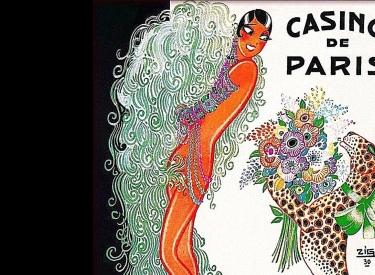Genosse Venezuela
Uh, ah, Chávez no se va! – Chávez geht nicht weg. Dies war der Schlachtruf der Chavistas bei Demonstrationen und Wahlen. Nun ist er doch gegangen. Und die große Frage ist: Was bleibt? Hugo Chávez war weder ein Vordenker einer befreiten Gesellschaft noch hat er den diktatorischen Staatssozialismus ins neue Jahrtausend hinübergerettet. Seine Person war ebenso wie die von ihm initiierte gesellschaftliche Transformation äußerst widersprüchlich.
Sein Verdienst besteht vor allem darin, dass er die Lebensbedingungen großer Teile der Bevölkerung deutlich verbesserte und bisher marginalisierten und diskriminierten Gruppen die Möglichkeit der Partizipation und damit ein neues politisches Selbstbewusstsein gab. Erfolgreich bekämpfte er Armut und soziale Ungleichheit: Der Anteil der Armen sank von 49 Prozent im Jahr 2002 auf 28 Prozent im Jahr 2010. Der UN-Wirtschaftskommission CEPAL zufolge steht Venezuela bei der Einkommensgleichheit an der Spitze der Staaten Lateinamerikas. Der staatliche Ölkonzern PDVSA finanzierte alleine im Jahr 2011 mit 25 Milliarden Dollar abseits regulärer staatlicher Sozialausgaben die berühmten misiones, Sozialprogramme, mit denen der freie Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und Grundnahrungsmitteln garantiert werden soll.
Auf der anderen Seite stand Chávez’ selbstverliebter Führungsstil und Personenkult, gepaart mit chauvinistischem Linksnationalismus und einem regressiven Antiimperialismus, demzufolge gute Arbeitervölker dem bösen Imperium gegenüberstehen. Nach dem Motto »die Feinde meines Feindes sind meine Freunde« unterstützte er Diktatoren und Menschenschlächter jeglicher Couleur, solange sie nur in Gegnerschaft zum beschworenen US-israelischen Imperium standen.
Dem gleichen Motto, nur unter entgegengesetzten Vorzeichen, folgen jedoch auch kritische Linke, die ihn einfach in eine Reihe mit jenen bekämpfenswerten Gestalten stellen. Aber Chávez’ Erfolg gründet sich nicht auf Repression und die Schuldzuschreibung nach außen, sondern auf der Inklusion breiter Schichten der Gesellschaft. Selbst die antichavistische Oberschicht hat trotz einzelner Verstaatlichungen und Umverteilungsmaßnahmen in der 14jährigen »sozialistischen« Herrschaft ihre privilegierte Stellung behalten. Ihren Einfluss hat sie in dieser Zeit darauf verwendet, gegen die angeblich drohende Vergesellschaftung ihres Besitzes aufzubegehren. In diesem Klassenkampf von oben – wie er auch in Bolivien und Honduras von den Oligarchien geführt wird – hielt sich die rechte Opposition noch weniger an demokratische Regeln als die als diktatorisch bezeichnete Linksregierung. Trotz aller autoritären Züge von Chávez muss betont werden, dass seine Macht bis zuletzt demokratisch legitimiert war.
Der überall sichtbare Gegensatz zwischen neoliberaler und sozialistischer »Freiheit« trug zu einer Polarisierung der Gesellschaft bei, die sich auf Demonstrationen ebenso wie bei der Jobsuche repressiv auswirkte, zugleich aber ein politisches Bewusstsein innerhalb der Bevölkerung schuf. Dass sich Venezuela in Wahlkampfzeiten stets in einem gesellschaftlichen Ausnahmezustand befand, lag insbesondere daran, dass im Gegensatz zu den meisten Demokratien die Masse der Bevölkerung dort tatsächlich vor einer Wahl stand, deren Ausgang ihre Lebensbedingungen ganz konkret betraf. Dieses politische Bewusstsein ging über die quasi religiöse Verehrung von Chávez hinaus. Die »bolivarische Revolution« war zwar von ihm angestoßen worden, aber zugleich war er auch nur ein Ausdruck davon und musste sich regelmäßig der Kritik dieser vorrangig sozialen Bewegung stellen. Im Mittelpunkt standen dabei vor allem die unverändert hohe Kriminalität, die Bürokratisierung sowie die weit verbreitete Korruption, von der die neue »Boli-Bourgeoisie« profitierte.
Die große Unterstützung seitens der Bevölkerung, mit der auch der Putsch der rechten Opposition im Jahr 2002 abgewendet wurde, galt zwar vorrangig der Person Chávez. Aber es ging stets auch um die Verteidigung des demokratischen Prozesses, der sich in den Stadtteilversammlungen und Basisinitiativen institutionalisiert hat.
Es zeigt den traurigen Zustand der globalen Linken, dass mangels Alternativen nun der selbsternannte Comandante als Revolutionär des 21. Jahrhunderts gefeiert wird. Von Trauerfeiern sollte man sich bereits aus Kritik am sozialistischen Personenkult fernhalten. Die notwendige Kritik an seinem regressiven Antiimperialismus darf aber nicht die progressiven Seiten des »Sozialismus des 21. Jahrhunderts« überdecken. Chávez und mit ihm den »bolivarischen Prozess« auf sein krudes Weltbild zu reduzieren oder gar als politischen Feind zu betrachten, zeugt von Arroganz gegenüber – stets widersprüchlichen – gesellschaftlichen Prozessen und den realen Lebensbedingungen der Menschen.