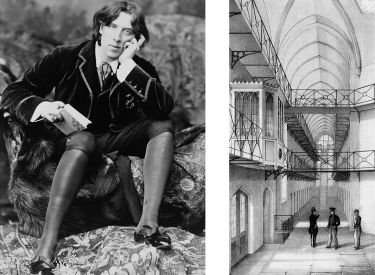»Seien Sie still, verdammt!«
Shakespeare wird mit Trigger-Warnungen versehen, ein Nietzsche-Lesekreis verboten, Vorträge über den »Islamischen Staat« sabotiert, proisraelische Veranstaltungen verhindert und Referenten niedergebrüllt – so geschehen an britischen Universitäten, wie der Telegraph kürzlich berichtete. Tom Slater, der Koordinator des Free Speech University Rankings, beklagte in derselben Zeitung, dass die freie Rede an den Universitäten im Vereinigten Königreich empfindlich eingeschränkt sei. Verantwortlich für die Einschränkung der Redefreiheit auf dem Campus ist ein Bündnis von linksmotivierten Studentengruppen, antirassistischen Initiativen und islamischen Gesellschaften, denen gemein ist, dass sie sich auf die Verletzung ihrer Gefühle, religiöser und anderer, berufen, um das Recht auf freie und öffentliche Meinungsäußerung einzuschränken. Doch warum ist dieser Prozess ausgerechnet an den Universitäten zu beobachten, die einstmals zur Befreiung aus der Vormundschaft von Adel und Kirche beigetragen hatte?
Die New York Times berichtete im November von Colleges in den USA, an denen Studentenproteste den Rücktritt von Uni-Präsidenten forderten und dies zum Teil auch durchsetzen konnten. Beachtenswert ist, dass Auslöser der Proteste nicht politische Maßnahmen des jeweiligen Hochschulrektors waren, sondern beispielsweise Verkleidungen von Studenten auf dem Campus oder das Motto einer Kostümparty, die als rassistisch empfunden wurden. Bemerkenswert ist dies, weil der Präsident für das je einzelne Verhalten oder Fehlverhalten von Studenten verantwortlich gemacht wird, als wäre er der pater familias und nicht Inhaber der höchsten Funktion der universitären Bürokratie. Die Universität wird von politisch korrekten Studenten nicht als Ensemble von Institutionen, sondern als familiärer Zusammenhang mit intimen Verhaltensregeln wahrgenommen. Beispielhaft ist eine Situation, die kürzlich in der Welt beschrieben wurde. Als ein Dozent »bei einer erregten Debatte auf dem Campus an das Recht auf intellektuellen Diskurs erinnerte, schrie ihn eine junge schwarze Studentin an: ›Seien Sie still, verdammt!‹ Und: ›Es geht nicht um die Schaffung eines intellektuellen Raumes! Darum geht’s nicht! Begreifen Sie das? Es geht darum, hier ein Zuhause zu schaffen!‹«
Das Programm, das an den Universitäten im Namen der politischen Korrektheit betrieben wird, könnte kaum besser auf den Punkt gebracht werden. Ein intellektueller Raum wäre ein öffentlicher Raum der Debatte, in dem zugunsten des Sachgehaltes des verhandelten Gegenstandes die jeweiligen individuellen Ansprüche zurückgenommen werden. Das kann allerdings nur gelingen, wenn die gemeinsame Absicht besteht, dies zu tun. Wird diese einseitig aufgekündigt, ist der liberale Gegenpart meist überrascht, wenn nicht gar hilflos. »Ich bin ein linker Professor, und meine linken Studenten machen mir Angst«, wird ein offensichtlich überforderter Hochschullehrer in der Welt zitiert. Ähnlich äußerte sich schon die Professorin der Harvard Law School Jeannie Suk, deren Studenten ihr die Lehre des Sexualstrafrechts sowie die Verwendung des Wortes to violate als retraumatisierend untersagen wollten. Die Universität, die so etwas wie Heimat werden soll, muss nach Vorstellung der konformistisch rebellierenden Korrekten Anforderungen erfüllen, die mit dem Anspruch einer öffentlichen Einrichtung notwendig kollidieren müssen.
Doch was sind die Ursachen dieses Ansinnens? Wie ist diese Bewegung zu erklären, die eine Verbindung aus biedermeierlichen Behaglichkeitswünschen und politisch-moralischem Radikalismus darstellt? Was man seit ein paar Jahren und gegenwärtig an den Universitäten in Europa und Nordamerika beobachten kann, ist eine Selbstzerstörung der akademischen Öffentlichkeit. Ohne Frage hängt diese mit den gesellschaftlichen Umbrüchen der vergangenen Jahrzehnte zusammen. Die Krise der Universitäten zeigt sich in unterschiedlichen Phänomenen. Während in den Naturwissenschaften die Abhängigkeit von der privaten Wirtschaft deutlich zunimmt, ist das in den Geisteswissenschaften mitnichten zu beobachten. Erstaunlicherweise wird die Ökonomisierung dort am meisten beklagt, wo sie kaum stattfindet. Stattdessen zeichnen sich die Geisteswissenschaften vor allem durch den Erhalt und Ausbau persönlicher Abhängigkeiten aus. Wer dort Karriere machen möchte, muss sich gut stellen, sich vernetzen, performen – all das ist wichtiger als die fachliche Leistung. Es ist also kein Wunder, dass das linksakademische Milieu beharrlich behauptet, dass sich gesellschaftliche Beziehungen wie Kommunikationsakte zwischen Menschen gestalten. Dieses Modell ist an der Lebenswelt der Universität gebildet, wo es auf die Herstellung eines good will zu Karrierezwecken ankommt.
Die Herausbildung des Bandenwesens betrifft nicht nur die Universität; die Tendenz dazu ist vielmehr die Konsequenz der kapitalistischen Produktionsweise, die aufgrund der Verwissenschaftlichung der Produktion immer weniger lebendige Arbeit benötigt, was die lebendige Arbeit naturgemäß mit Unwillen zur Kenntnis nimmt, wird sie doch so ihrer Daseinsgrundlage beraubt, die im Kapitalismus die Lohnarbeit ist. Erstaunlicherweise ist es dem akademischen Betrieb gelungen, dieses grundlegende Problem des gesellschaftlichen Zusammenhangs zu einem sozialpsychologischen Problem zu trivialisieren, welches sich größter Beliebtheit erfreut und unter dem Namen »Anerkennung« die Seminarräume und das Denken der Studenten vernebelt. Die Tatsache, dass junge Akademiker wie der überflüssige Schrott behandelt werden, der sie unter dem Aspekt ihrer Verwertbarkeit sind, soll nicht zu Bewusstsein kommen, sondern wird zum interpersonalen Anerkennungsproblem verharmlost und damit psychologisiert und emotionalisiert. Dass diese Rationalisierung einigermaßen fragil ist, deutet schon die permanente Schutzbedürftigkeit der eigenen anerkennungsbedürftigen Identität an, die mit einer umfassenden Infantilisierung einhergeht.
Der Zustand der Geistes- und Kulturwissenschaften, die der Hort dieser Weltanschauungen sind, tut ein Übriges dazu. Kaum wird in den Geisteswissenschaften noch ein Gegenstand verhandelt. Ihr Zweck hat sich in die Herstellung fragwürdiger Sozialkompetenzen durch ebenso fragwürdige Methoden wie Teamarbeit gewandelt. Die Geisteswissenschaften sind durch ihre Entsachlichung und Entwissenschaftlichung geworden, was in ihnen angelegt war und ihnen trotzdem widerstrebt: Reklame für ein gutes Miteinander, Herstellung positiver public and private relations, Unterstützung des kreativen flow. Das Geistige, wenn der Verweis auf die universale Utopie abgeschnitten und es zum bloßen Zeichen und Code degradiert wird, garantiert habituelle Verständigung der Gleichgesinnten. Die Utopie der Gewaltlosigkeit in der Lösung menschlicher Konflikte liegt eben nicht in der Unmittelbarkeit der Beziehungen zueinander, sondern in ihrer Versachlichung, wie Walter Benjamin es in seinem Text »Zur Kritik der Gewalt« ausdrückte.
Die politische Korrektheit hat einen Vorläufer auch in dem, was in den siebziger Jahren »Politik der ersten Person« genannt wurde und deren narzisstisches Wesen heute deutlich kenntlich ist. Statt eines dialektischen Begriffs von Klassenstandpunkt und objektiver Wahrheit hat sich eine Auffassung der unmittelbaren Wahrheit des je individuellen Standpunkts durchsetzen können. Was gegenwärtig zu beobachten ist, die Abwehr »böser Wörter«, die Verbannung »offensiver Gesten«, die Proklamation des Rechts auf well being, ist die Fortführung der Politik der ersten Person. Die Parole »Das Private ist politisch.« hat tatsächlich zur Privatisierung und Psychologisierung der Politik geführt. Als politisch wird inzwischen verstanden, dass das eigene Selbstverständnis auf der psychisch empfundenen Reinheit gegenüber der Außenwelt basiert. Es handelt sich um eine hygienische Auffassung der Welt, die als schädlich und schmutzig empfundene Einflüsse aus dem eigenen Wahrnehmungsbereich – nicht aus der Welt schlechthin – verbannen möchte. Die Verbindung von gesteigerter Empfindsamkeit und gefühlter politischer Einflusslosigkeit führt zum gegenwärtigen Erfolg der »schönen Seele«, über die bereits Hegel spottete, dass sie sich masochistisch an der eigenen Moralität und gleichzeitigen Unfähigkeit, sich zu entäußern, berausche.
Weil aber, wenn eine »schöne Seele« auf die andere trifft, jede schöner als die jeweils andere sein möchte, kommt es in dem Milieu zu einem Prozess, den man als einen Wettkampf des Radikalismus beschreiben kann. Sternchen schlägt Unterstrich oder umgekehrt, rassistisch schlägt transphob oder umgekehrt, es kommt zu Spaltungen, Ausschlüssen, Selbstkritik. Das erinnert an die Prozesse im Stalinismus oder die maoistischen Kampagnen während der Kulturrevolution. Inhaltlich gibt es keine Verwandtschaft, sie besteht allein in der autoritären Form der vermeintlichen Selbstreinigung von konterrevolutionären oder schlechten und rechten Elementen. Bei der Selbstreinigung bleibt es jedoch nicht, weshalb die eigene hood, die geisteswissenschaftlichen Fakultäten, mit dem je eigenen Tugendterror überzogen werden, worunter auch die eingangs erwähnte Beschränkung der Redefreiheit fällt. Die Zusammenarbeit mit religiösen und vor allem islamischen Gruppen ist keineswegs zufällig; sie und die schönen »Seelen« eint der Wunsch nach Immunisierung gegen Kritik und moralischer Beherrschung der Welt.
Die vorgetragene Emotionalität und der Verweis auf die verletzten Gefühle sind eine Strategie, um die Bildung von Karrierenetzwerken zu befördern, vor allem aber, um erfolgreiche Machtpolitik zu betreiben. Weil es auf Universalismus, Argumente und intellektuelle Fairness nicht ankommt, herrscht der Terror des Gefühls. »Indem jener sich auf das Gefühl, sein inwendiges Orakel, beruft, ist er gegen den, der nicht übereinstimmt, fertig; er muss erklären, dass er dem nichts weiter zu sagen habe, der nicht dasselbe in sich finde und fühle; – mit anderen Worten, er tritt die Wurzel der Humanität mit Füßen«, kritisierte Hegel den machtpolitischen Schutzpanzer des Gefühls. Die Wohligkeit, die die politische Korrektheit erzeugen möchte, muss also ebenso als Ausweitung der Kampfzone begriffen werden.
Auch die Vergangenheit bleibt von solcherlei Umtrieben nicht verschont. Ein Lehrbuch eines pädagogischen Zentrums in Cambridge hat, so berichtet die Welt an anderer Stelle, bewiesen, dass die Mauren vor den Angelsachsen auf der englischen Insel waren und die vermeintliche Legende vom weißen England dekonstruiert. Es handelte sich dabei um ein Kontingent nordafrikanischer Soldaten der römischen Armee, das kurzfristig am Hadrianswall stationiert war. In ideologischer Absicht wird ein historisches Kontinuum behauptet, wo keines ist. Die angestrebte Widerspruchsfreiheit des zu errichtenden »Zuhauses« soll sich bis in die Vorgeschichte verlängern, Geschichte wird willkürliches Material ethnischer Konstellationen in der Auseinandersetzung um sogenannte Deutungshoheiten.
Tatsächlich aber wird die Politik der »schönen Seele« erst in der Verbindung mit dem Antiuniversalismus einer neueren antirassistischen Ideologie zum politischen Verhängnis. Der Soziologe Detlev Claussen beschreibt in seinem Buch »Was ist Rassismus?« dieses Verhältnis wie folgt: »Eine ideologische Zutat der neueren antirassistischen Ideologie, wie sie in der westlichen Linken nach 1989 akzeptiert wird, besteht in der Identifikation von Rassismus, Kolonialismus, Universalismus und Aufklärung. Theoretisch wird der Rassismus universalisiert, während der Rassismus in der gesellschaftsgeschichtlichen Wirklichkeit die Funktion hatte, antiuniversale Praktiken zu rechtfertigen. Eine linke Generalabrechnung mit der Aufklärung als angeblicher Rechtfertigungsideologie imperialistischer Herrschaft begibt sich der einzigen intellektuellen Waffe, mit der sich das politische Denken vom Antiuniversalismus des Rassismus unterscheiden kann. Was Adorno zum Kampf gegen den Antisemitismus gesagt hat, gilt ebenso für den Rassismus: Den Rassismus bekämpfen kann nicht, wer sich zur Aufklärung zweideutig verhält. In der Tat erfüllt der ideologische Antirassismus die Funktion, die Welt als rassistisch zu interpretieren, statt Mittel zur Erkenntnis der Wirklichkeit anzubieten.« Und er fügt hinzu: »Die antirassistische Praxis scheint aber eher den eigenen Glauben an den Rassismus in der Welt zu bestätigen, als sie zu verändern.«
Dass politisches Denken sich vom Universalismus gelöst hat, betrifft auch die Formen der Öffentlichkeit: Ohne gemeinsame Perspektive braucht es auch kein gemeinsames öffentliches Gespräch.
Der Zusammenhang von persönlichen Abhängigkeiten an der Universität, dem akademischen Anerkennungsparadigma, dem ruinösen Zustand der Geisteswissenschaften, der Privatisierung von Politik und überhaupt der Öffentlichkeit und deren psychologischer Funktion kann vielleicht erklären helfen, warum die Hochschule zur Spielwiese fanatisierter Schildbürger geworden sind, die in den geisteswissenschaftlichen Instituten ihr mit Verhaltensregeln gepanzertes Zuhause einrichten wollen. Es scheint fast aussichtslos, auf den »Streit der Fakultäten« zu verweisen, den Kant geführt hat, um die Aufklärung gegen Religion und Aberglauben zu verteidigen. Kant würde nicht einmal mehr gelesen werden, weil er nach Erklärung der politisch Korrekten als weißer Mann mit ungeklärten sexuellen Vorlieben – im Verdachtsfall also heterosexuell – zum Bösen der Welt gehört, seine Gedanken und Werke inbegriffen. Doch statt sich im Umgang mit den sogenannten Unterprivilegierten narzisstisch selbst zu bespiegeln, den moralischen Radikalismus zu pflegen, sich der eigenen politischen Korrektheit zu erfreuen und die Verderbtheit der anderen zu geißeln und vor allem alle gesellschaftlichen Beziehungen als privative Kommunikationsmodelle aufzufassen, käme es darauf an, die gesellschaftlichen Beziehungen im Gesamten zu verändern. Die Grundlage dafür wäre, dass das Politische politisch wird. Das wäre möglicherweise auch die Bedingung einer Öffentlichkeit, die mehr ist als der diskursive Zerfall der Gesellschaft.