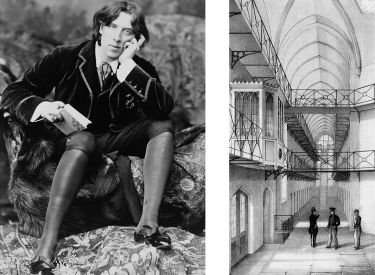Für’s Wohlgefühl
Sie verdanken den Talking Heads viel, den Beach Boys womöglich noch mehr und stehen dem Minimalismus eines Steve Reich nahe: Die Band Yeasayer zitiert die Musikgeschichte und formt daraus einen Stil, der mal als Postrock, Ethno-Pop, Math Rock, Gospel, World Music oder Neunziger-Jahre-Dance bezeichnet wird – oder als eine Mischung aus allem. Die Band ist mitten in der Hölle aus Verweisen, die bei Kritikern so beliebt sind, weil sie ihnen eine Gelegenheit bieten, all das angesammelte Wissen über Musikgeschichte, die Ablösung des einen popmusikalischen Stils durch den anderen, unter Beweis zu stellen.
Ein Vorgehen, das im Hinblick auf viele gegenwärtige Musiker fragwürdig erscheint. Bei Bands wie Yeasayer, die beinahe alles vereinen, was die Popkultur in den vergangenen 50 Jahren hervorgebracht hat, spielt die Herkunft eines zitierten Musikstils ebenso wenig eine Rolle wie die Frage, in welchem Jahr der Musikgeschichte sich die Künstler nun gerade bedient haben. Sicherlich haben Yeasayer akribisch wie Archivare in gut sortierten Plattensammlungen gegraben. Allerdings nur, um im nächsten Schritt die Ordnung über den Haufen zu werfen und alle Jahrzehnte in den eigenen Liedern kulminieren zu lassen. Mitunter in einem einzigen Song.
»Amen & Goodbye« ist das vierte Album der Band, die sich 2006 in Brooklyn, New York, gegründet hat. Als ihr Debütalbum »All Hour Cymbals« 2007 erschien, kam die Mischung aus World Music, Harmoniegesängen und experimenteller Verschrobenheit gut beim Publikum und der Kritik an. Zumal der Band früh attestiert wurde, irgendwie »spirituell« zu klingen. Was auch immer das heißen mag, es schien zu unterstreichen, dass es sich hier um eine angesagte Band handelte. Tatsächlich erklären die Bandmitglieder immer wieder, dass sakrale Musik ein wichtiger Einfluss sei, weil zahlreiche interessante Klänge in religiösen Zusammenhängen entstehen. Wer das abschreckend findet, sei beruhigt: Offen wird hier kein Glaube propagiert. Und das, was mancher spirituell nennt, könnte man auch bodenständiger mit der Hippie-Bewegung in Verbindung bringen.
Man könnte Yeasayer für die Alternative zum grimmigen Gospel einer Band wie Algiers halten, die vor Kurzem ein erstaunlich reifes Debütalbum vorgelegt hat. Yeasayer sind so etwas wie deren heitere Brüder im Geiste, denn auch bei ihnen spielt das Pathos eine Rolle, das Psychedelisch-Verschrobene kommt aus dem Krautrock, der Beach-Boys-Sound gibt all dem das Sonnenhelle.
Das witzige Interlude »Child Prodigy«, in dem sich ein Cembalo zu begeistertem Klatschen gesellt, zeigt, dass Yeasayer ihre Musik nicht über die Dauer eines Albums ernstnehmen. Der wohl größte Hit heißt »I Am Chemistry« und wird von einem rumpeligen Bass getrieben. Wenn gegen Ende, nach einem weggeschossenen LSD-Trip, ein Kinderchor einsetzt, ist es denkbar, dass Yeasayer ihre Hörer mit einem allzu deutlich ausgewalzten Klischee zum Narren halten wollen. Obwohl es eher Phrasen sind, die sich Yeasayer aus der Musikgeschichte aneignen, klingt die Band vor allem durch ihre Schrägheit erstaunlich eigenständig. Nach ihrem eher Dance-orientierten Album »Fragrant World« liefert »Amen & Goodbye« einen weiteren Beleg dafür, dass Simon Reynolds These, der Pop sei zu keiner Innovation mehr fähig, problematisch bleibt: Es ist ganz offensichtlich möglich, gleichzeitig von der Vergangenheit besessen zu sein und bislang Ungehörtes hervorzubringen. Die Komplexität ergibt sich, wie so oft, erst aus der Kombination der Möglichkeiten, deren Menge sich nicht zuletzt durch das Internet deutlich vergrößert hat. Dass so gut wie jede Musik allgemein zugänglich geworden ist, hat dazu geführt, dass die musikalischen Ländergrenzen verschwinden und Hybride aus verschiedensten Kulturkreisen und musikalischen Ideengeschichten entstehen.
Fatima Al Qadiri (Jungle World 24/2014 und 7/2016) hat das in den vergangenen Jahren sehr konsequent verfolgt. Gerade ihr Debütalbum »Asiatisch« begeisterte 2014 damit, einen völlig verschrobenen, westlichen Blick auf China auszustellen. Dafür verwendete sie Grime-Beats und -Sounds, also Versatzstücke einer aus Großbritannien stammenden finsteren HipHop-Variante, die sich wiederum selbst bei jamaikanischen Einflüssen bediente, und legte gesampelte chinesische Lyrik und Billigklänge darüber, die man sich in Deutschland, den USA oder England eben als irgendwie asiatisch vorstellt.
Problematisch an »Amen & Goodbye« ist, dass ein solcher Kunstgriff, eine kritische Distanzierung gegenüber dem Zitat, fehlt. Und es fehlt letztlich auch der Überraschungseffekt. Das liegt an der glatten Produktion, die sich stärker an Muse orientiert, als einem lieb sein kann. Und es liegt daran, dass Yeasayer kaum einen Spannungsbogen gezogen bekommen in diesen Songs, die selten verbergen können oder wollen, dass es sich um Skizzen handelt. Yeasayer wirken so wie die sympathischen Nerds und Plattensammler aus den Büchern Nick Hornbys. Die große Erzählung fehlt, es geht eher ums Wohlgefühl. Eine verbindende Idee, der eigentlich künstlerische Impuls, ist nicht zu vernehmen. Alles steht nebeneinander, verschiedene Musik und Ästhetik dienen als Input – sehr viel Inspiration von überall, keine sinnhafte Ordnung.
Yeasayer: Amen & Goodbye (Mute Artists Ltd./Goodtogo)