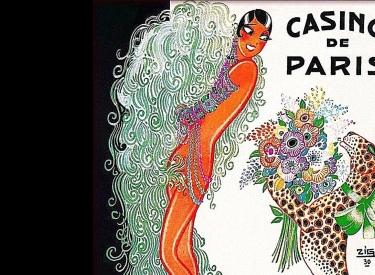Die Nachrufe kommen zu früh
Groß war die Hoffnung, als zu Beginn der nuller Jahre sich in Lateinamerika immer mehr linke Regierungen an die Macht kamen. Ausgelöst vom Wahlsieg von Hugo Chávez 1999 in Venezuela und der Ausrufung seines »Sozialismus des 21. Jahrhunderts« schwappte die »rosa Welle« über den Kontinent. Getragen von den erstarkenden sozialen Bewegungen kamen in den Folgejahren vielerorts Parteien an die Macht, die den neokolonialen Verhältnissen den Kampf ansagt hatten: in Ecuador, Bolivien, Brasilien, Argentinien, Uruguay und weiteren Ländern.
Vorausgegangen waren vielfältige Unruhen und soziale Proteste gegen die neoliberale Umstrukturierung, die erwartungsgemäß keine Verbesserung der Verhältnisse gebracht, sondern die soziale Ungleichheit noch verschärft hatte. Der Sozialismus des 21. Jahrhunderts, auf den sich neben den Chavistas auch die Regierungen in Ecuador und Bolivien beriefen, versuchte dem ein Ende zu setzen. Zunächst mit einigem Erfolg, so dass sich Mitte des vergangenen Jahrzehnts die meisten linken Regierungen konsolidierten. Zeitweise lebten drei Viertel der Bevölkerung Südamerikas unter solchen Regierungen.
Nun scheint sich das Blatt zu wenden. In Argentinien wurde vergangenes Jahr der »Kirchnerismo« abgewählt und mit Mauricio Macri übernahm ein Verfechter neoliberaler und rechtsautoritärer Politik die Regierungsgeschäfte. Die derzeit wegen eines Amtsenthebungsverfahrens suspendierte Präsidentin Brasiliens, Dilma Rousseff von der Arbeiterpartei, verlor angesichts der ruinösen Wirtschaftslage sowie von Korruptionsvorwürfen ihren Rückhalt, was die Rechte im Land für sich zu nutzen weiß. In Venezuela, dem sozialistischen Vorzeigeland, hatten sich die Konflikte schon seit Chávez’ Tod vor drei Jahren verschärft und kosteten seinen Nachfolger, Nicolas Maduro, im vergangenen Dezember die Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Mittlerweile steht das Land am Abgrund, es kommt zu wütenden Protesten wegen des anhaltenden existenzbedrohenden Mangels an Grundgütern. Kuba, die letzte Insel des real existierenden Sozialismus, verhandelt mit den USA, dem historischen Klassenfeind, und lässt die Boulevards der Hauptstadt Havanna für Fotoshootings von Chanel absperren.
Die Revolution ist pleite
In der lateinamerikanischen Öffentlichkeit ist überall die Rede vom Ende der linken Hegemonie. Die New York Times titelte gar neulich: »Der Tod der lateinamerikanischen Linken«. Aber ist sie tatsächlich am Ende? Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass das revolutionäre Pathos die tatsächliche gesellschaftliche Veränderung weit übertraf. Die vermeintlich sozialistische Politik, mit der die Regierungen ihren Erfolg begründeten, bestand in erster Linie aus sozialdemokratischen Umverteilungsprogrammen und der Wiedereinrichtung des Sozialstaates. Möglich war dies vor allem durch den wirtschaftlichen Boom des Kontinents ab 2002, der sich hauptsächlich aus der gesteigerten Nachfrage an Rohstoffen, besonders aus China, generierte. Die Ausbeutung natürlicher Ressourcen, meist unter völliger Missachtung ökologischer Nachhaltigkeit, finanzierte vielerorts die Sozialpolitik. Die Umverteilungspolitik in Venezuela und Ecuador basierte quasi vollständig auf den Erlösen aus dem Ölgeschäft. Durch den Fall des Ölpreises von über 130 Dollar auf gerade mal 30 Dollar ist dieser »Petro-Sozialismus« nun an seine Grenzen gelangt. Auch andernorts in Lateinamerika stagniert die Wirtschaft und die Sorge wächst, vom Weltmarkt abgehängt zu werden. Mit unter einem Prozent wird Südamerika in diesem Jahr das weltweit schwächste Wachstum des Bruttoinlandsprodukts aller Kontinente aufweisen.
Auf die schwierige Weltwirtschaftslage haben die meisten linken Regierungen keine Antwort parat, da sie weder Rücklagen angehäuft noch nachhaltige Wirtschaftsförderung betrieben haben. Der Revolution ist das Geld ausgegangen. Nun warten absurderweise sozialistische Regierungen darauf (beziehungsweise hoffen), dass Ölpreis und -nachfrage wieder ansteigen, neue privatwirtschaftliche Investitionen an Land gezogen werden können und sich der kapitalistische Weltmarkt erholt, damit sie mit ihrer »revolutionären« Politik fortfahren können. Denn nirgendwo wurden die Grundpfeiler der kapitalistischen Produktionsweise angetastet. Diese revolutionäre Halbherzigkeit, die zu einem sozialdemokratischen Sozialstaatsmodell geführt hat, rächt sich nun zwangsläufig.
Der derzeitige Attraktivitätsverlust des lateinamerikanischen Linkspopulismus ist aber nicht nur Folge kurzsichtiger Wirtschaftspolitik. Wie schon so oft in der Geschichte zu beobachten war, wenn soziale Bewegungen institutionalisiert werden, gewinnen vielerorts eine repressive Bürokratie und ein autoritärer Populismus die Oberhand. Kritik ist unerwünscht, soziale und wirtschaftliche Probleme werden als Folge imperialistischer Verschwörungen dargestellt und statt die Korruption zu bekämpfen, hat man sich ihrer ebenso bedient wie alle anderen. Dies geht einher mit einem ausgeprägten Etatismus, in dem die Regierungsparteien, obwohl selbst aus sozialen Bewegungen hervorgegangen, nun den Staat als das primäre Instrument gesellschaftlicher Transformation ansehen – und nicht bemerken, dass er das größte Hindernis dafür ist. Die großen Reden von der permanenten Revolution und die anfangs durchaus ernst gemeinten Versuche des Aufbaus basisdemokratischer Strukturen der Selbstverwaltung sind zur Farce verkommen. Jene Staatsfixiertheit lässt sich jedoch ebenso aus den Analysen herauslesen, in denen die sich häufenden Wahlniederlagen mit dem Untergang der Linken gleichgesetzt werden. In Demokratien halten sich die wenigsten Regierungen länger als drei Amtsperioden. Die lateinamerikanischen linken Regierungen sind zwischen 2000 und 2014 aus 19 von 20 Wahlen erfolgreich hervorgegangen, was eigentlich viel erstaunlicher ist als ihr derzeitiger Popularitätsverlust.
Ein neues Selbstbewusstsein
Der Nachruf erscheint daher verfrüht. Vielmehr habe die Linke bewiesen, dass sie in der Lage ist, zu regieren, betonte Steven Levitsky von der Universität Harvard neulich in einem Essay. Und in Anbetracht der Zahlen noch nicht mal schlecht, von der Katastrophe in Venezuela abgesehen. Darüber hinaus wurde in Lateinamerika die sozialstaatliche Umverteilungspolitik wieder auf die politische Tagesordnung gesetzt, von der sie seit der Demontage des Sozialstaates im Zuge der neoliberalen Umstrukturierungen in den achtziger und neunziger Jahren verschwunden war. Angesichts der noch immer weit verbreiteten quasifeudalen Verhältnisse hat dies durchaus etwas Revolutionäres, zumindest für die Millionen von Menschen, die zum ersten Mal Zugang zum Bildungs- und Gesundheitssystem bekommen und deren Lebensverhältnisse sich durch Umverteilungsprogramme spürbar verbessert haben. In diesen bisher marginalisierten und von der Partizipation ausgeschlossenen Schichten ist hierdurch auch ein neues politisches Selbstbewusstsein entstanden, das sich auch schon gegen die »eigenen« Regierungen wendet. Das im Februar gescheiterte Referendum in Bolivien über eine weitere Amtszeit für den indigenen Kokabauern Evo Morales kann so – statt als weiteres Beispiel für die Kontinent übergreifende Schwächung der Linken – auch als Zeichen einer starken und selbstbewussten Basis gesehen werden, die trotz einer Zustimmung von über 60 Prozent für den Präsidenten nicht alle seine Entscheidungen mitträgt.
Selbst wenn die Unzufriedenheit zusammen mit dem Fehlen einer Alternative nun dazu führen sollte, dass wieder das alte Establishment die Regierung übernimmt, wird sich dieses mit dem neuen politischen Subjekt arrangieren müssen. In Bolivien, Venezuela und Brasilien bedienen sich reiche Oberschicht und prokapitalistische Opposition der Sprache und den Aktionsformen ihrer politischen Gegner und versuchen mit einem Klassenkampf von oben, die Bevölkerung auf ihre Seite zu bringen – anstatt sie einfach wie früher zu ignorieren und mit Gewalt unten zu halten. Die politischen Verhältnisse in Lateinamerika haben sich verändert und die lateinamerikanische Linke könnte trotz – oder gerade wegen – des Verlustes der Regierungsmacht gestärkt daraus hervorgehen – falls es ihr gelingt, ihre reaktionäre Seite, die sich vielerorts an der Macht gezeigt hat, rechts liegen zu lassen, die eigenen Fehler zu reflektieren und jene Erfahrungen in neue progressive Projekte einfließen zu lassen.