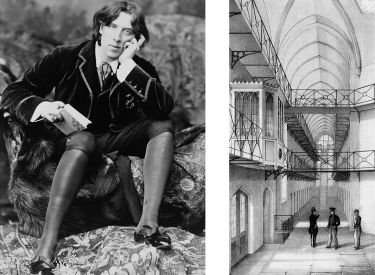Da ist noch Platz zwischen Promenade und Audimax
Münster ist eine Stadt voller Fahrräder, Bäckereien und Kirchen. Seit 1977 kommen alle zehn Jahre Skulpturen hinzu, von denen manche stehenbleiben, andere wieder abgebaut werden. Im Rahmen der »Skulptur Projekte Münster« werden dieses Jahr 35 neue Arbeiten internationaler Künstlerinnen und Künstler gezeigt, die öffentliche Sammlung umfasst mittlerweile 39 Werke, die über die Stadt verstreut und dauerhaft zu sehen sind.
Vorausgegangen war der ersten Ausstellung eine handfeste Auseinandersetzung. Der Plan der Stadt, die Plastik »Drei rotierende Quadrate« des Künstlers George Rickey anzukaufen, stieß 1974 in der Bevölkerung auf Ablehnung. Zu teuer, zu modern, am Ende gar keine richtige Kunst, urteilte man. Die Arbeit wurde dennoch aufgestellt und die Kontroverse führte zur Konzeption einer Schau moderner Kunst.
Statt Gesellschaft zu kritisieren, wird in Koki Tanakas dokumentarischen Aufnahmen eines Workshops zum Thema Zusammenleben Gemeinschaft gefeiert. Kunst mutiert zur avancierten Sozialarbeit.
1977 folgte dann die erste Ausstellung, die der Stadt eine Sehenswürdigkeit bescherte: die »Giant Pool Balls« von Claes Oldenburg, zentral am nördlichen Ufer des Aasees gelegen. Drei weiße Kugeln aus Beton mit einem Durchmesser von über drei Metern liegen dort im Gras. Oldenburg hatte ursprünglich geplant, diese Kugeln im ganzen Stadtgebiet verteilen zu lassen. Münster stellte er sich als einen überdimensionierten Billardtisch vor – weitere vom Queue in die Gegend gestoßene Riesenkugeln wurden aus Kostengründen jedoch nicht aufgestellt.
Auffällig ist das große Interesse an US-amerikanischer Konzeptkunst, von der die »Skulptur Projekte« seit jeher geprägt ist. Durch die Stadt streifend kann man beobachten, wie Künstler sich in den vergangenen 40 Jahren Themen genähert haben, wie Plastisches sich mit Räumlichem abwechselt und wie Stile und Strategien sich entwickeln. Von Beginn an lag der Fokus der Großausstellung darauf, Künstler aus aller Welt aushandeln zu lassen, was sich als Skulptur begreifen lässt beziehungsweise was zur Skulptur werden kann, und forderte so schon früh banale Vorstellungen von Kunst im öffentlichen Raum heraus. Bestes Beispiel dafür ist die Arbeit des bei den ersten vier Ausgaben vertretenen Konzeptkünstlers Michael Asher, der einen Wohnwagen über die gesamte Ausstellungsdauer wöchentlich an wechselnden Orten aufstellen ließ. Mal ging das Gefährt im Stadtbild unter, ein andermal erregte es Aufmerksamkeit und Unmut. 2012 starb Asher, von seiner Arbeit zeugt nur noch eine Fotodokumentation.
Nicht zum ersten Mal gibt es dieses Jahr auch Video- und Performance-Arbeiten, was zunächst erstaunt bei einer Ausstellung, die Skulptur schon im Namen trägt. Ein entgrenzter Begriff von Skulptur, der den Aspekt der Zeit sowie Fragen der Installation mit einbezieht, scheint hier auf. Meist funktionieren diese Projekte aber nur durch den Ort, an dem sie entstehen und ausgestellt werden. Besonders gelungen ist dies bei der Videoinstallation von Benjamin de Burca und Bárbara Wagner, die ihren Film »Bye Bye Deutschland! Eine Lebensmelodie« in einer in der Altstadt gelegenen Diskothek zeigen. Für ihren Film haben die Künstler aus dem brasilianischen Recife Musikvideos in Münster gedreht, in denen Amateurschlagersänger Hits unter anderem von Helene Fischer oder Udo Jürgens interpretieren. Weder ist der Film despektierlich gegenüber seinen Protagonisten, noch affirmiert er deren Tätigkeit. Vielmehr untersucht er die mediale Vermittlung des Schlagers, zeigt subtil dessen Verflechtung mit deutschen Trivialmythen auf und öffnet die Disko »Elephant Lounge« für ein anderes Publikum, ohne sie in einen klassischen Ausstellungsraum zu verwandeln.
Die Arbeit von Nicole Eisenman beweist, wie klug eine künstlerische Strategie mit der Ausrichtung der Ausstellung verzahnt sein kann. In einem Parkstück unweit der Innenstadt installierte die in New York lebende Künstlerin einen Brunnen, um den herum fünf überlebensgroße Figuren aus Bronze und Gips gruppiert sind. Die Geschlechtsteile sowie alle Körperoberflächen, deren Behaarung etwas über das Geschlecht der Figuren verraten könnten, sind durch Eingriffe ins Material veruneindeutlicht. Die kompositorischen und werkstoffsensiblen Fähigkeiten, die Eisenman aus ihrer vorrangig malerischen Tätigkeit in die Installation einbringt, sind deutlich zu erkennen. Im Katalogtext zu »Sketch for a Fountain« ist von einem queeren Arkadien die Rede und diesen Wunsch nach dem irdischen Paradies merkt man dem Ensemble an vielen Details an. Eine Figur hält eine Bierdose in der Hand, in der eine Wasserpumpe installiert ist, um das Behältnis unentwegt zum Überlaufen zu bringen. Ein Bier, das sich niemals leert – ein hübsches Versprechen. Ruhig steht das Ensemble da, die Geschlechtlichkeit der Figuren zerfließt in ihrer Faulheit, dem verschwenderischen Umgang mit sich selbst.
Dass nach Ende der Ausstellung im Oktober einige Arbeiten für die Dauerausstellung angekauft werden, ist nur in wenigen Skulpturen reflektiert. Eine Ausnahme bildet »Beliebte Stellen/Privileged Points« der Künstlerin Nairy Baghramian. Für die Installation ihrer massiven phallischen Skulpturen hat sie sich den Vor- und Hinterhof des Barockpalais Erbdrostenhof ausgesucht, wo in der Vergangenheit Arbeiten von Richard Serra und Andreas Siekmann zu sehen waren, die sich mit Vorstellungen von Öffentlichkeit beziehungsweise deren Privatisierung beschäftigten. Baghramian spielt mit dem temporären Charakter von öffentlicher Kunst und häuft die länglichen Bronzeskulpturen aufeinander oder befestigt sie auf Trägern, die erkennen lassen, dass die einzelnen Teile eigentlich ein Ganzes ergeben. Falls ihre Arbeit gekauft wird, will sie die passenden Stücke zu mehreren Skulpturen zusammenschweißen.
Schief geht die »Skulptur Projekte« dort, wo der politische Bezug überdeutlich wird, wie bei den Arbeiten der Rumänin Alexandra Pirici und der in Kyoto ansässigen Koki Tanaka. Pirici lässt im Friedenssaal des historischen Rathauses, in dem 1648 der Westfälische Frieden geschlossen wurde, eine Performance aufführen, in der alles mögliche in einen Topf geworfen und durchgerührt wird. Die Darstellerinnen und Darsteller wandeln herum und rufen in regelmäßigen Abständen Ereignisse aus, die sie in Beziehung zu dem Ort stellen, in dem sie performen. Ob vor 100 Jahren ein Gedicht geschrieben worden ist oder einige Tausend Kilometer entfernt von Münster im selben Moment ein Krieg stattfindet – in der mit monotoner Stimme vorgetragenen Aneinanderreihung von Fakten werden die thematisierten Ereignisse profan, austauschbar, letztlich beliebig. Ein Eingedenken der Komplexität und Brutalität menschlichen Zusammenlebens ist hier nicht möglich, denn schon im nächsten Moment wird eine neue Information aufgesagt, vor der es andächtig zu staunen gilt.
Die Videos von Tanaka zeigen dokumentarische Aufnahmen eines Workshops zum Thema Zusammenleben, den der Künstler mit acht Münsteranern unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft durchführte. Statt Gesellschaft zu kritisieren, wird hier Gemeinschaft gefeiert. Statt eines freiwilligen Zusammenkommens gibt es hier Zwang, wie etwa Tagesaufgaben für die Teilnehmenden. Kunst mutiert zur avancierten Sozialarbeit und kann auch in der Präsentation nicht überzeugen: Willkürlich werden die Videos in einem Souterrain in der Innenstadt gezeigt, Requisiten aus dem Workshop, wie ein großer Tisch sowie Geschirr, mit dem gekocht wurde, stehen als Relikte im Raum herum.
Tatsächlich beschleicht einen oft das Gefühl, dass den audiovisuellen Arbeiten unnötigerweise skulpturale Elemente hinzugefügt wurden, die entweder viel interessanter sind als die eigentliche Videoarbeit (wie zum Beispiel bei Mika Rottenberg, deren leerstehender Asia-Lebensmittelladen als Ort viel mehr hermacht als das darin gezeigte Video), oder die Skulpturelemente haben nichts mit dem gezeigten Video zu tun (wie bei Hito Steyerl, deren in Beton gegossene Schriftleuchtkästen scheinbar von vornherein nur als Sitzgelegenheit gedacht waren und mit den von ihnen aus zu betrachtenden Fernsehbildern von Robotern nichts zu tun haben).
Posthumanistisch geht es am Stadtrand in einer ehemaligen Eissporthalle zu. Pierre Huyghe hat durch Grabungen und andere Umgestaltungen einen Ort geschaffen, der wie die Kulisse eines Science-Fiction-Films aussieht. In der Halle lebende Bienen, Organismen, Fische und in einem Inkubator liegende Krebszellen sind elektronisch miteinander verschaltet und beeinflussen sich gegenseitig. Der Unterschied zwischen Natur und Kultur ist hier eingeebnet, Technik wird naturalisiert und Natur wird kulturalisiert. Huyghes Arbeit ist eine Illustration der gegenwärtigen Diskussion über die »Agency der Dinge«, in denen der Mensch nur zu einem »Akteur« unter vielen degradiert und der Status des Subjekts unterminiert wird. So egal ist der Mensch aber anscheinend doch nicht: Die außerdem zur Arbeit gehörenden herumirrenden Pfaue mussten nach einer Woche aus der Installation gebracht werden – zu gestresst waren sie von den Besuchern.
Die »Skulptur Projekte Münster« ist noch bis zum 1. Oktober zu sehen.