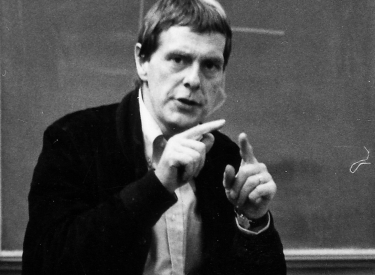Spiel nicht mit den Staatsschulkindern
160 Euro ist die Grenze. Mehr darf der Besuch einer Privatschule in Deutschland monatlich nicht kosten. Das haben Verwaltungsgerichte mehrfach festgestellt, denn obwohl das Recht, seine Kinder auf eine Privatschule zu schicken, als Konsequenz aus der Nazizeit in Deutschland Verfassungsrang hat, gilt auch das Sonderungsverbot: Die Reichen dürfen sich keine Schulen schaffen, auf die die Kinder der weniger Vermögenden nicht gehen können, weil es zu teuer ist. Eine Regel, an die sich niemand hält und die kaum jemanden kümmert. Zwischen 170 und 300 Euro kostet ein Platz an einer Privatschule, die ohnehin zum größten Teil vom Staat finanziert wird. Privatschulen sind, was das Geld betrifft, nichts anderes als hochsubventionierte Projekte privater Träger.
Zumeist handelt es sich dabei um Kirchen, Unternehmen oder Verbände und Initiativen. Die Preise werden kaum kontrolliert. Eine Ausnahme gibt es nur in Rheinland-Pfalz. Dort müssen auch die Privatschulen kostenlos sein, Schulgebühren sind verboten.
Die Zahl der Privatschulen in Deutschland wächst, aber trotz aller Diskussionen über die Probleme an staatlichen Schulen gibt es keinen Boom der Privatschulen. Eine im Auftrag der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) erstellte Studie der Bildungsforscher Klaus Klemm, Lars Hoffmann, Kai Maaz und Petra Stanat kommt zu dem Ergebnis, dass sich der Anteil der Schulkinder, die Privatschulen besuchen, in den vergangenen 25 Jahren von 4,8 Prozent auf neun Prozent fast verdoppelt hat. Was zunächst spektakulär klingt, ist es in Wirklichkeit nicht. Auf dem Gebiet der alten Bundesrepublik ist der Anteil der Kinder, die Privatschulen besuchen, in dem Zeitraum lediglich von 6,1 Prozent auf 8,8 Prozent angestiegen. Für das Wachstum waren vor allem die neuen Bundesländer verantwortlich, in denen der Privatschüleranteil, der 1992 noch unter einem Prozent lag, bis 2016 auf knapp zehn Prozent angestiegen ist.
Mehr als verdoppelt hat sich in diesem Zeitraum die Zahl der Waldorfschulen. Gab es in der alten Bundesrepublik nur 114 Waldorfschulen, liegt ihre Zahl nach Angaben des »Bundes freier Waldorfschulen« inzwischen bei über 240. Die Schulen orientieren sich an der sogenannten Anthroposophie, den antisemitischen und esoterischen Lehren von Rudolf Steiner, einem der erfolgreichsten Scharlatane der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert (Jungle World 33/2015). Besonders stark vertreten sind sie in Berlin (14 Waldorfschulen), im Ruhrgebiet (ebenfalls 14) und im Großraum Stuttgart mit 25 Waldorfschulen.
In Stuttgart wurde 1919 die erste Waldorfschule der Welt als Schule für die Kinder der Arbeiter der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik gegründet. Noch immer besteht in der Stadt ein entsprechendes Lehrerseminar. Im Ruhrgebiet gibt es nicht nur ein Waldorflehrerseminar in Witten, sondern mit der Universität Witten-Herdecke auch eine den Anthroposophen nahestehende Hochschule. Das benachbarte Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke (die erste anthroposophisch ausgerichtete Klinik in Deutschland) und die Zentrale der von vier Anthroposophen gegründeten GLS-Bank machen Herdecke, Witten und Bochum quasi zum Bermudadreieck der Steiner-Jünger.
Außer esoterischem Unsinn lernte die Berliner Autorin Judith Sevinç Basad nicht viel in der Waldorfschule: »Es war eher wie in einem Kindergarten.«
Oft bauen Elterninitiativen als Reaktion auf die Schließung kleiner öffentlicher Schulen auf dem Land private Grundschulen auf, um ihren Kindern weite Wege zu ersparen. Doch abgesehen von dieser Ausnahme, so beschreibt es die FES-Studie deutlich, liegt die Hauptmotivation für Eltern, ihre Kinder auf Privatschulen anzumelden, in der sozialen Zusammensetzung der Schulen. »Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungshintergrund besuchen deutlich seltener private Schulen; jene aus Elternhäusern, die über einen höheren Bildungsstand verfügen und finanziell bessergestellt sind, hingegen erheblich häufiger«, so die Studie. Klientel privater Schulen seien oft Eltern »aus gehobenen Milieus und der bürgerlichen Mitte«, weil sie »für ihre Kinder Milieunähe und Vorteile durch Distinktion suchen«.
Die würden sie freilich auch an einem Gymnasium bekommen. Soziale Segregation ist ein fester Bestandteil des deutschen Schulsystems: 75 Prozent der Schüler an Gymnasien gehören der FES-Studie zufolge bessergestellten Schichten an. Die Verhältnisse auf privaten Gymnasien sehen nicht sonderlich anders aus.
Und doch ist die feinere Gesellschaft an Privatschulen auch für Claudia* und ihren Mann Bernd* ein wichtiger Grund, ihren Sohn Thorben* auf einer Waldorfschule anzumelden: »Thorben ist ein ruhiges, ängstliches und sensibles Kind. Auf einer staatlichen Schule geht es für ihn zu rau zu.« Die beiden seien entgeistert gewesen, als der Kleine mit der Frage aus dem Kindergarten gekommen wäre, was ein Callboy ist. Auch Gewalttätigkeiten seien für sie ein Problem: »Im Kindergarten haben sich die Kinder gegenseitig gewürgt. Hauen ist ja noch ok, aber würgen?«
In Baden-Württemberg wurden in den vergangenen Jahren im Rahmen der Inklusion zahlreiche Förderschulen geschlossen. Behinderte Kinder, viele von ihnen lernschwach und aggressiv, kämen nun in die regulären Grundschulen, so Claudia. Gegen die Idee der Inklusion habe sie nichts, sie glaube aber, dass die Lehrer an den öffentlichen Grundschulen von dem Konzept überfordert seien und mit den Problemen alleingelassen würden. Thorben bei einer der vielen Waldorfschulen anzumelden, die es in und um Stuttgart gibt, ist für sie mit der Hoffnung verbunden, ihrem Kind möglichst lange eine heile Welt bieten zu können. Und die, da sind sich Thorbens Eltern sicher, werde er eher an einer Schule finden, in der die Kinder aus behüteten, bürgerlichen Familien stammen.
Das könnte sich allerdings als Trugschluss erweisen. Die Berliner Autorin und Studentin Judith Sevinç Basad besuchte als Kind für zweieinhalb Jahre eine Waldorfschule in Franken. Dann habe sie ihre Eltern gedrängt, sie bei einer regulären Schule anzumelden. »Im Unterricht haben wir gelernt, dass der Mensch nicht vom Affen abstammt und die Evolution Unsinn ist«, erzählt Basad. Einer Freundin von ihr sei auf Initiative des Klassenlehrers die Lektüre von Teenagermagazinen verboten worden. Weil sie einen Fleck auf dem Zahn gehabt habe, habe Basad zudem wochenlang einen hellen Stein unter ihr Kopfkissen legen müssen – der die dunkle Farbe aus dem Zahn ziehen sollte. Ein Freund Basads, der Linkshänder sei, habe einen Kristall halten müssen, der ihn zum Rechtshänder machen sollte. Die Arier seien die überlegene Rasse, hätten Lehrer ihr schon als Kind in der Schule erklärt – ganz im Sinne der Wurzelrassentheorie, die Steiner von der Begründerin der okkultistischen Theosophie, Helena Blavatsky, übernommen hatte. Außer esoterischem und rassistischen Unsinn habe Basad allerdings nicht viel in der Schule gelernt: »Es war eher wie in einem Kindergarten.«
Ähnlich sehen die Erinnerungen von Jan-Michael Richter aus, der als Comiczeichner unter dem Namen Jamiri bekannt ist. »Wir haben eigentlich bis zum Waldorfabschluss so gut wie nichts gelernt«, erinnert er sich an seine Schulzeit in Bochum. »Wir haben gesungen, gespielt und was gebastelt, aber das war’s dann auch.« Für Richter im Großen und Ganzen eine schöne Zeit – eine sehr weit in die Jugend verlängerte Kindheit. Das böse Erwachen kam, als er nach dem Waldorfabschluss das Abitur machen wollte: »Auf einmal zog es an. Es war ein Druck, wie ich ihn vorher nicht kannte.« Und dem die meisten seiner Mitschüler nicht standhielten: Von 22 schafften gerade einmal sechs das Abitur. »Wir haben immer auf die Staatsschüler herabgeblickt, mit denen wir nicht einmal spielten«, so Richter. »Uns erschienen sie grob und plump. Das Abi war für die allerdings nicht so ein großes Problem.«
Dass die Stärke der Waldorfschule nicht in der Vermittlung von Wissen und Bildung liegt, geht auch aus der ansonsten eher an eine Werbebroschüre erinnernden Studie »Bildungserfahrungen an Waldorfschulen« hervor, für die Heiner Barz, Sylva Liebenwein und Dirk Randoll verantwortlich zeichnen. Mindestens die Hälfte der Waldorfschüler erhalte bezahlte Nachhilfe, auf regulären Schulen seien es gerade einmal gut 24 Prozent. Dafür, so die Studie, gehe es auf der Waldorfschule freundlicher zu: Gewalttaten auf den Schulhöfen kämen seltener vor; Drogen indes würden von Waldorfschülern häufiger konsumiert.
Claudia weiß, dass spätestens am Ende der Schulkarriere ihres Sohns Thorben noch einmal hohe Kosten für Nachhilfe auf die Familien zukommen dürften. Geld, das die Familie bereit ist, auszugeben. Ihr Sohn soll eine glückliche Schulzeit haben, koste es, was es wolle.
Thorben wird wohl problemlos einen Platz an einer Waldorfschule bekommen. In Zukunft dürfte das jedoch schwieriger werden. Der steigende Lehrerbedarf hat dazu geführt, dass die verfügbaren Arbeitskräfte knapp geworden sind. Die Bundesländer haben im Wettbewerb um Lehrer dank höherer Gehälter und der Aussicht auf Verbeamtung erhebliche Vorteile gegenüber privaten Schulträgern. Es könnte also gut sein, dass den Privatschulen in wenigen Jahren zwar nicht die Schüler ausgehen, aber die Lehrer.
*Namen geändert