Der Regen fließt von oben nach #unten
Spätestens seit der Foucault-Intimfreund und Bourdieu-Schüler Didier Eribon mit seinem Mix aus life writing und soziologischer Gegenwartsdiagnose unter dem Titel »Rückkehr nach Reims« eine breite Debatte ausgelöst hat, macht sich auch in Deutschland an allen Ecken und Enden von Netz bis Feuilleton der Verdacht breit, dass man nicht nur in Frankreich – man höre und staune – in einer Klassengesellschaft lebe.
Diesen Verdacht weiter zu nähren, ist das erklärte Ziel einer Hashtag-Kampagne, die die Wochenzeitung Der Freitag kürzlich initiiert hat. Einer der maßgeblichen Unterstützer von #unten, der Journalist Christian Baron, umreißt Ziel und Methode folgendermaßen: »Wir haben einen Aufruf gestartet, der Menschen ermutigen sollte, bei Twitter und anderswo ihre persönlichen Erfahrungen mit Armut, prekärer Arbeit und sozialer Ausgrenzung öffentlich mitzuteilen«, es gälte, ein »#metoo für das Prekariat« zu etablieren.
Die Diskriminierungsdimension »Klasse«, welcher der Hashtag Aufmerksamkeit verleihen will, steht also von vorneherein in einem spezifischen Spannungsverhältnis zu anderen derartigen Dimensionen, wie etwa race und gender. Im Freitag schreibt die Soziologin Britta Steinwachs: »Wer sein Scheitern auf schlechte Leistung zurückführt, wird kaum das Selbstbewusstsein entwickeln, mit dem die ungleich stärker im medialen Fokus stehenden Debatten um Rassismus und Sexismus durch die Betroffenen selbst geführt werden können.« Und umgekehrt: Wer es trotz bescheidener Herkunft zu etwas gebracht hat, neigt nicht selten dazu, vor Selbstüberschätzung schier zu bersten, wovon zum Beispiel ein Tweet des rüstigen Rappers Jan Philipp Eißfeldt kündet, der zu #unten altväterlich zu Protokoll gab, er habe schließlich auch »den Arsch hochgekriegt statt rumzujammern«.
So weit zur meritokratischen Alltagsreligion, an deren Grundfesten der französische Soziologe Pierre Bourdieu wie kaum ein Zweiter gerüttelt hat. Bourdieu hat mit einer unnachahmlichen Subtilität und theoretischen Finesse die »verborgenen Mechanismen der Macht« analysiert, die, allemal im Kulturbetrieb und im Bereich der höheren Bildung, nach wie vor ganz ähnlich funktionieren wie noch vor Jahrzehnten. Ob #unten daran etwas ändern wird, darf trotz aller bekundeten Solidarität bezweifelt werden, sind es doch »in den sozialen Netzwerken vor allem die Aufsteiger, die unter dem Hashtag von ihren Erfahrungen berichten«, wie Robert Pausch in der Zeit kommentiert. Die Subalternen bleiben sprachlos.
Und in der Tat finden sich mühelos Hinweise, dass es sich bei der gegenwärtigen Wiederentdeckung der sozialen Frage auch in traditionelleren Medien um einen Monolog der Arrivierten handelt, der auch nicht einer gewissen selbstreferenziellen Ironie entbehrt. Ein besonders schlagendes Beispiel dafür ist die Rezension von Daniela Dröschers sozialkritischer Autobiographie »Zeige deine Klasse«. Hannah Bethke, die Rezensentin der FAZ, gibt sich erst gönnerhaft (»Die Idee, daraus ein Buch zu machen, muss nicht schlecht sein«), um dann auszuteilen. Ihr klassenbewusster Killerinstinkt, den Bourdieu einmal akademisch-höflich als »praktischen Sinn« bezeichnet hat, zeigt sich schnell an der Form der Abqualifizierung von Dröschers Bericht.
Kritisiert werden sein Stil und seine Form, er sei stellenweise naiv bis peinlich, kurz: Bethke verlässt das Kampffeld der Argumente und zielt exakt dahin, wo es dem unbeholfenen Aufsteiger wehtut. Dass die Rezensentin argumentativ an sich schwach dasteht, zeigt sich in der Nonchalance, wie sie mit der Theorie Bourdieus umgeht, wobei man davon ausgehen kann, dass sie ihr nur vom Hörensagen vertraut ist. Da wird die dumme Frage, »ob wir mittlerweile nicht überwiegend ein System haben, das allen ungeachtet ihrer Herkunft offensteht«, schnell zu einer »ketzerischen«, als ob es Bourdieu nicht gerade um die »Illusion der Chancengleichheit« gegangen wäre. Noch weniger scheint sie verstanden zu haben, welche Stellung die von ihr zitierte »Bildungsbeflissenheit« in Bourdieus Werk hat – »Die Feinen Unterschiede« widmen ihr immerhin ein ganzes Kapitel. Die Rezension suggeriert, es handele sich dabei um eine meritokratische Tugend der herrschenden Klasse. Vielmehr sind es laut Bourdieu jedoch gerade die Kleinbürger, die die Kultur zu ernst nehmen, um sich einen Bluff oder Schwindel zu erlauben. Mit großer Geste über komplexe Theorie herzufallen, nähme sich an anderer Stelle peinlich parvenühaft aus, in der FAZ hingegen kommt man damit durch.
Doch auch abgesehen davon bleiben Fragen. So tritt #unten ausdrücklich an, um eine Lücke im »Diversity«-Paradigma zu schließen, allein: man darf skeptisch sein, was es dabei zu gewinnen gibt, wenn die Schaltzentralen der Ausbeutung einmal repräsentativ von Frauen, Schwarzen und eben sozialen Aufsteigern besetzt sind. Ein Grund zur Klage – Diskriminierung – würde jedenfalls sukzessive entfallen, es ginge ja schließlich fair zu. Chancengleichheit steht in diesem Sinne überhaupt nicht im Widerspruch zur Klassengesellschaft, sie ist vielmehr ihr Reinheitsideal. Das »gleiche Recht«, schreibt Marx in der »Kritik des Gothaer Programms«, ist das »Recht der Ungleichheit«, und diese wächst rasch, während sich der »woke capitalism« gleichzeitig mit der Unterstützung von allerlei Kämpfen um Anerkennung schmückt. Nur ist Klasse keine weitere Identität. Ihre Anerkennung bestünde in ihrer Abschaffung.
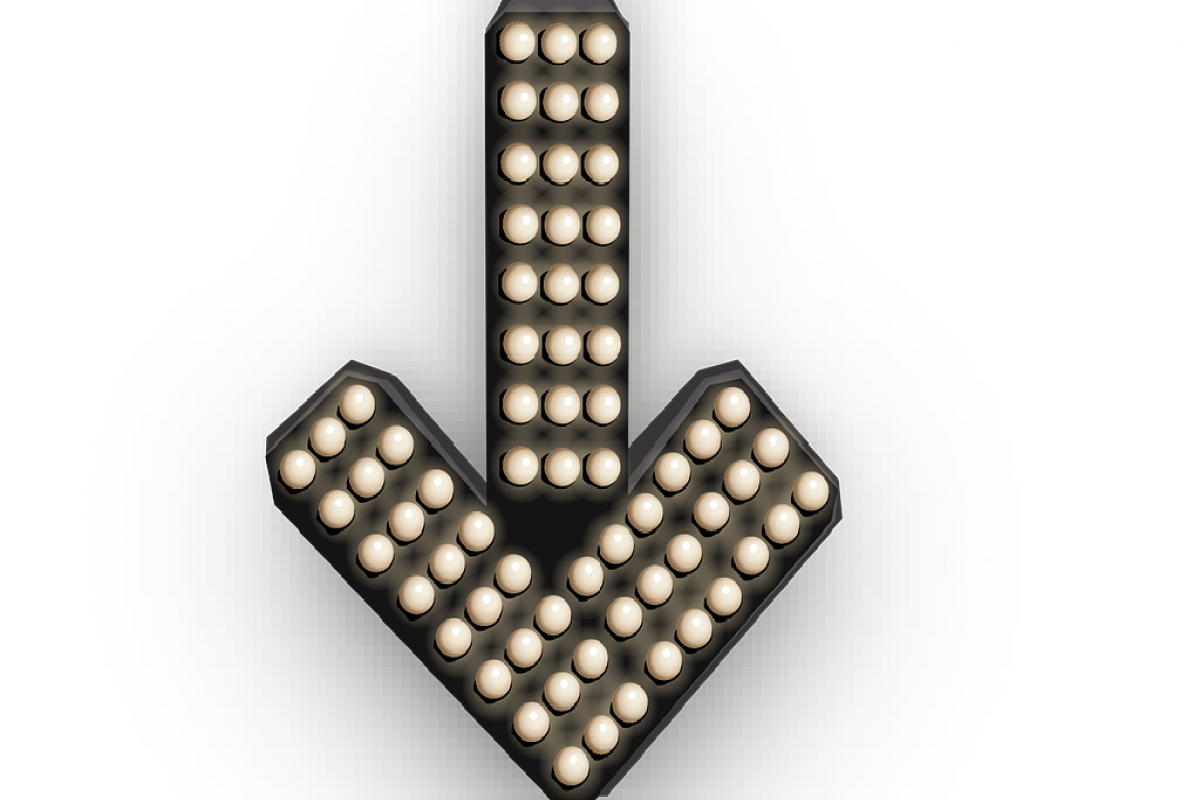

 Im Einzelnen beginnt die Welt
Im Einzelnen beginnt die Welt

