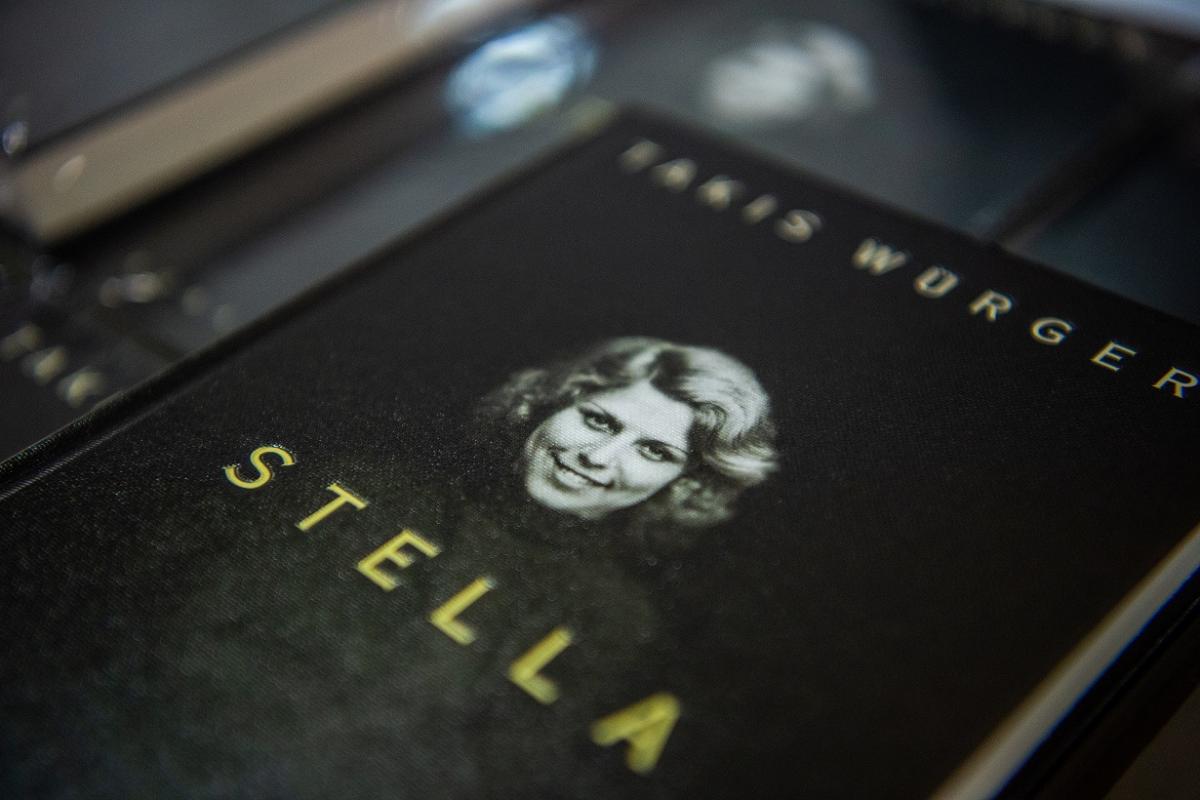Zur Kollaboration gezwungen
In Deutschland glaubt man, viel über die Shoa zu wissen. Man hat »Schindlers Liste« gesehen, Anne Frank gelesen, das Thema wird in der Schule behandelt und man hat sogar eine Gedenkstätte besucht. Eigentlich müsste es hierzulande von Experten in Sachen Nationalsozialismus nur so wimmeln. Tatsächlich macht die Empirie dieser Annahme einen Strich durch die Rechnung. Forschungen über die Geschichtskenntnisse in Deutschland zeigen Alarmierendes: Einer repräsentativen Umfrage des US-Senders CNN von 2018 zufolge wissen rund 40 Prozent der Befragten in der Altersklasse von 18 bis 34 »wenig« (35,25 Prozent) bis »gar nichts« (5,17 Prozent) über den Mord an den europäischen Juden.
Das Nichtwissen ist für sich schon skandalös und widerlegt die Verschwörungsideologie vom »Schuld-Kult«. Darüber hinaus aber will man auch gar nichts davon wissen, insbesondere dann, wenn es um die eigene Familiengeschichte geht. Die Studie »Opa war kein Nazi« von 2002 belegte, dass Nachgeborene die großelterlichen Schilderungen der NS-Zeit bei der Weitergabe an genau den Stellen umdichteten, an denen eine (Mit-)Täterschaft der Großeltern erkennbar wurde. Hinweise auf schuldhaftes Verhalten wurden überhört oder so umgestrickt, dass die Angehörigen als Opfer oder Widerstandshelden erschienen. Eine Studie der Universität Bielefeld von 2018 zeigt, dass sich dieser Trend verfestigt hat. Von den nach der NS-Zeit befragten Deutschen bejahten nur 17,6 Prozent, dass unter ihren Vorfahren Täter des Zweiten Weltkriegs waren. 18 Prozent gaben an, ihre Vorfahren hätten in dieser Zeit potentiellen Opfern geholfen. 54 Prozent behaupteten, unter den Verwandten Opfer des Zweiten Weltkriegs zu haben.
Wo man nicht wissen will, flüchtet man in den Glauben, die Wahrnehmung verzerrt sich ins Absurde. Zynisch könnte man sagen, dass es so viele Juden, wie die Deutschen gerettet haben wollen, gar nicht gegeben hat. Um die eigenen Angehörigen unter »den Guten« zu verorten, blenden sie aus, dass viele von diesen zu den 17,2 Millionen Wehrmachtssoldaten gehörten, die den Vernichtungskrieg und andere NS-Verbrechen ausführten. Auch die 8,5 Millionen NSDAP-Mitglieder und die 250 000 unmittelbar an der Shoa Beteiligten sind Angehörige heute lebender Deutscher.
Statt das, was über Stella Goldschlag bekannt ist, zu verarbeiten, klamüsert Würger eine Handlung aus verruchten jüdischen Verführerinnen, koksenden Nazis und einer Portion Berlin-Kolorit zusammen.
Dem Nichtwissen beziehungsweise Nichtwissenwollen und dem Seufzen über die vermeintliche Allgegenwart der Shoa steht ein scheinbar paradox großes Interesse an selbiger gegenüber: Jenseits akademischer Werke befasst sich eine unüberschaubare Zahl an Medienerzeugnissen aus Deutschland mit den NS-Verbrechen. Es vergeht kaum ein Tag, an dem Fernsehen und Kino keine furchtbaren KZ-Bilder oder noch fürchterlichere »Doku-Dramen« zum Thema ausstrahlen. Nazis und NS-Vergleiche bringen Quote. Meist liegt der Fokus auf den Opfern, auch die Täterinnen und Täter kommen ab und zu vor – insbesondere die führenden Köpfe. Lediglich die 80 Millionen Volksgenossinnen und Volksgenossen, welche die NS-Verbrechen durch Mitwirkung als niedrige Chargen, durch Zustimmung oder durch aktive Passivität überhaupt erst ermöglichten, sind wie der unsichtbare Elefant im Raum. Das scheinbare Paradox ist also keines, denn das Interesse an NS-Geschichte ist selektiv. Man will über die Zeit etwas wissen, nur nicht, dass die eigenen Verwandten und Vorfahren statistisch gesehen eher Nationalsozialistinnen, Antisemiten und mordende Wehrmachtssoldaten als aufrecht im Widerstand oder moralisch unbedenkliche Verfolgte waren.
Vor diesem Hintergrund ist es aufschlussreich, dass in den vergangenen Jahren ausgerechnet das Interesse an jüdischen Kollaborateuren zunahm. Ein Beispiel ist Stella Goldschlag (1922–1994), die als antisemitisch Verfolgte während der Shoa von der Berliner Gestapo dazu gepresst wurde , als Spitzel zum Auffinden anderer Untergetauchter zu fungieren. Goldschlag tauchte nach Jahren der Zwangsarbeit und der Ermordung ihres Ehemanns gemeinsam mit ihren Eltern im Frühjahr 1943 in Berlin unter. Die Gestapo verhaftete sie im Sommer 1943, folterte und erpresste sie damit, ihre Eltern nicht nach Auschwitz zu verschleppen, wenn sie andere Untergetauchte aufspüre. Stella Goldschlag war eine von 25 auf ähnliche Weise zwangsrekrutierten »Greifern«, wie die Mitglieder des 1942/1943 aus verfolgten Juden gebildeten Spitzelapparats der Berliner Gestapo bezeichnet wurden.
Seit 2016 läuft erfolgreich das Musical »Stella. Das blonde Gespenst vom Kurfürstendamm«, auch für einen Roman stand Stella Goldschlag nun Patin, nämlich für den vom Spiegel-Redakteur Takis Würger veröffentlichten, dessen Titel schlicht »Stella« lautet. Statt allerdings das, was über Stella Goldschlag tatsächlich bekannt ist, zu verarbeiten, klamüsert Würger eine Handlung aus verruchten jüdischen Verführerinnen, koksenden Nazis und einer Portion bemüht authentischem Berlin-Kolorit zusammen. Im Buch verfällt ein junger Schweizer, der ausgerechnet 1942 in Berlin Künstler werden will, einer fiktionalen Stella. Mit ihr und einem latent homosexuellen und in die Judenverfolgung involvierten Mitglied der SS besucht er frivole Jazzclubs.
Schließlich bricht er mit der angedeuteten ménage à trois, nachdem er erfahren hat, dass sein Jazzfreund und Stella in die Deportationen involviert sind.
Jan Süselbeck kategorisiert Würgers Roman in der Zeit als Holocaust-Kitsch und verweist auf die strukturelle Ähnlichkeit der Stella-Figur mit der unter anderem aus »Jud Süß« bekannten Figur der mit Schuld belasteten »schönen Jüdin«. Um die Frage von Goldschlags Schuld kreisen sowohl das Musical als auch der Erzähler in Würgers Roman. Während das Musical es als »Wagnis« betont, »über eine jüdische Kollaborateurin zu schreiben«, und dafür Preise gewann, wird der Roman auf dem Buchrücken damit beworben, angeblich »Unerzählbares zu erzählen«.
Tatsächlich zerren weder Buch noch Musical verschüttete Geschichte ans Licht. Über vermeintliche jüdische Kollaboration wurde in Deutschland seit 1945 gesprochen. Stella Goldschlag avancierte bereits während des Kriegs zur Legende. Fast in jedem Bericht über das Leben im Berliner Untergrund, wie zum Beispiel in dem von Inge Deutschkron, wird die nach Meinung ihrer Zeitgenossen außergewöhnlich gutaussehende Frau als skrupellose und besonders aktive »Greiferin« beschrieben. Eine Widerstandsgruppe versuchte, sie zu töten. Beim Neuanfang der Berliner Jüdischen Gemeinde 1945 stand sie auf einer Liste von »Belasteten«, gegen die man interne Ehrengerichtsverfahren und Strafverfahren anstrengte. Nach diesbezüglichen Anzeigen verurteilte ein sowjetisches Militärtribunal Goldschlag 1946 nach dem Kontrollratsgesetz Nr. 10 wegen Verbrechen gegen die Menschheit zu zehn Jahren Zwangsarbeit. 1956 schwer erkrankt aus der Haft nach West-Berlin entlassen, wurde sie dort 1957 erneut wegen ihrer »Greifer«-Tätigkeit vor Gericht gestellt. Der Prozess erregte über den kleinen Kreis Überlebender hinaus, die ihn angestrengt hatten, großes öffentliches Interesse. Die Boulevard-Zeitungen druckten Fotos von Stella Goldschlag und empörte Schlagzeilen über die angeblich besondere Abscheulichkeit ihres Handelns.
Es war die Zeit, in der Adorno im Hinblick auf die »Vergangenheitsbewältigung« der deutschen Bevölkerung konstatierte, dass, wenn man schon zugibt, dass es Verbrechen gegeben habe, die Opfer wenigstens daran mitschuldig sein sollten. Es war auch die Zeit, in der die Anzahl der NS-Verfahren sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR auf ein Rekordtief sank und Täter wie Franz Six – wegen seiner Teilnahme an den Verbrechen der Einsatzgruppe B von den USA in Nürnberg zu 20 Jahren Haft verurteilt – begnadigt wurden. Viele spätere Verfahren gegen NS-Täter endeten mit Freisprüchen, weil man den Angeklagten zugestand, nur als Gehilfen und unter Befehlsnotstand gehandelt zu haben. Auch die ehemalige Gestapoangehörigen, die unmittelbar für die Zwangsrekrutierung der »Greifer« verantwortlich gewesen waren, kamen fast alle ohne Strafe davon.
Das Urteil gegen Goldschlag hingegen war eine langjährige Haftstrafe, die sie wegen der in der DDR verbüßten Haft aber nicht antreten musste. In der Urteilsbegründung heißt es: »Als wesentlichen Strafverschärfungsgrund hat das Schwurgericht jedoch den Umstand gewertet, dass die Angeklagte, die selber jüdischer Abstammung ist, sich nicht gescheut hat, andere jüdische Verfolgte der Gestapo« auszuliefern. Dem Gericht stieß also schon 1957 auf, was im Musical und Roman nun schockieren soll: Wie konnte eine verfolgte Jüdin andere Juden zu ihrem eigenen Vorteil verraten? In seinem Zeit-Artikel weist Süselbeck zurecht daraufhin, dass Stella Goldschlag vermutlich einfach überleben und ihre Eltern retten wollte. Goldschlags ehemalige Peiniger beriefen sich nach 1945 vor Gericht erfolgreich darauf, dass ihnen die Hände gebunden gewesen seien, da man »sofort selbst ins KZ gekommen wäre«, hätte man sich verweigert. Aber für Goldschlag galt dieses Argument offenbar nicht, was suggeriert, dass sie in ihrer Zwangslage mehr Handlungsspielraum als Gestapo-Offiziere gehabt hätte.
Die Dilemmata, mit denen die Deutschen die Zwangsgemeinschaft der antisemitisch Verfolgten konfrontierten, beinhalteten die perfide und über 1945 hinaus wirkende Taktik, die Verfolgten zur Mitwirkung an ihrer eigenen Verfolgung zu zwingen. Primo Levi schilderte in »Die Untergegangenen und die Geretteten«, wie die Umstände der Verfolgung geradezu zur Vorteilsnahme auf Kosten der Mitverfolgten zwangen, wollte man überleben. Im Versuch, das eigene Leben zu retten, verhielten sich Verfolgte im Angesicht ihrer bevorstehenden Ermordung eben oft nicht selbstlos, sondern selbsterhaltend.
Aber selbst wenn einzelne Verfolgte, dank ihrer im Gefüge der Machtlosen relativen Macht, eine Bedrohung für andere Verfolgte darstellten: Wenn die Deutschen und ihre Helfer, die sich ohne Not an den Verbrechen beteiligten, als Täter und Kollaborateure bezeichnet werden, dann kann diese Kategorie nicht auf die »Greifer« und andere zum Verrat Gezwungene angewandt werden. Diese können nicht wegen eines individuellen, moralisch verwerflich erscheinenden Verhaltens nachträglich aus der Kategorie der Opfer entfernt werden. Das bedeutet nicht, dass eine Beschäftigung mit Stella Goldschlag und anderen unterbleiben sollte.
Nur ist dabei nicht hinter die Erkenntnis zurückzufallen, dass es Teil des Verbrechens war, die Verfolgten zur Mitwirkung an ihrer eigenen Verfolgung zu zwingen, dies die Verfolgten aber nicht zu Verbrechern macht. Die Historikerin Lucy Dawidowitz zeigte bereits 1975, dass die Anwendung des Kollaborationsbegriffs auf die Opfer der Shoa eine semantische Täuschung und historische Fehlinterpretation ist.
Wenn die Frage der vermeintlichen jüdischen Kollaboration neu wäre und die Welt ausgerechnet auf Romane aus Deutschland gewartet hätte, um endlich mal über »jüdische Täter« zu diskutieren, wäre Würgers Buch als Beitrag zur Debatte zu begrüßen. So aber stellt sich die Frage, welchem Bedürfnis es im Hinblick auf die verzerrte Geschichtswahrnehmung der Deutschen dient.
Vielleicht muss man den Roman gegen den Strich lesen, um zu einer zwar ebenfalls nicht neuen – und von Würger wohl kaum intendierten –, aber stärker zu würdigenden Erkenntnis zu gelangen: Die als Jüdin verfolgte Stella Goldschlag hat man mit Folter und dem Leben ihrer Eltern zum Verrat anderer Verfolgter zwingen müssen. Viele nichtjüdische Deutsche taten dies freiwillig.
Takis Würger: Stella. Hanser-Verlag, München 2019, 224 Seiten, 22 Euro