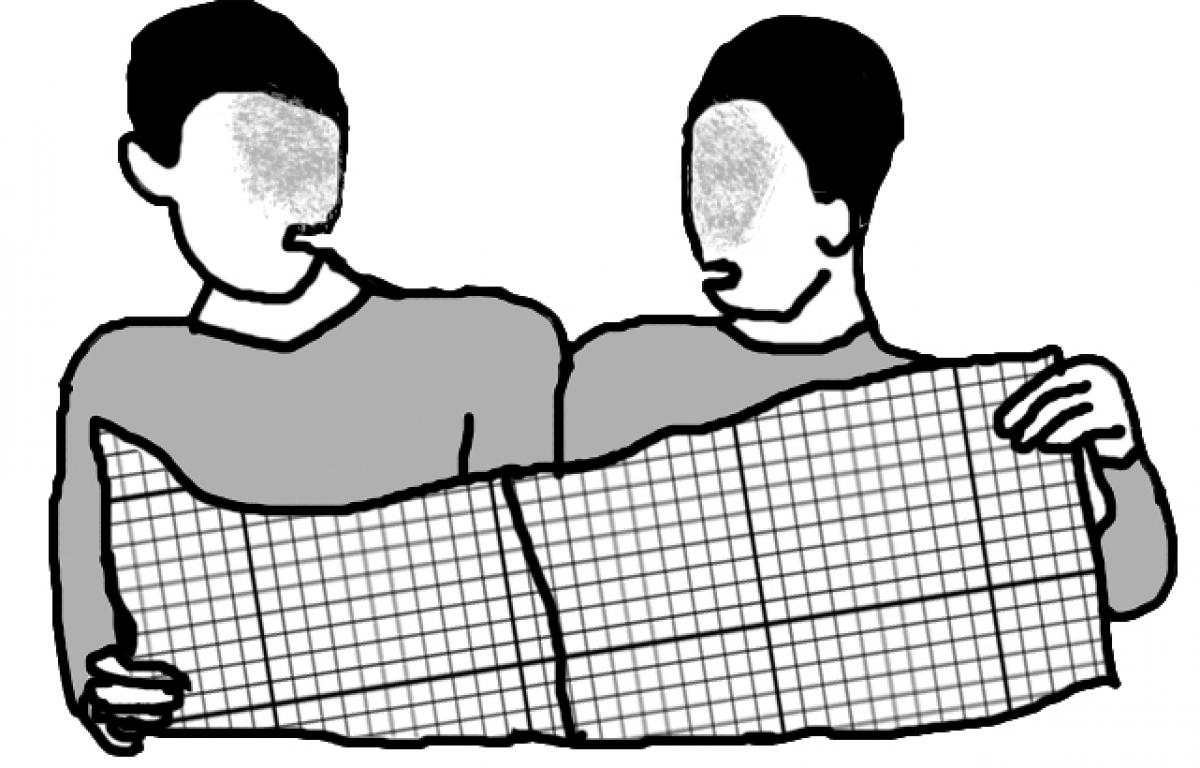(K)ein Ende in Sicht
»Die Pandemie ist vorbei«, zitierten deutsche Zeitungen den Virologen Christian Drosten am 26. Dezember 2022. Dieser fühlte sich irreführend wiedergegeben und berichtigte im NDR-Podcast »Coronavirus-Update« seine Aussage: »Ich erwarte, dass die jetzt kommende Winterwelle eher eine endemische Welle sein wird.« Paul Schuberth sah in der selektiven Wiedergabe von Drostens Aussage ein allgemeines Problem und kritisierte im Februar in der »Jungle World« (7/2023), es werde ein allzu leichtfertiger Schlussstrich unter die Covid-19-Pandemie gezogen.
Wann ist die Pandemie vorbei? Die Antwort auf diese Frage kann – je nachdem, wen man fragt – sehr unterschiedlich ausfallen. Gernot Marx beispielsweise, der damalige Leiter der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, hoffte im Frühjahr 2021, die Pandemie lasse sich bis September desselben Jahres besiegen, wenn sich unter anderem das Impftempo deutlich beschleunigen ließe. Für Paul Schuberth jedenfalls ist die Sars-CoV-2-Pandemie noch lange nicht vorbei. Zu Beginn des vierten Jahres seit Pandemieausbruch versuchte er in dieser Zeitung, eine Bilanz zu ziehen, und kritisierte das Ende fast aller Hygienemaßnahmen.
Schuberth meinte, diejenigen, die keine Masken mehr tragen wollen, machten sich willig zu »Systemversuchskaninchen« und seien desinteressiert daran, Menschenleben zu schützen. Ursächlich dafür sei die Zermürbung der Ausgebeuteten, »die ihnen die Substitution von Gesundheitsschutz durch Infektionspflicht wünschenswert erscheinen« lasse. Auffällig oft argumentiert Schuberth mit Statistiken aus dem Ausland. Außerdem verteidigt er die angeblich erfolgreichere Pandemiepolitik asiatischer Staaten. Im Gegensatz dazu habe die »westliche ›Covid for all‹-Politik« die weltweite Ausbreitung immer neuer Covid-19-Varianten begünstigt, im Artikel ist von einer »Laissez-faire-Pandemiepolitik« Deutschlands die Rede. Schuberth widmet sich anschließend Reflexionen über die Sinnhaftigkeit von Schulschließungen und Abwägungen darüber, was mehr psychisches Leid verursacht haben könnte: die Erfahrung von Krankheit und Tod durch Corona oder die Isolation im Lockdown. Letztlich zweifelt er an der Vernunft des Regierungspersonals.
So entsteht den Eindruck, er wolle um jeden Preis in dem Aufheben der Coronamaßnahmen ein Versagen der meisten demokratisch-westlichen Staaten in ihrer Fürsorgepflicht erkennen. Stattdessen erzeugten sie »Herdeninvalidität statt -immunität« durch Long Covid und ließen das durch entsprechende Propaganda auch noch »als wünschenswert« erscheinen.
Eine französische Studie, die im »Journal of the American Medical Association« veröffentlicht wurde, weist darauf hin, dass die Angst vor Long Covid einen wesentlichen Risikofaktor für die Entwicklung von Long Covid darstellt.
Das teilweise unverhältnismäßig strenge Festhalten an Hygienemaßnahmen dort, wo es nicht anlassbezogen einer realen Rücksichtnahme gilt, scheint die Spezialität eines Teils der Linken zu sein. Auch bei kleinen Veranstaltungen bitten sie noch zum Schnelltest und überlegen tagelang, ob es moralisch vertretbar sei, sich mit anderen in geschlossenen Räumen zu treffen. So ersetzen bei manchen individuelle Symbolpolitik und Moral die Analyse und Diskussion über die Politik der vergangenen drei Jahre.
Sieht man sich die entsprechenden epidemiologischen Zahlen an, ist nicht zu bestreiten, dass es trotz des Endes fast aller Präventivmaßnahmen global einen anhaltenden und andauernden Rückgang von Covid-19-Infektionen und insbesondere von solchen mit Todesfolge oder schweren Verläufen gibt – mit Ausnahme Chinas. Dort zwangen Protesten Ende vergangenen Jahres die Regierung dazu, plötzlich die zuvor durchgehend sehr harten Freiheitseinschränkungen aufzuheben. Eine relativ geringe Impfquote gerade unter alten Menschen und eine vergleichsweise niedrigere Wirksamkeit der chinesischen Impfstoffe führten zu einem rasanten Anstieg der Infektions- und der Todesfälle.
Aber was ist mit den unter dem Begriff Long-Covid-Syndrom diskutierten Langzeitfolgen einer Coronainfektion? Der Symptomkomplex »Long Covid« ist bisher nicht eindeutig definiert. Vieles spricht dafür, dass die Symptome ihre Ursache überwiegend in psychischen Erwartungen haben und verhältnismäßig selten in nachweisbaren Organschäden. Auch nach Grippe- oder anderen Virusinfektionen kommt es in einigen Fällen zu lang dauernden Erholungsphasen und nach schweren Verläufen in Einzelfällen auch zu bleibenden Organschäden. Die Forschung über Folgeschäden ist kompliziert und noch lange nicht abgeschlossen.
Allerdings liefern die Ergebnisse zum jetzigen Zeitpunkt für die Behauptung, es gebe eine »stetige Produktion frischer Vulnerabler durch Long Covid«, keine eindeutige Grundlage. Eher weisen umfangreiche, gut konzipierte Studien, wie zum Beispiel die Gutenberg-Gesundheitsstudie der Universität Mainz und eine französische Studie, die im Journal of the American Medical Association veröffentlicht wurde, darauf hin, dass die Angst vor Long Covid einen wesentlichen Risikofaktor für die Entwicklung von Long Covid darstellt.
Eine große, im Januar im British Medical Journal veröffentlichte israelische Studie kommt zu dem Schluss, dass zwölf Monate nach einer Covid-19-Erkrankung mit leichtem Verlauf die meisten innerhalb eines Jahres keine gesundheitlichen Einschränkungen mehr hatten.
Vor diesem Hintergrund ist es falsch, von einer ungebrochenen Kontinuität der Coronapandemie auszugehen. Bei aller Vorsicht bei der Interpretation von Statistiken fehlt dieser Argumentation schlicht die Grundlage. Was wäre aus linker Perspektive denn problematisch daran, wenn ein Ende der besonderen Gefährlichkeit einer Covid-19-Infektion festgestellt würde? Worin läge das Problem, wenn Long Covid nicht ganz so katastrophale Folgen hätte wie befürchtet?
Eine solche Einschätzung ist weder gleichbedeutend mit einer Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid kranker und alter Menschen, noch ist es »Pandemierevisionismus« (Schuberth). Das Schreckliche mit fragwürdigen statistischen Argumenten und Moralismus noch schrecklicher zu machen, als es war, führt weder zu Erkenntnis noch motiviert es zu Widerstand. Vielmehr besteht die Gefahr, dass daneben die andauernde Katastrophe des Gesundheitswesens vor und nach der Pandemie als relativ akzeptabel und die Rückkehr in diesen Zustand als erstrebenswert oder als kleineres Übel erscheint.
Die »Ausgebeuteten«, von denen Schuberth schreibt, waren sowohl von der Pandemie als auch von den repressiven Maßnahmen dagegen überdurchschnittlich schwer betroffen. Dass gerade sie sich jetzt nicht mehr für immer neue Lockdowns, für Maskentragen in öffentlichen Verkehrsmitteln und am Arbeitsplatz aussprechen, kann nur jemanden verwundern und ärgern, der den Kontakt zu deren Alltag völlig verloren hat. Wer an Lockdowns festhält, fordert auch Isolation in kleinen, überbelegten Wohnungen und erschwert dringend notwendige soziale Kämpfe. Auch die besondere Vernachlässigung von Kindern aus armen Haushalten durch Schul- und Kitaschließungen wird dabei ignoriert.
Was den Text Paul Schuberths dennoch teilweise überzeugend macht, ist die Enttäuschung und Wut darüber, dass die Covid-19-Pandemie mit viel Leid und einer offensichtlichen Zunahme an Ungerechtigkeit nicht zu einem Bruch mit dem Bestehenden geführt hat. Aber die Hoffnung ist naiv, eine Läuterung könne herbeigeführt werden, indem man darauf insistiert, dass die Pandemie andauert; moralische Entrüstung und die implizite Forderung nach dem starken Staat, der mit Lockdowns und anderen Vorschriften die Krise löst, sind alles andere als fortschrittlich.
Stattdessen sollten die Erfahrungen im Umgang mit der Covid-19-Pandemie dafür genutzt werden, wenigstens für eine dringend notwendige Verbesserung der Pflege in allen Bereichen zu kämpfen. Dort war die Situation schon lange vor der Ausbreitung von Sars-CoV-2 untragbar. Die im Rahmen der Pandemie erfolgten geringen Zugeständnisse wie die Einführung des Pflegemindestlohns oder der Personaluntergrenze sind völlig unzureichend, und der andauernde Skandal gerät schon wieder aus dem Fokus. Die Missachtung gesellschaftlich relevanter Arbeit drückt sich nach wie vor in deren geringer Entlohnung und in besonders schlechten Arbeitsbedingungen aus.