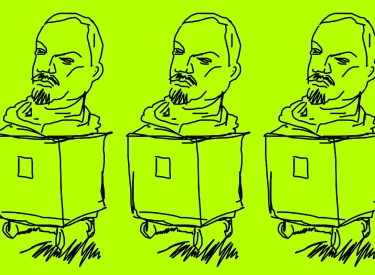Mit Kreuz und Katjuscha: Die Theologie des Terrors
Im gesamten christlichen Europa sind judenfeindliche Spottbilder nachweisbar, doch das Motiv der »Judensau« findet sich fast nur im deutschsprachigen Raum. Das bekannteste ist ein Relief an der Stadtkirche zu Wittenberg aus dem 13. Jahrhundert, das seit Jahren Gegenstand von Debatten und Rechtsstreitigkeiten ist (»Die Judensau darf bleiben«,Jungle World 23/2019). Im Juni 2022 erklärte der Bundesgerichtshof, die Schmähplastik stelle für sich genommen zwar eine judenfeindliche Beleidigung dar, doch weil die Gemeinde kritische Erläuterungstexte angebracht hatte, müsse sie nicht entfernt werden. Nun hat das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden.
Das Wittenberger Relief zeigt eine Sau, an deren Zitzen zwei als Juden erkennbare Personen saugen; eine weitere Person hebt den Schwanz des Tiers und schaut ihm in den After. Es war Martin Luther, der die vulgäre Symbolik des Reliefs auf die Spitze trieb: Die den Anus des Tieres inspizierende Person stelle einen Rabbiner dar, der so seine Heiligen Schriften lese – die »Judensau« symbolisiere mithin den Talmud.
Die Kreuzigung Jesu ist, wie der israelische Historiker Dan Diner einmal bemerkte, zum »Gründungsmythos einer ganzen Zivilisation« geworden.
In der christlichen Ikonographie steht das Schwein für die Sünde, besonders die beiden Todsünden Wollust und Völlerei, auch den Teufel oder sein Reittier. Das Motiv diente zwar zunächst der Verspottung der Juden, zumal das Schwein im Judentum als unrein gilt; das Saugen an den Zitzen wies sie zudem als parasitäre Wesen aus. Die Darstellungen sollten aber auch die Christen abschrecken, denn die Kirche fürchtete stets eine »Verführung« der Gläubigen durch jüdische Ideen. Die Juden seien bestrebt, die Christen »zu ihrem verdammten Glauben« zu verleiten, hieß es etwa im Alhambra-Edikt von 1492, in dem Königin Isabella I. von Kastilien und König Ferdinand II. von Aragón mit dieser Begründung die Vertreibung aller Juden aus Spanien anordneten.
Toxischer als die »Judensau« sind indes verschiedene Passionsdarstellungen. So zeigt eine Kreuzwegstation in Willebadessen, wie Jesus auf dem Weg nach Golgatha unter der Last des Kreuzes zusammenbricht. Die Inschrift darunter imaginiert die Juden als wütenden Mob, der den Gottessohn selbst dann noch misshandelt, als er schon kraftlos am Boden liegt: »Ach! da fällt mein Jesus wieder / Mit dem Kreuz zur Erde nieder / Und der Juden tobend Heer / Reißt ihn grimmig hin und her.«
Während Besucher den antisemitischen Gehalt der »Judensau«-Motive oft kaum wahrnehmen dürften, zumal diese sich meist in großer Höhe und in verwittertem Zustand befinden, werden die Juden hier explizit und in deutlichen Lettern als erbarmungslose Aggressoren präsentiert. Diese Anklage geht zurück auf das Gerücht über die Juden, kollektiv Schuld zu tragen am Märtyrertod Jesu Christi – aus christlicher Sicht die jüdische Urschuld schlechthin. Unzählige Verleumdungen knüpften an diese Urschuld an, Hunderttausende Juden wurden unter Bezugnahme darauf ermordet.
Die Christen imaginierten insbesondere die den Juden unterstellten Ritualmorde und Hostienschändungen als Reinszenierungen des Gottesmordes. Die historisch unhaltbare Erzählung des Neuen Testaments, wonach der »unschuldige« römische Statthalter Jesus auf Druck der Juden hinrichten ließ, nachdem ihn Judas – vom jüdischen Hohepriester bestochen – für 30 Silberlinge verraten hatte, imaginiert die Juden als die eigentlichen, aggressiven Strippenzieher hinter den Entscheidungen der römischen Obrigkeit. Diese Vorstellung ist die Urform des für den Antisemitismus so essentiellen Bildes von der Übermacht der »schachernden« Juden und ihrem unheimlichen Einfluss auf – insbesondere politische – Entscheidungsträger.
Seit 1859 befindet sich die diffamierende Inschrift in Willebadessen, ohne dass Kritik laut geworden wäre. Alljährlich findet dort eine Prozession mit Hunderten von Teilnehmern statt, auch Ausflügler und Pilger frequentieren den Kreuzweg. Gerade bei Kindern kann das vermittelte Judenbild einen verheerenden Eindruck hinterlassen, der sich nachhaltig ins Unbewusste einbrennt. Wer dieses Bild als Kind internalisiert, kann davon im späteren Leben geprägt werden, beschimpft dann etwa mit 15 seine Mitschüler als »Judensau« und engagiert sich mit 25 in einer Palästina-Initiative, weil er in den Israelis nur »der Juden tobend Heer« zu erkennen vermag.
Seit Sommer 2021 bemüht sich die Initiative Sabra, die Stadt Willebadessen zum Handeln zu bewegen, doch bis heute ist der Kreuzweg unverändert. In Wittenberg wiederum möchte man die »Judensau« nicht ins Museum befördern, vielmehr müsse man, wie es Pfarrer Johannes Block vor einigen Jahren ausdrückte, »mit der negativen Geschichte so umgehen, dass etwas Positives daraus wird«. Schwingt hier eine Art Sündenstolz mit? Die passiv-aggressive Schwerfälligkeit der Entscheidungsträger ist jedenfalls eine Machtdemonstration und zeigt, was Juden hierzulande noch immer zugemutet werden kann. Fast wünscht man sich jenen US-amerikanischen Offizier zurück, der 1945 in Kelheim ein dort vorgefundenes »Judensau«-Motiv kurzerhand zerstören ließ. Ob dieser Fall jene Unbekannten inspirierte, die 2004 in einer antifaschistischen Nacht-und-Nebel-Aktion eine »Judensau« an der Bayreuther Stadtkirche zerschlugen, ist nicht überliefert.
Die Bedeutung der Gottesmordlegende sowohl für die Shoah als auch für das Ressentiment gegen Israel wird noch immer unterschätzt. Julius Streicher bekundete unverblümt, die Leidensgeschichte Jesu habe ihn zum Antisemiten gemacht. Sein Kampfblatt Der Stürmer griff zwischen 1923 und 1944 mindestens 173 Mal auf Judas und den »Judaslohn« zurück. Ungezählt sind Adolf Hitlers Verweise auf »unseren ewigen Herrgott«, auf den »Allmächtigen« und den »Schöpfer«, ungezählt auch seine Verteufelungen von »Gottesleugnern, Atheisten, Religionsschändern«. Besonders umgetrieben hat auch ihn die Passionsgeschichte. »Wir sollen uns ein Beispiel an diesem Manne nehmen«, meinte er zum Beispiel auf einer NSDAP-Versammlung 1922, »der arm in einer Hütte geboren wurde, der große Ideale verfolgt hat und den die Juden aus diesem Grunde später an das Kreuz geschlagen haben«.
Die Kreuzigung Jesu ist, wie der israelische Historiker Dan Diner einmal bemerkte, zum »Gründungsmythos einer ganzen Zivilisation« geworden. Aus dem halluzinierten jüdischen Angriff auf Jesus, der wichtigsten Identifikationsfigur im christlichen Europa, folgt daher die Vorstellung, die Juden hätten das gesamte eigene Kollektiv im Visier. »Wir wollen vermeiden«, sagte Hitler 1923 in entsprechender Bildsprache, »dass auch unser Deutschland den Kreuzestod erleidet«.
Besonders verhängnisvoll für die Geschichte der Juden war das kollektive Eingeständnis der Schuld an der Kreuzigung, das den Juden im Matthäus-Evangelium in den Mund gelegt wird: »Da rief das ganze Volk: Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder!« Dieser »Blutfluch« diente immer wieder zur Rechtfertigung von Gewalt gegen Juden, vor allem in den Pogromen nach den Karfreitagsgottesdiensten. Mit der Formulierung »das ganze Volk« lässt das Evangelium keinen Zweifel daran, dass die Juden insgesamt für den Tod Jesu verantwortlich seien, nicht nur eine Fraktion der Juden. Und mit den Worten »und über unsere Kinder« bleibt diese jüdische Schuld – so die allgemeine Lesart – für alle nachfolgenden Generationen bestehen.
Der Wahn vom Gottesmord und Blutfluch begleitete selbst noch die Phase der ideologischen Zuspitzung des nationalsozialistischen Antisemitismus hin zum Vernichtungsantisemitismus. Hans Frank, Hitlers Generalgouverneur in Polen, berichtete in seinen Memoiren, wie Adolf Hitler 1938 Ausrottungsphantasien gegen die Juden entwickelte und dabei äußerte, er müsse womöglich den »Blutfluch« vollstrecken: »In den Evangelien riefen die Juden dem Pilatus zu, als dieser sich weigerte, Jesus zu kreuzigen: ›Sein Blut komme über uns und unsere Kinder‹«, habe Hitler gesagt, und weiter: »Ich muss vielleicht diese Verfluchung vollstrecken.«
Die Shoah als Vollstreckung des »Blutfluchs«? Was uns als Wahn erscheint, hatte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein festes ideologisches Fundament. Deutschland und Österreich waren in besonderem Maße christlich geprägt: 94,5 Prozent gehörten im Jahr 1939 einer der beiden großen Kirchen an; weitere 3,5 Prozent als »gottgläubig« Verzeichnete waren ebenfalls christlich sozialisiert. Jedes Kind hatte gelernt, dass die Juden mit der Kreuzigung des Gottessohnes eine unheimliche Schuld auf sich geladen hätten, die nach Rache schreit. Im Ulmer Einsatzkommando-Prozess von 1958 bekundete ein Pfarrer auf die Frage, warum er nichts gegen die Massenerschießungen unternommen habe, er habe gedacht, den Juden geschehe dies recht, denn an ihnen erfülle sich nun das Wort: »Sein Blut komme über uns und unsere Kinder.« Auch wenn das Motiv meist nur unbewusst wirksam ist: Der vermeintliche Gottesmord erscheint den Antisemiten als Ursünde, für die sie die Juden büßen lassen.
»Der Antisemit hasst den Juden, weil er glaubt, er sei an seinem Unglück schuld«, so der Psychoanalytiker Ernst Simmel. Da der Tod des »Herrn und Heilands« das zentrale Thema des Christentums ist, kann es kaum verwundern, dass das Unglück der Kreuzigung zum Inbegriff allen Unglücks und die jüdische Schuld daran zu einer jüdischen Urschuld geworden ist. Die berüchtigte NS-Parole »Die Juden sind unser Unglück!« drückte dieses Lebensgefühl ganz ähnlich aus wie bereits Martin Luther, der formuliert hatte, die Juden seien »unser plage, pestilentz und alles unglück«. Als Echo der Passionsgeschichte hat sich im kulturellen Gedächtnis der antisemitische Reflex verankert, die Juden stets als gierige Aggressoren und schier allmächtige Strippenzieher hinter den Übeln der Welt wahrzunehmen. Erlösung kann es in dieser Logik nur durch die Vernichtung der Juden geben. Der antisemitische Akt erscheint dem Antisemiten daher stets als Notwehr.
Im Kontext der Feindschaft zu Israel zeigt sich dieser Reflex bei Christen des Nahen Ostens besonders deutlich. Die ungläubigen Juden hätten schon Jesus gekreuzigt, meinte beispielsweise der libanesische maronitische Geistliche Gerasimos Ataya im Sommer 2022 im palästinensischen Fernsehen, da sei es kein Wunder, wie sie heute die Palästinensern behandelten. Ein christlicher Terrorist, der 2019 die junge Israelin Rina Schnerb mit einem Sprengsatz ermordete, wurde nach seiner Verhaftung als Märtyrer dargestellt, der von den Israelis ans Kreuz geschlagen wird.
Von der Antisemitismuskritik bislang völlig übersehen wird der mörderische Judenhass des lange in Jerusalem tätigen, 2017 verstorbenen Erzbischofs der Melkitischen Griechisch-katholischen Kirche, Hilarion Capucci, den die Israelis 1974 des Schmuggels von Waffen für die PLO-Brigaden überführten. Er hatte in seinem Mercedes, mit dem er als Geistlicher unkontrolliert von Beirut nach Jerusalem einreisen konnte, Maschinengewehre, Handgranaten und 30 Kilogramm TNT-Sprengstoff transportiert. Ein Vertreter der PLO sagte 2019 gegenüber al-Jazeera, dass der Erzbischof »für lange Zeit der wichtigste Waffenlieferant« für das Westjordanland gewesen sei.
Erzbischof Hilarion Capucci wurde 1974 von den Israelis des Schmuggels von Waffen für die PLO-Brigaden überführt. Er setzte sich sein ganzes Leben lang dafür ein, Israel bis aufs Blut zu bekämpfen.
Capucci setzte sich sein ganzes Leben lang dafür ein, Israel bis aufs Blut zu bekämpfen. Für ihn war der »Jihad der einzige Weg zur Befreiung«. Schon als junger Priester predigte er, dass es »die Juden waren, die Jesus gekreuzigt haben«. 1968 führte er an der Seite des Großmuftis von Jerusalem antiisraelische Demonstrationen an. Denn schon lange existiert im Nahen Osten eine »Einheit von Kreuz und Halbmond« gegen die Juden, schließlich ist Jesus im Islam der wichtigste Prophet nach Mohammed. Dass die Juden es auf Jesus und Mohammed abgesehen hatten, ist in islamischen Gesellschaften ein Gemeinplatz – doch nach islamischer Lesart scheiterten sie in beiden Fällen mit ihren teuflischen Plänen. Dies und die militärischen Niederlagen, die die Juden nach islamischer Geschichtsschreibung in frühislamischer Zeit erlitten hatten, führten dazu, dass der islamische Antisemitismus eine etwas andere Färbung annahm als der christliche, der den Juden stets eine Art »teuflische Allmacht« zuschreibt.
Als es nach 1967 »für die Fedajin schwierig wurde, die Stacheldrähte zu überwinden«, ging Capucci einen Schritt weiter, wie er in seinen bislang unbeachteten, 2018 auf arabisch erschienenen Memoiren offenbart: »Ich gründete die erste Zelle innerhalb Jerusalems, die Treffen fanden im Erzbistum statt.« Anfangs habe man nur über einfache Waffen wie Molotowcocktails verfügt. »Deshalb beschloss ich, starke Waffen von außen zu beschaffen, um Operationen im Inneren zu starten.« Capucci war sich über die Konsequenzen klar: »Die Zelle, die ich gegründet hatte, führte vor meiner Verhaftung mehrere Operationen durch, von denen ich wusste.« Ohne jedes Unrechtsbewusstsein gibt der Erzbischof zu, auch zwei Katjuscha-Raketen nach Jerusalem geschmuggelt zu haben, die dann in der Nähe des King-David-Hotels aufgestellt wurden, »wobei eine der Raketen auf die Klagemauer zielte«. Das Massaker an betenden Juden scheiterte nur, weil die Ausführenden überrascht wurden.
Nach der Verhaftung Capuccis war ein großes Wehklagen aus dem Vatikan zu vernehmen. »Capucci ist mein Bruder, und wir müssen alles für ihn tun«, habe Papst Paul VI. – Capucci zufolge – verlauten lassen. Fünf arabische Staaten gaben Sonderbriefmarken mit Capuccis Konterfei heraus. Er selbst berief sich als Erzbischof mit vatikanischem Pass auf seine diplomatische Immunität – vergeblich allerdings, denn der Vatikan hatte Israel damals noch immer nicht diplomatisch anerkannt. Der gottesfürchtige Terrorhelfer wurde zu zwölf Jahren Haft verurteilt, auf Betreiben des Heiligen Stuhls aber nach gut drei Jahren entlassen und aus Israel ausgewiesen, unter der Bedingung, sich fortan aus israelischer Politik herauszuhalten.
Zuvor, im Juni 1976, hatte Capucci noch zu den Gefangenen gehört, deren Freilassung deutsche und palästinensische Terroristen mit der Flugzeugentführung nach Entebbe gefordert hatten. Stolz berichtet der Erzbischof: »Mein Name stand ganz oben auf der Liste.« Obwohl die Entführer scheiterten, dankte der Erzbischof in einem Brief aus dem Gefängnis seinem »hochverehrten Bruder« Yassir Arafat: »Der Geist der rechtschaffenen Märtyrer, die du geschickt hast, um mich zu befreien, ist immer bei mir.« Seine rege Korrespondenz aus der Haft, etwa mit den Staatsoberhäuptern Saudi-Arabiens und des Irak, sei nur möglich gewesen, weil das Gefängnispersonal korrupt gewesen sei. Was Capucci dazu ausführt, ist wiederum als Echo der Legende von Judas und den 30 Silberlingen zu verstehen: »Der Jude betet das Geld an«, so der Erzbischof, »und tut alles, um es zu bekommen. Das wussten wir.«
Hilarion Capucci und der Vatikan hielten ihr Versprechen nicht. Ein Jahr nach seiner Entlassung reiste der Erzbischof wieder durch den Nahen Osten, traf arabische Staatschefs und PLO-Funktionäre, katholische und muslimische Brüder, nahm an Konferenzen teil, ließ sich als »Menschenrechtler« feiern und predigte Terror. Er lobte die iranische Revolution der Ayatollahs, in der er den »Finger Gottes« sah. Im Jahr 2000 fuhr er mit einem Hizbollah-Führer und einer Schar arabischer Journalisten an die libanesisch-israelische Grenze und schleuderte demonstrativ einen Stein gen Israel. In Rom applaudierte Capucci den »Märtyrern der Intifada, die in den Tod gehen wie zu einem Fest«. 2010 ging er gemeinsam mit Islamisten an Bord der berüchtigten ‚Mavi Marmara‘, um die israelische Seeblockade des Gaza-Streifens zu brechen. Im syrischen Bürgerkrieg traf er sich mit dem Diktator Bashar al-Assad, dem er seine Unterstützung aussprach, und erklärte den Arabischen Frühling zu einer »zionistischen Verschwörung«.
Capucci beteuerte, in »völliger Unterwerfung unter Gott« zu leben. Ein Soldat Jesu sei er, geleitet von der »heiligen Pflicht« und »Gottes Stimme«. Er folge dem ersten »palästinensischen Fedajin« Jesus Christus, der vor 2 000 Jahren sein Leben geopfert habe. Nach seiner Verhaftung sei ihm klargeworden, dass dies »mein Weg nach Golgatha war«. Im Gefängnis trat er in den Hungerstreik und hoffte offenbar auf den eigenen Märtyrertod durch Judenhand. »Mein Tod war das eigentliche Werk, das ich anstrebte!«, schrieb er in seinen Memoiren.
Als der Erzbischof 2017 in Rom starb, pries ihn die Hamas, die PLO benannte eine große Straße in Ramallah nach ihm. Capuccis Nachfolger im Amt des Patriarchalvikars von Jerusalem, Gregor Laham, sagte in seiner Trauerrede, die katholische Kirche und Papst Franziskus gewährten »das größte Engagement für die palästinensische Sache«. Das war vielleicht etwas übertrieben. Doch auch Radio Vatikan nannte Capucci »einen der großen Verteidiger des palästinensischen Volkes«, und weiter: »Er war ein Brückenbauer, vor allem zu den Muslimen«. Eine kritische Aufarbeitung des christlichen Antisemitismus, dessen mörderische Essenz keineswegs nur in alten »Judensau«-Reliefs vor sich hin verwittert, sieht anders aus.
Tilman Tarach ist Autor des 2022 erschienenen Buches »Teuflische Allmacht: Über die verleugneten christlichen Wurzeln des modernen Antisemitismus und Antizionismus«.