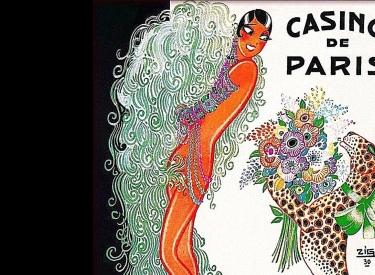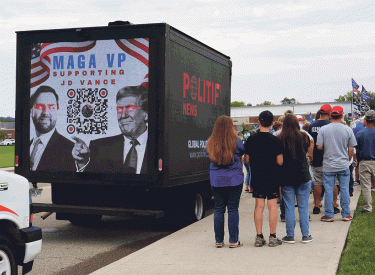Kein Hund mehr im Rennen

Für manche war die Sozialdemokratie als emanzipatorische Kraft schon mit den Kriegskrediten und der Burgfriedenspolitik im Ersten Weltkrieg am Ende. SPD-Kritiker Karl Liebknecht bei einer Rede 1918
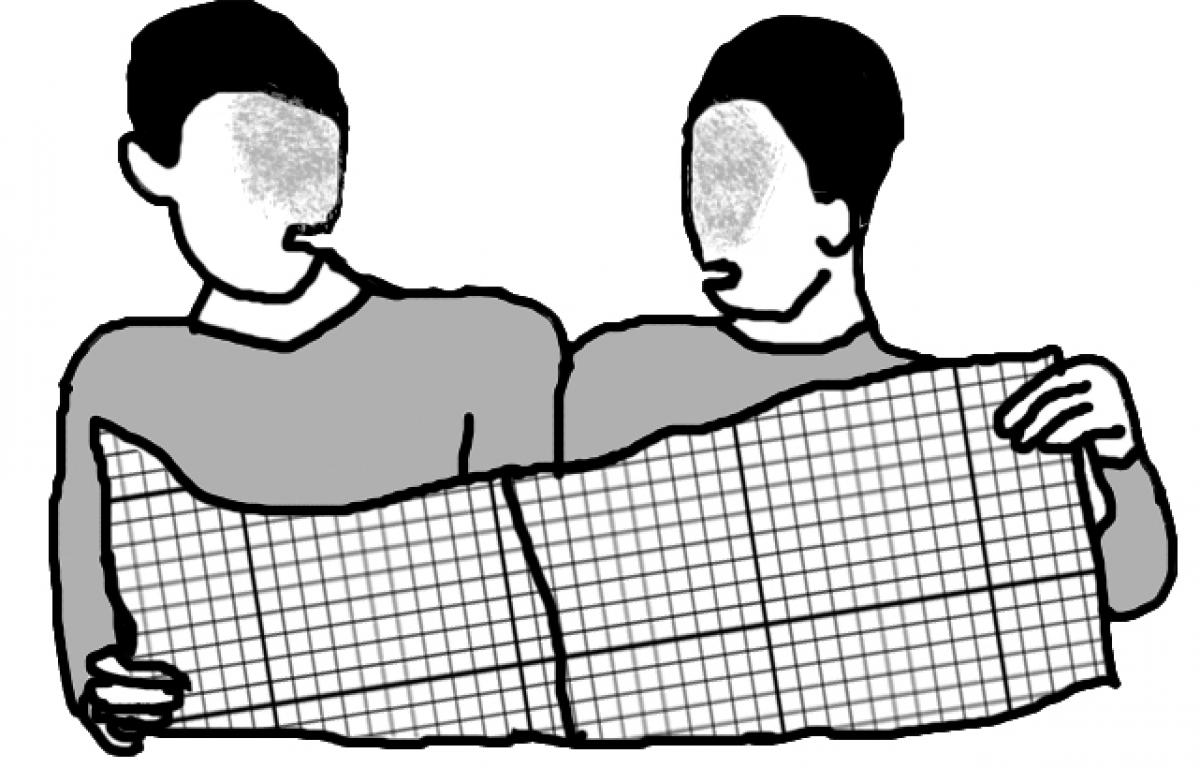 Donald Trump tritt erneut an, um Präsident der USA zu werden, und auch in der EU regieren vermehrt Rechtspopulisten und erstarken die Rechtsextremisten. Was sind die Ursachen dieses rechten Aufschwungs und was könnte ihn aufhalten? Lars Quadfasel stellte zunächst fest, dass der Aufstieg des Rechtspopulismus und seiner Protagonisten vom Format Donald Trump keine Besonderheiten der USA darstellen. Georg Seeßlen beschrieb den Erfolg Donald Trumps als Ausdruck der dunklen Seite des Amerikanischen Traums (36/2024).
Donald Trump tritt erneut an, um Präsident der USA zu werden, und auch in der EU regieren vermehrt Rechtspopulisten und erstarken die Rechtsextremisten. Was sind die Ursachen dieses rechten Aufschwungs und was könnte ihn aufhalten? Lars Quadfasel stellte zunächst fest, dass der Aufstieg des Rechtspopulismus und seiner Protagonisten vom Format Donald Trump keine Besonderheiten der USA darstellen. Georg Seeßlen beschrieb den Erfolg Donald Trumps als Ausdruck der dunklen Seite des Amerikanischen Traums (36/2024).
*
»Was die Ära Trump kennzeichnet, ist nicht bloß die stetige Eskalation der Rechten, sondern auch die Revitalisierung einer zuvor moribunden Sozialdemokratie«, schrieb Lars Quadfasel an dieser Stelle. Das ist das Ergebnis einer Fehlwahrnehmung, die für seinen ganzen Text prägend ist und darüber hinaus für die Analysen wahrscheinlich der Mehrheit unter den Linken.
In den ersten beiden Jahren der Regierung Biden ist womöglich wirklich eine solche Revitalisierung versucht worden. Deren wichtigster Teil wäre der Protecting the Right to Organize Act gewesen, der den Gewerkschaften mehr Handlungsfreiheit verschafft hätte. Der Entwurf ist allerdings nicht Gesetz geworden. Übriggeblieben ist von diesen ersten zwei Jahren vor allem ein gigantisches Ausgabenprogramm, aber wenig institutionelle Veränderung.
Das Fortschrittsversprechen, das den modernen Staat zusammenhielt und in der Sozialdemokratie verkörpert war, ist zur Karikatur seiner selbst geworden.
Von einer Belebung der Sozialdemokratie kann keine Rede sein, eher vom Versuch, ihren Leichnam noch einmal zum Leben zu erwecken. Vor einigen Wochen haben sich die Demokraten auf eine Kandidatin geeinigt, die kein Programm hatte (mittlerweile hat sie einige Seiten Programmähnliches herausgegeben); stattdessen wurde auf dem Krönungsparteitag die Parole »joy« (Freude) ausgegeben. Der Gegenstand dieser »joy« ist vor allem der Umstand, dass man jemand anderen als Joe Biden in die Wahl schicken kann. Das Prinzip »Inhalte überwinden« scheint auch in den USA angekommen zu sein.
Immerhin hat die Partei es geschafft, sich nicht über den fragwürdigen Findungsprozess der Kandidatin zu zerlegen. Der Parteiflügel, der früher Bernie Sanders unterstützt hatte, scheint nicht mehr zu existieren. Auch das ist nicht gerade ein Zeichen für eine Revitalisierung der Sozialdemokratie.
Man wünscht sich vielleicht, es wäre anders. Aber man soll sich nicht täuschen. Offensichtlich hat diese Gesellschaftsordnung niemandem mehr etwas anzubieten außer Propaganda. Ihr wirklicher Fortschritt, im Gegensatz zum bloß Versprochenen, ist das, was sich blindlings und zerstörerisch durchsetzt. Seit der Krise von 2008 ist das nur immer offenkundiger geworden. Das Fortschrittsversprechen, das den modernen Staat zusammenhielt und in der Sozialdemokratie verkörpert war, ist zur Karikatur seiner selbst geworden.
Das Versprechen wird nicht einfach kassiert, sondern transformiert sich ins Illusorische. An den Programmen und an der Politik der Regierungslinken überall in der westlichen Welt erkennt man dieselben Züge. Man kann aus diesen unschwer das Interesse derjenigen Staatsklasse ablesen, aus der sich auch schon früher die Regierungslinke rekrutierte. Diese Interessen sind aber nicht mehr in Einklang zu bringen mit denen der arbeitenden Klassen. Was im Feuilleton gewöhnlich »Exzesse der Identitätspolitik« oder ähnlich heißt, sind die Äußerungen dieser Staatsklasse, die mittlerweile leerdreht.
Bürgerliche Gleichheit, fundamentale Ungleichheit
Das Gesamtinteresse, das die Sozialdemokratie formuliert hat, war nie einfach das proletarische. Es ist von Marxisten in der SPD einmal bestimmt worden als das proletarische, insofern die Proletarier Bürger werden wollten, wie es die »Göttinger Thesen« 1978 zum Ausdruck brachten. Aber es ist dieses Interesse in der Form, wie es formuliert wird von einer Staatsklasse, die diese Verwandlung des Arbeiters in einen Bürger organisiert. Die Intellektuellen und die aufgeklärte Bürokratie, das waren die Garanten des Fortschritts.
Die Staatsklasse tat das, was in diesen »Exzessen« heute noch vorexerziert wird: Sie benannte zum Beispiel Benachteiligungen und versuchte, sie durch Ausgleichsmaßnahmen zu beheben, richtete die Gesellschaft also für die bürgerliche Gleichheit her, ohne an der fundamentalen Ungleichheit etwas zu ändern.
Barbara Ehrenreich bestimmte diese Staatsklasse als professional-managerial class und als die gesellschaftliche Basis des Staatspersonals und seiner Sozialdemokratie. Die sozialen Bewegungen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben alle angefangen auch als Aufstände gegen sie, ehe sie alle von ihr rekuperiert worden sind.
Ins Illusorische gewendetes Fortschrittsversprechen
Aber vorbei ist vorbei. Diese Staatsklasse hat heutzutage niemandem mehr etwas anzubieten. Die Sozialdemokratie ist zur Zeit der Kanzlerschaft Gerhard Schröders wirklich untergegangen; ihre Wiederauferstehung ist nicht zu erwarten. Sie hatte sich zuletzt aufgelöst im »alternativlosen« Denken, dem pensée unique (Bourdieu) des neoliberalen Zeitalters; in den Jahren vor 2008 war es wirklich egal, wer regierte. Mit der Krise ist diese Einheit zerbrochen: Ein Flügel der politischen Schicht verkauft weiter ein vollends ins Illusorische gewendetes Fortschrittsversprechen. Der andere Flügel tut so, als kümmere er sich um die im Stich Gelassenen.
Beides ist gelogen. Man hat es höhnisch am Vizepräsidentschaftskandidaten der Republikaner demonstriert: J. D. Vance, der Autor der »Hillbilly Elegy«, tut jetzt so, als interessiere er sich für die, die er in dem Buch als nutzlose Verlierer beschreibt. Darauf hinzuweisen, wird seine Anhänger aber nicht irritieren.
Die Linke hat hier keinen Hund mehr im Rennen. Sie hat die beiden politischen Optionen dieser Gesellschaftsordnung zu benennen als zwei große Übel. Sie ist vielleicht noch nicht imstande, die Verwüstungen, die das eine Lager anrichtet, genauso klar zu sehen wie die des anderen. Auch das ist eine Folge der Domestikation und Deradikalisierung der Linken in den 2010er Jahren. Der Rest der Bevölkerung sieht diese Verwüstungen allerdings sehr wohl.
Beide großen politischen Lager sind bestrebt, den politischen Markt untereinander restlos aufzuteilen, wobei ihnen in den USA das durch das Wahlrecht geschaffene de facto Zweiparteiensystem zur Hilfe kommt.
In grober und polemischer Näherung könnte man die politischen Verhältnisse so beschreiben: Jeweils drei Viertel der USA halten eine der beiden Parteien zu Recht für üble Gauner. Aber nur ein Viertel davon hält es für richtig, deswegen die andere Partei zu unterstützen. Gewinnen wird der, dessen Viertel der Gesellschaft »motivierter«, das heißt wütender ist. Und in den angestrengten Versuchen der beiden politischen Lager, diesen Zustand zu verwalten, werden die Versprechen immer nur noch hohler, noch realitätsferner, und die dazugehörige Realität noch feindlicher und trostloser.
Beide großen politischen Lager sind bestrebt, den politischen Markt untereinander restlos aufzuteilen, wobei ihnen in den USA das durch das Wahlrecht geschaffene de facto Zweiparteiensystem zur Hilfe kommt. Nur dann können sie bestehen, wenn es ihnen gelingt, dass neben ihnen nichts mehr zu Wort kommt. Das Ergebnis davon ist der Übergang in die »total verwaltete Gesellschaft«, in der jede Regung dem einen oder dem anderen politischen »Ticket« (Horkheimer/Adorno) entspricht.
Die Linke, soweit sie der »Schwanz« (Marx) eines der beiden Lager bleiben will, muss jeden Einwand gegen deren Politik aktiv beiseiteschieben. Und genau in dem Maße, in dem sie das tut, betätigt sie sich letztlich als Vorfeldorganisation einer endgültig zur Plage gewordenen Staatsklasse. Sie wird sich vergeblich fragen, was sie anders machen kann; sie wird es nicht herausfinden, und ratlos wird sie vor der nächsten völlig vermeidbaren Niederlage stehen, zum Beispiel im November.

 Straight Out of Gotham City
Straight Out of Gotham City