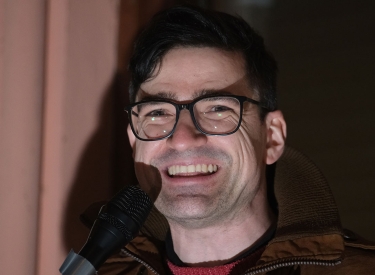Tram, Steine, Scherben
In das Gerichtsgebäude trauten sich die Männer nicht. Und auch die deutschen Freundinnen der Kenianer und Kongolesen, die im Sommer mit in der Straßenbahn saßen, als rund 20 Cottbusser Skinheads auf die Gruppe losgingen, wagten es nicht, beim Prozess-Beginn dabei zu sein. Die Angst davor, dass Mitglieder der rechten Szene oder die Angeklagten selbst sie erneut anpöbeln würden, saß zu tief.
Seit Beginn der Woche verhandelt das Cottbusser Landgericht gegen zehn deutsche Männer zwischen 15 und 26 Jahren. Vorwurf: Landfriedensbruch und schwere gemeinschaftliche Körperverletzung. Am 11. Juni hatten sie eine Gruppe von elf afrikanischen Männern und sieben deutschen Frauen in einem Straßenbahnwagen angegriffen, als diese sich gerade auf dem Weg zu einem Stadtfest befanden. Rassistische Parolen skandierend stiegen neben den zehn Angeklagten zehn weitere Skinheads zu - und fingen an, auf die Reisenden einzuschlagen und sie zu treten.
Erst an der dritten Haltestelle bequemte sich ein Passagier, die Notbremse zu ziehen. Die Skinheads stiegen aus - um von der Straße aus ihren Angriff fortzusetzen: Steine, Flaschen und Bierdosen flogen durch die offenen Türen - eine schwangere Frau wurde dabei am Bauch getroffen, andere Mitglieder der Gruppe mussten mit Blutergüssen, Prellungen und Schnittwunden in einem nahe gelegenen Krankenhaus behandelt werden.
Doch zur Beurteilung des Tathergangs kam es beim Prozess-Auftakt gar nicht. Das Gericht ließ das Verfahren erst einmal aussetzen, da einer der Verteidiger der Nazi-Skins verlangte, die Aufzeichnungen des Funkverkehrs, den der Straßenbahnfahrer mit der Zentrale der Cottbusser Verkehrsbetriebe geführt hatte, in den Prozess aufzunehmen. Darüber hinaus teilte das Gericht das Verfahren auf, weil sieben der Täter zur Tatzeit unter 21 Jahre alt waren - darunter einige, die nach Angaben des Pressesprechers, Amtsgerichtsdirektor Wolfgang Rupieper, bereits wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole und Körperverletzung vorbestraft sind. Gegen die nicht unter das Jugendstrafrecht fallenden Tatbeteiligten, den 27jährigen Andreas P., Jörg R. (23) und Sven S. (22), wird nun getrennt verhandelt. Die Verlesung der Anklageschrift quittierten die kahlgeschorenen Männer mit Lachen - der Vorwurf, eines der Opfer in den Unterleib getreten zu haben, schien sie besonders zu amüsieren.
Der als rechter Szene-Anwalt geltende Carsten Schrank versuchte außerdem, mit Verweis auf einen Formfehler die Einstellung des Verfahrens zu erreichen: In der ursprünglichen Anklageschrift sei der Vorwurf des schweren Landfriedensbruches nicht enthalten gewesen. Doch das Gericht wies seinen Antrag zurück. Gerade mit der Anklage wegen Landfriedensbruchs, so Rupieper, solle schließlich das Signal gesetzt werden, "dass der Staat sich das nicht einfach gefallen lässt". Man wolle zeigen, dass "unter anderem auch in Brandenburg" Ausländerfeindlichkeit nicht einfach toleriert werde.
Das zu beweisen, dürfte in Cottbus schwer fallen. So bezeichnet etwa die Arbeitsgemeinschaft Flucht und Migration, die Opfern rechter Übergriffe als Anlaufstelle dient, den Nazi-Angriff in der Straßenbahn lediglich als Teil des "braunen Alltags" in der Stadt. Allein für dieses Jahr hat die Initiative 24 Überfälle von Angehörigen der Cottbusser Nazi-Szene auf Ausländer gezählt.
Der Tram-Überfall auf die Afrikaner hatte im Sommer auch überregional für Aufsehen gesorgt. Nachdem der Spiegel über das rassistische Klima in der 130 000-Einwohner-Stadt an der Spree berichet hatte, bemühte sich die Stadtverwaltung darum zu beteuern, dass Cottbus keineswegs ein Nazi-Probleme habe. Besorgt um den guten Ruf und die Standort-Qualitäten der Niederlausitz-Metropole, versuchte nicht nur der Cottbusser Polizeipräsident Klaus Zacharias die Existenz einer rechtsextremen Szene abzustreiten. Es handele sich dabei lediglich, so Zacharias damals, um "kleine Jugendgruppen" - von einer organisierten rechten Szene könne keine Rede sein. Auch die Sprecherin der Cottbusser Staatsanwaltschaft, Petra Hertwig, betonte immer wieder, dass ihr keine organisierten Nazi-Zusammenhänge bekannt seien.
Das sah nicht nur Moudachirou Amadou anders. Der bis zur Jahresmitte beim Fußballclub Energie Cottbus kickende schwarze Manndecker entschied sich im Sommer dazu, sein Spielerglück künftig im Westen der Republik, beim Karlsruher SC, zu versuchen (Jungle World, 27/1999). In Cottbus fühle er sich nicht mehr wohl, da er und seine weiße Frau häufig angepöbelt worden seien, zuletzt beim vergeblichen Versuch, eine Disco zu betreten.
Zu den persönlichen Angriffen kam im Mai dann noch der Auftritt des als "Multi-Kulti-Club" geltenden FC St. Pauli in der brandenburgischen Stadt. Nach dem Spielende griff eine Gruppe rechtsextremer Energie-Cottbus-Fans Busse von FC St.Pauli-Anhängern an. Im Anschluss daran zogen rund 70 rechte Fans vor das Büro des in der Cottbusser Innenstadt gelegenen Vereins für ein multikulturelles Europa - und belagerten und bewarfen es vor den Augen der Polizei. Kurz darauf kündigte Amadou seinen Vertrag.
So einfach haben es die Opfer des Straßenbahn-Überfalls nicht: Weder die Stadt noch die so sehr um ihr ausländerfreundliches Image besorgten Parteien stellten ihnen nach dem Angriff Gelder zur Verfügung.