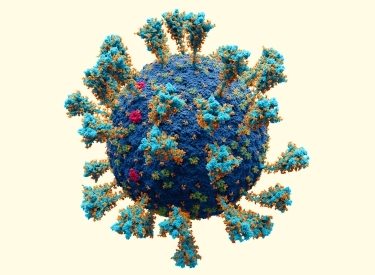Hello again
Der Foto- und Videokünstler David Reed lebt im US-Bundesstaat New York. Er arbeitet seit 1999 für die »Jungle World«.
Hallo, ich bin’s wieder, es ist eine Weile her, ich weiß.
Alles hat sich geändert, jedenfalls einige Dinge. Ich habe mich verloren.
Rückblickend fühlte es sich tatsächlich wie ein Bruch an an dem Abend, als mir mein Sohn vor vier Jahren die Nachricht schrieb: »Wir sind gefickt«. Ich beruhigte ihn damals, als er nach seinem Pass fragte, damit, dass Politiker manchmal Dinge sagen. Ich konnte mir denken, dass es schlimm werden würde, aber in Wirklichkeit glaubte ich es nicht. Auch wenn das jetzt wenig bringt, habe ich mich entschuldigt.
In besseren Zeiten wäre ich auf dem einen oder anderen Parteitag, aber wie so viele andere bleibe ich zu Hause und denke über Fragen nach, von denen ich mir wünschte, dass sie nicht wichtig wären. Als Hüter der Familiengeschichte bin ich derweil umgeben von der Materialität meiner Vergangenheit – Schachteln mit alten Fotos, einem Hochzeitskleid, hohen Papierstapeln. Ich habe meine Marie-Kondo-Momente, in denen ich mir eine klare Sicht wünsche, aber ich bin in Wirklichkeit eher wie die Collier-Brüder, die Hoffnung auf eine klare Sicht bleibt eine Hoffnung.
Ich muss an Walter Benjamins Engel der Geschichte denken, Trümmer vor den Füßen, während ich die staubigen Überbleibsel der Vergangenheit durchsiebe.
Ich befinde mich im Apartment meiner Großmutter, an einem großen Tisch, an dem eine religiöse Feier stattfindet. Zwei Erinnerungen, am Anfang und am Ende eines sonst vergessenen Abends: Terror bei der Ankunft, durch den »Struwwelpeter« blättern und eine melancholische Ruhe während des Tischgebets – »bensching«.
Mein Patenonkel Bob hat einmal einen Text geschrieben mit dem Titel »The Circumstantial and the Evident« über eine Untersuchung von Zeichen mit unbestimmter Bedeutung, die dazu beitrug, einer Reihe meiner eigenen Reisen einen Rahmen zu geben. Ich sitze auf der Couch in seinem Wohnzimmer, vor dem alten Fernseher, dahinter eine Fundsache aus der Zeit, in der er für ein Museum arbeitete.
Die Nachrichten sind schlecht, wie sie manchmal sind, Bob wendet sich zum Papagei und sagt: »Macht dir keine Sorgen, L. B., es ist nur menschlicher Scheiß.«
Ich befand mich in Osteuropa zu Zeiten eines bestimmten Wendepunkts. Francis Fukuyama zufolge sollte es das Ende der Geschichte sein, auch wenn zumindest der späte Benjamin es besser gewusst hätte. Irgendwo im Hintergrund die Geschichten des Großvaters meiner Mutter, der in Sibirien diente, in der »Zarenarmee«, wie er sie nannte, und die meines Großvaters von der anderen Seite der Familie, der mit einem Eisernen Kreuz ausgezeichnet wurde. Die Möglichkeiten schienen grenzenlos, bis sie es nicht mehr waren.
Nicht, dass es keine Schwierigkeiten gegeben hätte, aber vieles schien leichter damals. Nach einer nächtlichen Begegnung auf einem schneebedeckten Weg in Murmansk kam ich bei meinem Freund Sasha mit einem blauen Auge an. Ähnlich wie damals, als ich in der Mongolei von einem Pferd stürzte, und viele andere Male, pflegte mich Sashas Mama wieder gesund, aber sie kicherte damals und verfiel immer in eine gewisse Freude, wenn sie mich daran erinnerte, wie ich mit einem blauen Auge bei ihr angekommen war, auch später noch, bis sie an Demenz erkrankte. Und dann gab es dieses eine Mal in Wolgograd, als ich in Gewahrsam genommen wurde, nachdem ich ohne meinen Reisepass erwischt worden war. Ich versuchte, den Beamten zu erklären, dass dieser schwer zu finden wäre, wenn sie mich weiter festhielten, aber das half nichts. Schließlich kamen meine Freunde Russell und Bettina, lachend, zu meiner Rettung.
Später war ich dort oder anderswo auf Reisen – in Mexiko-Stadt, in Venedig, in der Oblast Swerdlowsk, Katja und Sova besuchen, oder als Tramper in der Mongolei. Es war nicht so, dass ich Abenteuer an sich unbedingt brauchte. Zum Teil hatte ich das Gefühl, dass das Fremde vertraut war und das Vertraute fremd.
Ab und zu lebte ich in Berlin. Es war nur eine Kuriosität, nichts weiter, dass mein Onkel die gleichen Straßen gegangen war, einige Blöcke weiter studiert und später in dem Gefängnis gedient hatte, an dem ich mit dem Fahrrad vorbeifuhr.
Die ferne Vergangenheit fühlt sich heute näher an, und ich wünschte, ich könnte mit meinem Vater über Dinge reden, von denen ich früher dachte, sie seien unwichtig – und mit meinem Opa, der Jahrzehnte nach seiner Ausreise seine Verwunderung über das Geschehene zum Ausdruck brachte: Er sagte, er sei ein »guter Deutscher« gewesen.
Mein Cousin Seth organisierte einen Familientrip nach Israel, wo meine Cousine Sara die Bat Mitzwa ihres Enkelkindes feierte. Alles verschwamm im Hebräischen, bis ich auf Polnisch hörte: »Nie rozumiem po polsku.« (Ich verstehe kein Polnisch.) Es stellte sich heraus, dass Saras Mutter den Satz von einem Unbekannten gelernt hatte, als sie zu NS-Zeiten wegen ihres polnischen Opas nach Polen deportiert wurde. Da sie nach Deutschland zurückgeschickt wurde und später nach Israel auswanderte, hatte sie nie die Gelegenheit gehabt, die Phrase nützlich zu verwenden. Aber sie brachte diese ihrer Tochter bei, die sie wiederum an die nächste Generation weitergab.
Es gibt ein Brecht-Zitat, das nie gut ankam: »In den finsteren Zeiten / Wird da auch gesungen werden? / Da wird auch gesungen werden. / Von den finsteren Zeiten.« Mein bevorzugter Gesang ist eine eher kabbalistische Version von Benjamins Engel – des Aufsammelns von Scherben, des Tikkun Olam, der Heilung der Welt.
Verzeiht mir, wenn das etwas dramatisch klingt, aber so sind die Zeiten oder so kommt es mir zumindest vor. Gesang und Gebet vermischen sich so wie Fremdes und Vertrautes. Ich ordne die Teile neu an, versuche zu verstehen, wie es weitergeht.
Aus dem amerikanischen Englisch von Federica Matteoni
Der Engel der Geschichte
»Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.«
Walter Benjamin, »Über den Begriff der Geschichte«, 1940 (siehe Der Engel wird 100)