Was können wir für Lesbos tun?
Das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos gilt zu Recht als ein Höllenort in Europa. Ausgerechnet von dort kommen dieser Tage ermutigende Zeichen.

(Selbsthilfe in Moria, Bild: Stand by me Lesvos)
Die Maßnahmen sind europaweit drastisch, um die Corona-Epidemie in den Griff zu bekommen. Dennoch gibt es weiterhin viele Aufrufe, die Flüchtlinge auf Lesbos auch jetzt nicht im Stich zu lassen. Das ist richtig und gut so. Das Moria-Camp liegt in Europa und die europäische Politik ist für die Lage auf der griechischen Insel Lesbos verantwortlich, wo mehr als 20.000 Flüchtlinge und ein paar tausend Einheimische leben. Europas Flüchtlingspolitik hat die Betroffenen dort seit Jahren schon in einen humanitären „Lockdown“ versetzt und es ist daher absolut notwendig, immer wieder auf diesen Skandal aufmerksam zu machen. Es ist großartig und mutmachend, dass selbst in Zeiten der Pandemie Bundesländer wie etwa Berlin weiter Geflüchtete aufnehmen wollen.
Konkrete Solidarität
Auch deshalb sollten wir jetzt einen Schritt weiter gehen und uns fragen, wie konkrete Solidarität unmittelbar aussehen kann. Vielleicht sollten wir auch einmal einen Perspektivenwechsel wagen. Wir helfen den Flüchtlingen aus universalistischen wie zugleich sehr individuellen Beweggründen, eben auch, weil sie unser mögliches eigenes Schicksal der Helfenden verkörpern. Das ist verständlich, weil die Verletzbarkeit der Anderen immer auch ein Hinweis auf die eigene Verletzlichkeit ist. Aber was hilft tatsächlich denjenigen, die außer ihre „abstrakte Nacktheit ihres Nichts-als-Menschseins“ (Hanna Arendt) nichts mehr haben?
We Refugees
In ihrem Essay „We Refugees“ schrieb 1943 die jüdische Philosophin, die selbst ein Flüchtling vor dem Nazifaschismus war: „Wir haben unser Zuhause und dann die Vertrautheit des Alltags verloren. Wir haben unseren Beruf verloren und damit das Vertrauen eingebüßt, in dieser Welt irgendwie von Nutzen zu sein. [...] Wir haben unsere Sprache verloren und mit ihr die Natürlichkeit unserer Reaktionen, die Einfachheit unserer Gebärden und den ungezwungenen Ausdruck unserer Gefühle. Unsere Identität wechselt so häufig, dass keiner herausfinden kann, wer wir eigentlich sind. [...] und das bedeutet den Zusammenbruch unserer privaten Welt.“
All das war der Elendsort Moria. Es waren ca. 20.000 Flüchtlinge aus Afghanistan, aus Syrien, dem Irak, aus dem Kongo und Somalia... Sie hatten keine Namen, kein Gesicht, sie waren nichts anderes als Mündel einer europäischen Flüchtlingspolitik, die bekanntermaßen in Lesbos ganz unten ist. Aber Moria hat sich verändert. Es gibt zwar im Lager noch immer keine Wasserleitung, kein Krankenbett mehr, aber das Camp hat begonnen sich zu organisieren. Ein Moria Corona Awareness Team (MCAT) gründete eine autonome Selbsthilfe. In diesem Team arbeiten syrische, afghanische und kongolesische Flüchtlinge zusammen. Die MCAT-Teams klären im Camp über die Gefahren des Virus auf, machen Hygiene-Kurse und legen sehr viel Wert auf enge Kontakte zur lokalen Bevölkerung.

(Freiwillige aus Moria helfen im Supermarkt, Bild: Stand by me Lesvos)
Es ist wichtig zu wissen: Es gibt zwar einen Corona-Fall auf Lesbos, der eine griechische Pilgerin betraf, aber bislang konnten keine registrierten Fälle im Flüchtlingslager festgestellt werden. Aus Moria war in diesen Winter eben niemand im österreichischen Ischgl zum Skifahren, auf einer Dienstreise im chinesischen Wuhan oder auf einer religiösen Urlaubsfahrt. Die aktuelle Infektionsgefahr im Camp besteht also eher darin, dass das Virus von einer viel reisenden europäischen Helfer- und Medien-Community ins Camp gebracht wird, als dass es unter den Flüchtlingen selbst ausbricht.
Deswegen fühlen sich die Bewohner*innen in Moria gerade besser geschützt und nicht eingesperrt, wenn die griechische Polizei mit freiwilliger Unterstützung der MCAT-Teams den Camp-Zugang kontrolliert. Die neuen MCAT-Teams suchen die Zusammenarbeit mit der griechischen Gemeinde auf der Insel, arbeiten zusammen mit Leher*innen, Medien und anderen Inselbewohner*innen, um die notwendige solidarische Distanz zueinander herzustellen. Unterstützte werden sie dabei von Anfang an von der lokalen griechischen Organisation Stand by me Lesvos.
Schon haben sich in der Kleinstadt Agiassos im Westen der Insel eine lokale Fraueninitiative solidarisch erklärt und beginnt nun selbst Masken zu nähen, unter initialer Anleitung jener Afghaninnen die selbst seit ein paar Tagen eine kleine Fabrik betreiben und stolz sind, dass selbst der Guardian und andere internationale Medien über sie berichten. Vor einer Woche waren sie nur namenlose Flüchtlinge, heute haben sie Namen und Gesicht und fast jeden Tag berichten griechische Zeitungen und sogar das Fernsehen über sie.
Aber noch etwas Anderes tritt hinzu: Die Achtsamkeit vor der solidarischen Distanz, rückt nicht nur das Gemeinwesen neu in den Mittelpunkt, sondern aus namenlosen, bedürftigen und rechtlosen Flüchtlingen werden auch wieder Subjekte ihrer selbst, werden Inhaber von Rechten, weil sie gemeinsam mit den Einheimischen das gegenseitige Recht auf Schutz anerkennen. In dieser Selbsthilfe beginnt so etwas wie ein Akt der informellen Bürgerschaft, aus dem anonymen Flüchtling wird wieder ein „citoyen“, mithin ein „Bürger“ mit einem Namen, der, wie Rousseau es sagte: „ein höchst politisches Wesen (ist), das nicht sein individuelles Interesse, sondern das gemeinsame Interesse ausdrückt. Dieses gemeinsame Interesse beschränkt sich nicht auf die Summe der einzelnen Willensäußerungen, sondern geht über sie hinaus.“ Gemeinsam auf einer Insel zu sein, heißt jetzt in Lesbos für Einheimische wie Flüchtlinge zusammen für Distanz zu sorgen.
Zwei Überlegungen:
Natürlich müssen alle Kampagnen weitergehen, dass die Flüchtlinge in Moria das Recht haben an anderen Orten in Europa aufgenommen zu werden. Es ist wichtig, dass die solidarischen Strukturen und Initiativen in Deutschland weiter diesen menschenrechtlichen Imperativ gegenüber der europäischen Ausgrenzung einfordern: Wer europäischen Boden betritt, muss mit seiner Ankunft über alle Rechte verfügen, wie sie im Europäischen Gründungsvertrag festgeschrieben wurden. Es gibt ein Recht auf Asyl und auf Rettung, es gibt ein Recht auf: Wir haben Platz.

Wenn aber Solidarität heute in Zeiten von Corona auch heißt, sich gerade nicht die Hand zu reichen, liegt in diesem außerordentlichen Moment vielleicht die wahre Rettung der Menschen in Moria darin, sie jetzt nicht unmittelbar aus Moria retten. Warum das? Es gibt tatsächlich die berechtigte Hoffnung, dass die Selbstorganisation in Moria es schafft, ihr Camp vor dem Eindringen des Virus zu schützen. Würde ihnen das gelingen, hätten sie mehr erreicht, als alle internationalen NGO’s vor Ort in den letzten fünf Jahren. Als die Awareness-Teams vor knapp 14 Tagen mit ihrer Kampagne begannen, gab es kein Aufklärungsposter in Moria, kein Stück Seife mehr, keine Schutzmasken – es gab nichts.
Es mag verwegen klingen, aber vielleicht erleben wir in Moria auf Lesbos gerade so etwas wie die Geburtsstunde eine „Republik der Staatenlosen“ inmitten von Europa.
Damit bleiben alle Forderungen nach Evakuierung weiter richtig, denn es gibt keine Tests, kaum Schutzanzüge und keinerlei Intensivmedizin in Moria, noch nicht einmal für Einheimische auf Lesbos. In Moria selbst droht bei der Dichte der Zelte und Hütten ein Massensterben, wenn das Virus ins Lager gelangt. Wenn es also zu einem Ausbruch kommen sollte, braucht es dringende Soforthilfe - allerdings, und hier liegt der entscheidende Unterschied, darf diese Hilfe nicht mehr über die Köpfe der Betroffenen hinweg erfolgen, sondern in Abstimmung und Koordination mit den neuen Anti-Corona-Komitees. Allein das ist schon jetzt ein Unterschied ums Ganze.
Keine Normalität im Elend
Es mag verwegen klingen, aber vielleicht erleben wir in Moria auf Lesbos gerade so etwas wie die Geburtsstunde eine „Republik der Staatenlosen“ inmitten von Europa, von deren Gemeinschaftssinn ein solidarisches Europa noch viel lernen könnte. Wenn es stimmt, dass der Coronavirus unser Zusammenleben fundamental verändern wird, so wird auch das Leben in Moria, selbst wenn es am Ende wieder zur Normalität im Elend zurückkehrt, anders normal sein, wie in der Zeit vor der Pandemie. Vielleicht sollten wir in Zeiten der Not daher auch etwas mehr kommunistisches Denken wagen und uns fragen, was wir alle für die Republik Lesbos tun können!
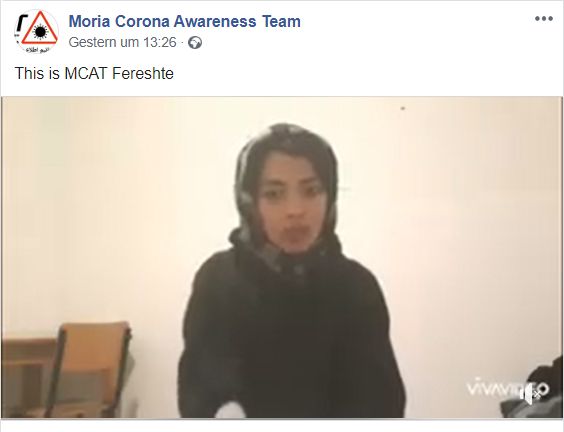
Hören wir also denjenigen zu, die jetzt begonnen haben sich selbst zu helfen. Etwa der 17-jährigen Fereshte Ebrahimi, die vor sechs Monaten aus Afghanistan vor den Taliban geflohen war und heute eine der Sprecherinnen des Moria-Corona-Awarness-Team ist.
Wer diese Kampagne solidarisch unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende an Stand by Lesvos tun, das Geld wird an die Flüchtlingskomitees weitergeleitet.
Martin Glasenapp ist Büroleiter von Katja Kipping, Parteivorsitzende DIE LINKE.
