
https://jungle.world/artikel/2020/12/die-kaenguru-chroniken
»Die Känguru-Chroniken«
»Die Känguru-Chroniken« dürfen als letzter deutschsprachiger Kinohit vor den Schließung von Filmtheatern in ganz Deutschland wegen der Coronapandemie gelten. Doch die Popularisierung von Marc-Uwe Klings »kommunistischem Känguru« ist unter Linken nicht unumstritten. Zwei Positionen.
Salonlinker Doingdoing-Kommunismus
Der Film »Die Känguru-Chroniken« bietet Albernheiten und maue Witze. Ernsthafte Stoffe brauchen aber ernsthafte Auseinandersetzung.
Von Jürgen Kiontke
Es gibt Menschen, die können ohne die »Känguru«-Geschichten von Marc-Uwe Kling nicht einschlafen. Ob das die beste Voraussetzung für den Erfolg der jetzt anlaufenden Kinoadaption unter der Regie von Dani Levy ist, sei dahingestellt. Überaus populär ist der Stoff allemal.
Zum Film: Das sprechende Tier, das den Berliner Kleinkünstler Marc-Uwe – voll verrückt, der Protagonist heißt genauso wie der Autor! – in dessen Wohnung heimsucht und das sich selbst als Kommunist bezeichnet, kämpft gegen die Verwandlung Berlin-Kreuzbergs in einen Spekulantenfriedhof. Im weltbekannten Görlitzer Park will der Unternehmer Jörg Dwigs einen gigantischen Hochhauskomplex errichten. Dwigs, zugleich Anführer einer rechtslastigen Partei, verkauft »arisch reine« Finanzprodukte. Anleger können nur geprüfte Nationalisten werden. Fürs Grobe hält er sich eine fettleibige Nazi-Schlägerbande.
Marc-Uwe, das Känguru und die Freunde aus der Nachbarschaft wollen die Vorhaben des Immobilienfritzen natürlich verhindern. Zur Gruppe gehört auch die computeraffine Maria, die Marc-Uwe ziemlich toll findet: Die Social-Networkerin ist in der Lage, den Server von Dwigs Firma zu hacken. Auf dass das »Asoziale Netzwerk«, wie sich die Gruppe nennt, das doofe Hochhaus zum Einsturz bringt, bevor es überhaupt gebaut wird.
Gar nicht mal schlecht, ein schwerer und sehr realer Stoff, um den es hier geht, den man aber auch hätte aktualisieren können. Die Handlung spielt im Jahr 2009, als es in Berlin-Kreuzberg noch eingeborene Berliner gab.
Kommunismus bei Popcorn und Coca-Cola konsumierbar gemacht zu haben, ist vermutlich Klings größtes Verdienst als Autor.
Und das Känguru ist wirklich mehr Anarchist als Genosse, es handelt überaus voluntaristisch und hat die revolutionäre Gesamtperspektive nur im Blick, wenn es ihm persönlich nützt. Es ist eher salonlinks. Oder vielleicht Lumpenproletariat. Man könnte mutmaßen: Es ist das Erste, das mit den Mitgliedsbeiträgen türmt.
Aber egal. Wie es sich für eine deutsche Komödie gehört, ist der Film randvoll mit Albernheiten und mauen Witzen. Die im deutschen Kino üblichen Verrenkungen, mit denen dort politische Prozesse dargestellt werden, gibt es hier zuhauf. Es fehlt nur Friedrich Liechtenstein als Karl Marx.
Aber man muss auch fragen: Wo lassen sich die Menschen linke Politik von einem Beuteltier erklären? Milliarden von Kindern im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg sind mit der Figur großgeworden, einen Kommunismus ohne Doingdoing-Verniedlichung können sie sich wohl gar nicht ohne Einschlafstörungen vorstellen.
Andererseits ist das linker Populismus par excellence, und angesichts der derzeitigen Performance linker Politikerinnen und Politiker nicht zu unterschätzen. Sahra Wagenknecht zum Beispiel widmet sich immer mehr »bunten« Themen, etwa ob irgendwer in der Bundesregierung Sex Appeal hat. Wo sie das tut? Im Fachmagazin Playboy. Man möchte sich gar nicht ausmalen, was als Nächstes kommt – seltsam übrigens, dass man sie nicht für die »Känguru-Chroniken« angefragt hat.
Bei Planungen im Parteivorstand sollte die Linkspartei unbedingt das animierte Känguru im Hinterkopf behalten: Als Nachfolger für den angeschlagenen Bundesvorsitzenden Bernd Riexinger wäre es sicher schlagkräftig, schon auf dem Filmplakat ist es mit Boxhandschuhen zu sehen. Wäre das ein Zeichen für die Zukunft, eine echte Linke 4.0? Dies wäre die erste Partei, die einen offenkundig virtuellen Vorsitzenden hätte! Der hätte auch in der Youtuber-Szene eine Chance.
Das Blöde an der linken Popularisierung: Sie macht sich meist selbst zum Witz, neigt zu Phantasieuniformen und Privatjets. Kommunismus bei Popcorn und Coca-Cola konsumierbar gemacht zu haben, ist vermutlich Klings größtes Verdienst als Autor. Aber so angenehm sich das anfühlen mag, geht der Stoff doch hier rein, da raus – und im Medienrummel schnell wieder unter.
Der Punkt ist: Popmarxismus ersetzt keine Marx-Lesekreise, wie sie zum Beispiel die Rosa-Luxemburg-Stiftung anbietet. Da wird Marx’ Hauptwerk studiert und diskutiert. Da lernt man wirklich was! Wie heißt es in dem bekannten Lied? »The revolution will not be televised.« Und wie heißt es noch darin? »The revolution will not go better with Coke.«
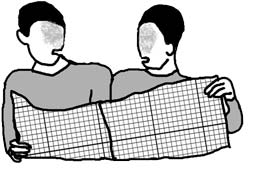 Links von mir ist nur die Leinwand
Links von mir ist nur die Leinwand
Die Verachtung der Linken für Marc-Uwe Klings Känguru offenbart die blinden Flecken in deren Selbstverständnis.
Von Babsi de le Ordinaireteur
Die meisten Linken hassen den Pop. Und warum? Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Populus ist Lateinisch für »Volk« und alle ideologiekritisch Geschulten wissen ja, dass dies keine emanzipatorische Kategorie ist. Populismus! Auch das noch. Im Wort steckt auch der Po. Im Hass auf den Pop steckt natürlich die Abwehr der analen Lust. Pop ist auch Kulturindustrie, Verrat an der Aufklärung, das Opium der Massen. Bei den ewig Gestrigen auch: die Amis und ihre Popcornkultur! Pop macht dumm und ist ein Instrument der Herrschaft.
Linke finden, Populärkultur könne nie wirklich links sein. Das, mit Verlaub, ist eine große Dummheit.
Da die Linken so schlecht über den Pop denken, überrascht es nicht, dass sie das Känguru des Berliner Autors Marc-Uwe Kling nicht ausstehen können, durch das so schöne Aphorismen popularisiert worden sind wie: »Mein, dein – das sind doch alles bürgerliche Kategorien.« Da gibt sich eine absurde Literarurfigur als Kommunist aus und wird zum Held eines Kinofilms. Das ist Pop in Reinform. Und die Linken? Sagen auch, sie seien Kommunisten, aber der Großkonzern Warner Bros. Entertainment produziert keinen Film über sie. Gemein. Abgesehen davon wollen die Linken das auch gar nicht. Oder sagen das zumindest. Sie finden, Populärkultur könne nie wirklich links sein. Das, mit Verlaub, ist eine große Dummheit.
Man könnte sich freuen, immerhin kämpft mit dem Känguru mal ein Kinoheld gegen Immobilienhaie und deren Nazischlägertrupps. Aber nirgendwo diskutiert es den tendenziellen Fall der Profitrate. Oder wie das nochmal war mit dem Wert und dem Mehrwert.
Links zu sein, erschöpft sich bei vielen Linken im Habitus. Die linke Verachtung für Klings kommunistisches Känguru ist daher vor allem eine Projektionsleistung: Man hasst das Känguru für den eigenen Einkauf im Eine-Welt-Laden, den Konsum von »Solischnäpsen« für die gute Sache im linken Kneipenkollektiv und das Abhalten von Marx-Lesekreisen. Wo praktische Solidarität und Klassenkampf ausbleiben, reagiert man sich am Kulturobjekt ab, um Distinktionsgewinn zu erzielen. Und am Ende ist es wohl auch Neid, der die Linken treibt: Wie konnte nur ein sprechendes Känguru, das am laufenden Band Kalauer ausspuckt, mehr zur Verbreitung linker Ideen beitragen als die eigene zähe politische Arbeit, die keinen Menschen zu interessieren scheint? Ein junger Popliterat erreicht ein größeres Publikum als alle Marx-Lesekreise zusammen. Das ertragen Linke nicht.
Im Kino bei einem Screening der »Känguru-Chroniken« trifft man dann auch eher jene, die distinktionsbewusste Linke abfällig als »Bauchlinke« bezeichnen: ältere Damen, die verstohlen lachen und kontinuierlich seit 2015 Stadtteilarbeit mit Geflüchteten machen; zwei junge Frauen, die mit Glitzer im Gesicht zur Seebrücken-Demonstration gehen wollen; einen Mann, der nicht so viel von tradierten Männerrollen hält.
Während die extreme Rechte in den vergangenen fünf Jahren sehr erfolgreich darin war, ihre Politik zu popularisieren, tut sich die radikale Linke damit derzeit schwer. Dabei tut Kling mit seinem Känguru genau das: Er verschafft linken Ideen Resonanz. Linke Reaktionen auf den Känguru-Film erinnern an die verpasste Chance des Willkommenssommers von 2015. Mehr und mehr Menschen in Deutschland solidarisierten sich damals angesichts der Brutalität der europäischen Abschirmungspolitik ganz von selbst mit den Geflüchteten aus Syrien, Afghanistan und Afrika. Damals schon zeigten viele Linke dafür nur die gleiche Hochnäsigkeit, die sie ein paar Jahre später wieder für die Jugendlichen von »Fridays for Future« übrig haben sollten. Dabei müssten Linke mit ihrem liebgewonnenen Distinktionsgehabe nur minimal zurückhaltender sein. Witze über die SPD und Anarchisten macht Klings Känguru schließlich auch.