»Managerfeelings und -debatten«
Was ist aus Ihrer Sicht die Hauptcharakteristik des WEF?
1971 als Forum für Managementfragen gegründet, hat es sich ab Mitte der siebziger Jahre auf Gesellschaftspolitik und Weltwirtschaft konzentriert. Ich lese die Entwicklung des WEF als Teil eines historischen Rollbacks, bei dem es darum ging, das Feld der Politik nicht den 68ern zu überlassen, sondern einer neuen Managergeneration Orientierung zu bieten. Den führenden Unternehmen mangelte es an Antworten auf die riesigen sozialen und ökonomischen Umwälzungen der sechziger und frühen siebziger Jahre, auf die antikolonialen Bewegungen, auf die Ölkrise und auf das Drängen der trikontinentalen Länder nach einer neuen Weltwirtschaftsordnung.
Wie schätzen Sie das politische Gewicht des WEF ein?
Das WEF ist als wichtiger symbolischer Ort organisiert. In Davos wird der Versuch unternommen, einflussreiche gesellschafts- und wirtschaftspolitische Debatten über die Zukunft aus der Sicht der Weltmarktelite zu führen. Nach außen wird dies mit sehr viel Geld und medialer Macht in einer hegemonialen Inszenierung produziert, die Trends setzt, als wären sie unvermeidliche Tendenzen. Nach innen arbeitet das WEF an der Diskussion eines eigenen kapitalistischen Koordinatensystems, das zum Beispiel in geschlossenen Branchentreffen gipfelt, bei denen kartellartige Absprachen möglich sind.
Das diesjährige Thema »Bridging the Divide« zielt auf die Kluft zwischen Ökonomie und Sozialem und kopiert damit sozialreformistisches NGO-Vokabular, aber auch ein zentrales Thema der feministischen Ökonomiekritik.
Die Gesellschaft nach marktförmigen Entscheidungsprinzipien neu zu planen, ist ein neoliberaler Ansatz. Die technokratische und elitäre Weltsicht der Davoser Leader wird mit einer ziemlichen Dosis Esoterik, Philosophie, Theologie und Ethik unterfüttert, die den Blick prägt, der auf Leute, die verhungern, und die riesigen Probleme der Welt geworfen wird. So gab es 1999 Foren wie »Death: Exploring the Taboo«, »Humanism: Recognizing the Secret« oder aber auch »How much Speed can we take?« Die feministische Ökonomie nimmt dagegen die Lebens- und Arbeitssituation von Leuten - auch bei der Verrichtung unbezahlter Arbeit - zum Ausgangspunkt und ist damit das breite Projekt einer antikapitalistischen Gegendebatte. Die Ausbeutung der Lohnarbeitenden oder das Leiden der Menschen sind nicht die einzigen Punkte, an denen die Konflikte aufgehängt werden.
Können Sie das konkretisieren?
Die feministische Ökonomie geht davon aus, dass Leute in sehr verschiedenen Lebenssituationen stehen und sie fragt sich, worauf Wirtschaft oder Staat zu verpflichten wären, und wie die Machtverhältnisse sind, die das behindern. Das lässt sich nicht abstrakt entscheiden, sondern kann nur Teil eines Aushandlungsprozesses sein. Deswegen sprechen feministische Ökonominnen von der Demokratisierung der Ökonomie, was zunächst heißt, über die Definition von Effizienz und Rationalität mitzuentscheiden oder andere Maßeinheiten für die Beschreibung von gesellschaftlichem Reichtum zu fordern. So wird etwa in der feministischen Staatsbudgetdebatte die Frage nach dem Zweck staatlicher Wirtschaftspolitik neu aufgeworfen und eingefordert, dass beispielsweise deren Auswirkungen auf Frauen und Männer oder auf die Menschenrechte als Kriterien einbezogen werden müssen.
Wie lässt sich die Radikalität dieses Demokratisierungsansatzes behaupten, wenn gleichzeitig das WEF mit dem Zauberwort »Dialog« GegnerInnen und VerliererInnen der Globalisierung anspricht, um sie in eine Politik des runden Tischs einzubinden?
Das WEF ist eine von der Privatwirtschaft erfundene Struktur, die sich als gleichwertiger Partner staatlicher Institutionen aufspielt. Dass unter Aufsicht des Forums Debatten zwischen wichtigen gesellschaftlichen Akteuren geführt werden und Regierungen oder internationale Organisationen Rechenschaft über ihr Tun ablegen, halte ich für eine neoliberale Offensive, die sich gegen elementare demokratische Prinzipien richtet. Man sollte das WEF als Organ der kapitalistischen Privatwirtschaft adressieren und einen entsprechenden Forderungskatalog erstellen, der zum Beispiel Reparationszahlungen umfasst. Sonst wird eine Sicht reproduziert, die staatliche und unternehmerische Institutionen als vergleichbare Stakeholders behandelt.
Außerdem ist es skandalös, dass letztes Jahr ein Greenpeace-Vertreter einverstanden war, die Kontroversen mit einem Shell-Manager unter Ausschluss der Medien zu führen. Was war sein Mandat? Politische Transparenz wird nicht hergestellt, indem der Prozentsatz von NGOs erhöht wird, sondern, indem diejenigen, die auf das Forum gehen, zur Rechenschaft gezwungen werden. Wer da ernsthaft als BittstellerIn auftritt und um Verständnis wirbt, trägt selbst zu einer paternalistischen, moralischen Diskussion bei, in der Besorgnis über die Welt inszeniert und geteilt wird. Offenbar gibt es das Bedürfnis, davon angerührt zu werden, dass ein Broker wie George Soros sagt, so gehe es nicht weiter. Die Frage ist doch, wie es weitergehen soll, und das darf nicht der Definitionsmacht eines geschlossenen Managerforums und einer handverlesenen Schar nicht mandatierter NGO- oder RegierungsvertreterInnen überlassen werden.
Zeigt sich auf dem WEF der vielbeschworene Davos Man? Trifft man dort auf eine modernisierte herrschaftliche Subjektivitätsform des fortgeschrittenen Kapitalismus?
Ich meine, dass in Davos der Manager, der Verantwortung für die gesamte Gesellschaft übernimmt, die westliche hegemoniale Subjektivität ablöst, die von Männern geprägt war, die Nationalstaat, Unternehmen und Familie wie einen Haushalt hinter sich versammelten und gemeinsam Gesellschaft repräsentierten. Die riesige Definitionsmacht dieser neuen, selbst ernannten und zu 90 Prozent männlichen Führer wird in Davos symbolisch zum Beispiel durch den großen Ernst konstruiert, mit dem Journalisten am Puls der Managerfeelings und -debatten Trends und tiefschürfende Weltauseinandersetzungen herauszuhören versuchen. Die kritische Politik diskutiert leider kaum darüber, inwiefern das Geschlechterverhältnis Teil dieser Produktion der hegemonialen Macht von Davos ist.


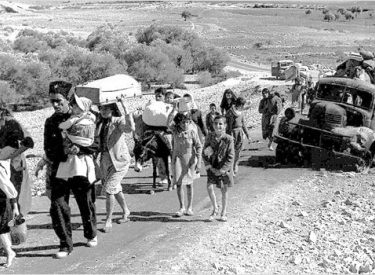

 »Hier geht die Panik um«
»Hier geht die Panik um«