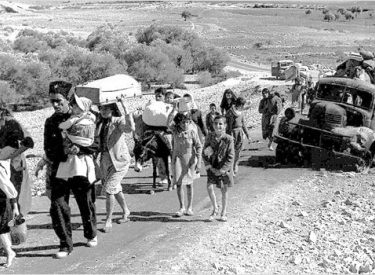2024/25
Jennifer Córdova, Transfrauenorganisation Muñecas de Arcoíris, im Gespräch über Gewalt gegen LGBT-Personen in Honduras
Interview
2024/24
Jan-Michael Simon, UN-Experte, im Gespräch über die Menschenrechtslage in Nicaragua
»Das Präsidentenpaar kontrolliert alle drei Staatsgewalten«
2024/23
Adi Schwartz, Autor, im Gespräch über die Forderung nach Rückkehr palästinensischer Flüchtlinge nach Israel und warum diese bösartig ist
»Israel ist hier, um zu bleiben«
2024/23
Ronya Othmann, Schriftstellerin, im Gespräch über die Verfolgung der Yeziden
 »Hier geht die Panik um«
»Hier geht die Panik um«
2024/22
Ein Gespräch mit dem Historiker Giorgi Kartwelischwili über die Proteste in Georgien
»Die Proteste brauchen neue Impulse und Inhalte«
2024/21
Charles A. Small, Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy, im Gespräch über die Finanzierung US-amerikanischer Universitäten durch Katar
»Juden zu dämonisieren, ist akzeptiert«
2024/20
Jasna Causevic, Gesellschaft für bedrohte Völker, im Gespräch über den Genozid von Srebrenica
»Die Resolution ist ein Weckruf«
2024/19
Omar Everleny Pérez, Ökonom, im Gespräch über die desolate wirtschaftliche Lage Kubas
»Die Situation ist explosiv«
2024/18
T. J. Childers, Drummer von Inter Arma, im Gespräch über KI in der Musikproduktion
»Ohne Inszenierung geht es nicht«
2024/17
Anja Bensinger-Stolze, Gewerkschafterin, im Gespräch über Bildungsförderung