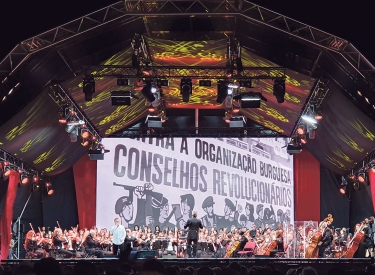»What are you proud of?«
Die junge Frau hat ein schwarzgeblümtes Kleid an, auf dem ein pinkfarbenes Dollarzeichen aus Papier klebt. Sie verteilt pinkfarbene Zettel, auf denen steht: »What are you proud of?« Eine Passantin bleibt stehen, nimmt einen Zettel entgegen und wird von ihr in ein Gespräch verwickelt. »Worauf bist du stolz?« fragt die Passantin nach ein paar Minuten. Die junge Frau antwortet, sie sei auf die queere Gemeinschaft stolz und auf die Erfolge der Act-Up-Bewegung, die das Thema Aids in den achtziger Jahren in die Öffentlichkeit gebracht hat. Daraufhin richtet sie dieselbe Frage an die Passantin, die mit der Antwort nicht zögert: »Ich bin stolz darauf, dass du stolz sein kannst, worauf auch immer du stolz bist.« So redundant diese Aussage klingt, sie steht doch ziemlich genau für die Haltung, die die Mehrheit der LGBT-Community und ihrer Unterstützer und Unterstützerinnen in New York vertritt. Das Thema »Stolz« scheint sich im Lauf der Jahre verselbständigt zu haben. Denn dass sich der Stolz aus den erfolgreichen Kämpfen um das Stonewall Inn entwickelte, ist zwar als historisches Ereignis durchaus bekannt, von der kämpferischen Stimmung ist allerdings nichts mehr zu spüren. So lautet auch das Motto der diesjährigen New York City Pride wenig provokant: »Proud and Powerful«.
Kraftvoll zeigt sich die LGBT-Community vor allem beim Feiern. Dieses Jahr feiert sie nicht nur sich selbst, sondern auch Gouverneur Andrew Cuomo. Ihm ist es zum Großteil zu verdanken, dass am 24. Juni das Gesetz für die Gleichstellung der Homosexuellen-Ehe beschlossen wurde. Seit Jahren streiten die Demokraten für ein solches Gesetz, doch erst jetzt ist es ihnen nach einer großangelegten Kampagne gelungen, genügend Abgeordnete dafür zu gewinnen. Mit 33 zu 29 Stimmen wurde es verabschiedet. New York ist damit der sechste von 50 Bundesstaaten, der die Ehe für Schwule und Lesben möglich macht. Die Legitimation der gleichgeschlechtlichen Ehe bedeutet für Homosexuelle allerdings nur, sich staatlicher Kontrolle zu unterwerfen und steuerliche Vorteile zu genießen. Eine Kritik an der Anpassung an die staatliche Bevölkerungspolitik fehlt hier völlig, und gesellschaftliche Anerkennung, geschweige denn die Dekonstruktion heterosexueller Geschlechterrollen, ist noch längst nicht in Sicht.
Doch wer glaubt noch daran, dass Kämpfe notwendig sind, wenn rund eine Million Menschen an den Veranstaltungen der NYC-Pride teilnehmen? Allein 350 Gruppen und 500 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer umfasste der Umzug auf Manhattans 5th Avenue am 26. Juni. Die Masse macht’s. Und das konnte man ob des ziemlich konstanten Lärmpegels an lauter Musik, Hupen, Johlen und Schreien auch glauben. Schreien schien ein essentieller Bestandteil der Verständigung zwischen Beteiligten an der Pride und Zuschauerinnen und Zuschauern zu sein. Sie feuerten sich fortwährend gegenseitig an, um ihrer Begeisterung und ihrem Einvernehmen Ausdruck zu verleihen. Dieser Akt wechselseitiger Selbstbestätigung und Kommunikation verschaffte den Schreienden die Aufmerksamkeit, die sie im Alltag nicht haben. Natürlich war der Jubel auch Ausdruck der Freude, aber gleichzeitig war der Umzug doch ein kilometerweites Schaulaufen, bei dem das Feiern nicht Selbstzweck war, sondern der Präsentation von Größe diente. Und es war eine willkommene Werbeplattform für die Sponsoren der Pride-Parade, bei deren Auswahl die Organisatorinnen und Organisatoren nicht besonders wählerisch waren. Die Supermarktkette Target, die großzügige Spenden an homophobe Gruppierungen leistete, die Bank Wells Fargo, die für ihre rassistische Kreditvergabepraxis in die Kritik geriet, und die Kreditkartenorganisation Mastercard, die mit ihrer Zahlungsblockade gegenüber Wikileaks im vergangenen Jahr für Aufsehen sorgte, waren unübersehbar in der Parade und auf allen Werbemitteln vertreten.
Gegen die Kommerzialisierung der Pride und ihre Geschichtsvergessenheit hinsichtlich der Notwendigkeit politischer Kämpfe hatte die Gruppe Quorum (Queers Organizing for Radical Unity and Mobilization) aufgerufen. Anhängerinnen und Anhänger dieser Gruppe verteilten die pinkfarbenen Dollarzeichen an die Zuschauerinnen und Zuschauer, um ihnen die Frage zu stellen, worauf sie stolz seien. Tatsächlich schaffte es die kleine Gruppe von fünfzehn Leuten, viele Zuschauerinnen und Zuschauer auf sich aufmerksam zu machen, doch die Reaktionen waren, wenn auch positiv, so doch inhaltsleer: »I’m proud of myself«, lautete eine Antwort, oder auch »I’m proud that I’m gay«. Ein solch selbstreferenzieller Bezug auf die eigene Identität lässt nicht viel Raum für Reflexion über die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen das Selbst sich befindet.
Und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die LGBT-Community sind in New York trotz der neu gewonnenen Option auf eine Heirat nicht besonders bestechend. Erst im März starb ein schwuler Mann im Stadtteil Queens an den Folgen eines »Hate Crime«, nachdem er von mehreren Jugendlichen angegriffen und brutal zusammengeschlagen worden war. Mitglieder der LGBT-Community wissen nur zu genau, dass sie sich vor Diskriminierung immer noch nicht sicher fühlen können. Vielleicht tragen sie bei der Pride-Parade gerade deshalb ihren Stolz wie einen Panzer vor sich her, der das unangenehme Wissen um die gesellschaftlichen Missstände wenigstens an diesem Tag fern halten soll.
Als weitaus politischer gilt der Dyke March, der immer einen Tag vor der NYC-Pride stattfindet und dieselbe Strecke abläuft. Die Organisatorinnen bezeichnen ihn als Protestmarsch, um sich klar von den anderen Pride-Paraden abzugrenzen. Kämpferisch erklären sie, dass sie nicht um Erlaubnis fragen, um gemeinsam mit Tausenden Frauen die Straßen New Yorks für den Kampf um ihre Rechte einzunehmen. Tatsächlich nahmen am Dyke March, der am 25. Juni stattfand, rund 7 000 Menschen teil. Es ist ein seltenes Erlebnis, so viele queere Frauen an einem Ort versammelt zu sehen. Doch auch hier verschwand der politische Protest hinter der selbstzufriedenen Feierstimmung.
Angeführt von einer Trommelgruppe, die aus einer Riege älterer Second-Wave-Feministinnen bestand und eine doch sehr folkloristische Stimmung verbreiteten, wälzte sich der Marsch die Straße entlang, eingezwängt zwischen schmal ausgelegten Polizeibarrieren mit mehreren Metern Sicherheitsabstand zum Bürgersteig. Nach einer Stunde hielt der Umzug an, weil die Organisatorinnen den Abstand zwischen den Polizeibarrieren für zu gering erklärten. »Die Polizei hat den Abstand im Vergleich zu den letzten Jahren verringert und wir laufen nicht weiter, bis sie ihn wieder vergrößern«, sagte Lauren Gulbrandson, eine der Organisatorinnen. Eine halbe Stunde verging, die Protestierenden skandierten: »Take back the street!«, doch eine Diskussion zwischen den Streitparteien war nicht zu erkennen. Und so marschierte man unverrichteter Dinge weiter. So viel zur Protestkultur.
Im Gegensatz zur Pride-Parade bestand der Dyke March nicht aus einzelnen Organisationen und Gruppen, sondern es mischten sich viele einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie man es von Demonstrationen kennt, bunt durcheinander. Nur der politische Anspruch einer Demonstration konnte nicht im Entferntesten eingelöst werden. Möglicherweise lag das auch an dem Motto »In dykes we trust«, das ähnlich dem NYC-Pride-Parade-Motto mit politischer Inhaltslosigkeit glänzte. Dies spiegelte sich auch in der Ästhetik des Marsches wider: Neben nichtssagenden regenbogenfarbenen Fahnen und Regenschirmen verkündeten die wenigen Transparente Botschaften wie: »We’re proud of New York«, »Trust in vaginas« und »I love girls«. Politischer, aber weitaus unerträglicher waren Aussagen wie »Queers against Israeli Apartheid« und »Stop pinkwashing Israel«, die eine in der US-amerikanischen Queer-Szene verbreitete antiisraelische Haltung zum Ausdruck bringen. Warum gerade der israelische Staat an vorderster Stelle in die Kritik der Queer-Szene gerät, konnten die Protestierenden nicht beantworten. Die Vermutung liegt nahe, dass es hier zum guten Ton queerer Identität gehört, sich gegen Israel zu engagieren.
Nach mehreren Stunden unermüdlichen Marschierens endete der Umzug am Washington Square Park, in dessen Mitte sich ein großer Springbrunnen befindet. Um ihre Freiheit und ihr Selbstbewusstsein unter Beweis zu stellen, sprangen viele der Teilnehmerinnen barbusig oder nackt in den Brunnen. Unvermeidlich artete die Aktion in ein Posieren vor den Kameras der Zuschauerinnen und der nun plötzlich auch zahlreich anwesenden Männer aus, während entfernt im Hintergrund die Trommelgruppe das Ende des Dyke March verkündete.
Eine etwas politischere musikalische Begleitung hatte die Mermaid-Parade, eine Mischung aus Mardi Gras und Sommerbegrüßungszeremonie, die auf der Promenade von Coney Island immer zum Sommeranfang stattfindet. Sie gilt unter anderem auch als Coney Island Pride Parade und wurde vom Rude Mechanical Orchestra (RMO) begleitet, das linke Veranstaltungen und Demonstrationen mit Musik und Performances unterstützt. Die Mermaid-Parade selbst ist nicht viel mehr als ein unkommerzieller Karneval, der durch die selbstgebastelten Kostüme und das Spiel mit Geschlechterrollen unterhält. Die ungefähr 30 Amateurmusiker des RMO begleiteten den Marsch bis zum Ende und bogen dann über den Strand zum Meer ab, wo sie im Wasser ein Medley aus politischen Liedern wie der Internationalen, Riot-Grrrl-Songs und antifaschistischen Liedern spielten.
Das RMO hatte einen Tag vor dem Dyke March beim Trans Day of Action gespielt, den das Audrey Lord-Projekt jährlich organisiert. Das Projekt setzt sich seit 1994 für die Rechte von LGBT People of Color ein und organisiert seit 2004 einen Protestmarsch für gesellschaftliche Anerkennung von Transpersonen. Zu Beginn des Marsches erklärte eine Organisatorin: »Während wir feiern, dürfen wir nicht vergessen, dass wir noch viel zu erkämpfen haben.« Mit rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war der Marsch im Vergleich zur NYC-Pride-Parade und dem Dyke March verschwindend klein. Der Umzug bewegte sich hauptsächlich auf dem Bürgersteig, an eine Straßenbesetzung war nicht zu denken. Doch auch wenn die Plakate nicht viel mehr als Gerechtigkeit, Gleichheit und mehr Rechte für Transpersonen forderten und sich damit im Rahmen staatlicher Kontrolle bewegten, war die Stimmung im Marsch offensiver und fordernder als während der Pride-Paraden. Das liegt vermutlich an der Tatsache, dass Transpersonen im Vergleich zu Homosexuellen gesellschaftlich weniger anerkannt sind. Aber erfreulich war, dass sich wenigstens hier keine selbstzufriedene politische Anspruchslosigkeit breit machte.
Trotz grauer Wolken und Nieselregens versammelten sich im Anschluss an den Trans-Marsch rund 50 Leute zum »Queer Ball«, der in diesem Jahr zum ersten Mal stattfand. Ziel des Queer Ball war es, gegen die Kommerzialisierung und die politische Verflachung der Pride-Paraden zu protestieren und die Tendenz zu kritisieren, die Queer-Szene in unterschiedlichen Märschen aufzuspalten. Hauptsächlich ging es den Veranstalterinnen und Veranstaltern allerdings darum, sich zu verkleiden und Spaß zu haben, weshalb die politischen Inhalte über ihre anfängliche Proklamation hinaus nicht weiter verfolgt wurden. Stattdessen tanzte die kleine Gruppe zur Musik des RMO über die Straßen und skandierte in unregelmäßigen Abständen: »We’re here, we’re queer, we’re fabulous, don’t fuck with us!«
Die Route des Queer Ball war so gewählt, dass er nach einiger Zeit mit dem Drag March, der von den Radical Faeries organisiert wird, zusammenstieß. Die Radical Faeries sind ein loser Zusammenhang von Schwulen, die Marxismus, Anarchismus oder Feminismus nahestehen, sich aber unter anderem auch für Esoterik interessieren. Der Drag March stellte sich in erster Linie als Verkleidungsshow heraus, die neben interessanten Kostümen immerhin auch die politische Parole »We don’t wanna marry, we just wanna fuck!« präsentierte. Der karnevaleske Haufen zog bis zum Stonewall Inn, dem historischen Geburtsort aller queeren Demonstrationsspektakel, und endete dort mit dem gemeinsamen Intonieren von »Somewhere Over the Rainbow«, der schwulen Hymne, die jedes Jahr am Ende des Marsches gesungen wird. Hier wurden zum ersten Mal Flyer verteilt, die allerdings nur den Text des Liedes wiedergaben. Zu später Stunde kam es noch zu Zusammenstößen zwischen den Feiernden und der Polizei, als diese versuchte, die Straße vor der Kneipe zu räumen. Das war wohl die radikalste Auseinandersetzung an diesem Pride-Wochenende in New York.


 Von Raqqa bis Bachmut
Von Raqqa bis Bachmut