Erbschaften jener Zeit
Eduard, so nannte Peter Schneider einen Biologen aus der 68er Generation, der vor ungefähr zehn Jahren durch Berlin lief und herauszufinden versuchte, was so alles zwischen Männern und Frauen seines Alters abging und möglich war. Am Ende beschloß er, in Deutschland werde die Wissenschaft behindert und die Weiber seien zickig, und wanderte aus. "Paarungen" hieß das Werk, denn die "Wahlverwandtschaften" gab es schon.
Als nun der definitive Berlin-Roman der neunziger Jahre überfällig wurde, mußte Eduard zurückkehren. Inzwischen hatte er in Stanford/USA den genetischen Ursachen menschlicher Aggression nachgeforscht, nebenbei geheiratet und drei Kinder in die Welt gesetzt. Ein Job und eine Erbschaft riefen ihn heim. Kaum hat er sich auf zweihundert Quadratmetern über den Dächern Charlottenburgs eingerichtet, läßt ihn sein Herrchen wieder ganz dumme Sätze sagen: "Sie gefallen mir, haben mir von Anfang an gefallen, und ich weiß, ich bin der Mann, von dem Sie sich gefallen lassen würden, was Ihnen selbst gefällt."
Wenn Sie oder ich den Berlin-Roman der Wendezeit schreiben wollten, kämen wohl die Ossis und die Wessis darin vor mitsamt ihren Befindlichkeiten, die Mauer und die große Baustelle am Potsdamer Platz, Hausbesetzer und Neonazis, Heiner Müller, das neue deutsche Selbstbewußtsein, Sozialismus und Kapitalismus, westliche Gewinner und östliche Verlierer, die Stasi und die Freiheit, der Palast der Republik und das Hohenzollernschloß - kurz alles, was seit Jahren in sämtlichen Feuilletons um und um gewälzt wird.
Auch das bisher dickste Schneider-Buch lebt vom unerschöpflichen Reichtum des Vereinigungs- und Hauptstadtthemas. Vieles ließ sich zwanglos in die Handlung einbauen, manches mußte durch historische Reflexion während langer S-Bahn-Fahrten herbeigezwungen werden. Bei uns allerdings gäbe es wohl keine DDR-Fahne mit Hammer und Sichel, und der letzte Bürgermeister Ost-Berlins hieße nicht Schabowski, sondern Krack. Und so etwas wäre uns auch nicht eingefallen: "Frauen betrachten sich selber mit ungleich strengeren Augen als Männer. Erbarmungslos registrieren sie die kaum sichtbaren Zeichen auf der Haut, mit denen sich das Schicksal des allmählichen Ausscheidens vom Markt der Blicke und des Begehrens ankündigt, und lassen sich durch noch so überschwengliche Komplimente nicht von ihren Beobachtungen abbringen." Solche Sätze brauchen einen gewieften Romancier mit einem "großzügigen Stipendium" des Woodrow Wilson Center Washington.
Eduard hat zwei Probleme. Er bringt die Besetzer nicht aus dem Haus, das er von seinem Großvater geerbt hat. Und seine Frau Jenny kommt und kommt nicht. Zwar ist sie schon da, kommt aber trotzdem nicht. Eduard gibt sich die Schuld und studiert die Fachliteratur. Einmal versuchen sie es im Weinhaus Huth, dem letzten Altbau am Potsdamer Platz: "Eine Sekunde lang schien sie erschrocken, als er ihr Kleid hob, doch er spürte, daß ihr seine Liebkosungen gefielen, daß ihr Körper - trotz oder wegen des lauen Windes, der durch die fünf Öffnungen des Türmchens drang - die Einfälle seiner Zunge lobte. Mit einem entschlossenen Schwung hob Jenny ihren nackten Hintern auf den schraffierten Kalkstein der Brüstung, legte sich darauf und beschrieb mit den Beinen das Victory-Zeichen."
Plötzlich aber beginnen Bauarbeiter im Parterre eine Kernbohrung (!), und es klappt wieder nicht. Zweihundert Seiten später - soviel sei hier verraten - stürzt Eduard aus einem Fenster. Jenny mißversteht den Unfall als Selbstmordversuch und ist gerührt. Von nun an ertönt im ehelichen Schlafzimmer allabendlich "ein Echo des Urknalls, der nach einer Legende der Wissenschaft der Beginn aller Schöpfung war".
Weil aber Eduard an seinen männlichen Fähigkeiten zweifelt, muß er sich irgendwann bei einer andern beweisen. Die Gelegenheit stellt sich ein, als Jenny zu den Kindern reist. Im Heizungskeller seines Instituts trifft Eduard eine geheimnisvolle Schöne. Sämtliche Kessel und Rohre vibrieren vor erotischer Spannung, und es kommt zu einem seltsam paranoiden Flirt: "Er konnte nichts daran ändern, daß seine Blicke zu ihren Brüsten wanderten, die ihn unter der Jacke wie zwei versteckte Augen ansahen." Fortan verabredet man sich zu warmem Rotwein in eben erst eröffneten italienischen Restaurants in den östlichen Randbezirken Berlins, wo die Spaghetti nicht al dente sind und die Kellner einen slawischen Akzent sprechen. Marina muß, obwohl sie es nicht zugibt, eine Ostfrau sein, denn ihre Orgasmusfreude ist ganz unbeschreiblich.
Daß sie nach Sekunden zu jubilieren beginnt und einen Urknall auf den andern folgen läßt, paßt Eduard nun auch wieder nicht: "Er fühle sich, gestand er Marina irgendwann, wie eine Bodenstation, nur dazu da, eine Rakete zu zünden, die, kaum habe sie abgehoben, unbekümmert um alle Signale von der Erde ihre eigenen Ziele im Weltraum ansteuert. Marina lachte nur, ihr gefiel der Vergleich. So war das nun mal bei ihr." Zur Katastrophe kommt es, als Eduard "sich in ihr Herz geschlichen hat". Sie will mehr, als er geben kann. Deshalb muß sie ihn verlassen.
Sein literarisches Vermögen habe zwar seit den ersten bescheidenen Etüden kaum gewonnen, rezensierte die Berliner Zeitung, immerhin aber sei Schneider endlich bereit, gewisse "Denktabus" zu brechen. Denn die Besetzer des ererbten Mietshauses in Friedrichshain denunzieren Eduard als späten Arisierungsprofiteur: Der Großvater habe das Haus einem jüdischen Fabrikanten abgepreßt. Der Enkel beweist jedoch mit Hilfe historischer Dokumente, daß sein Großvater in Wahrheit ein kleiner Oskar Schindler war, der sich als Parteigenosse tarnte, um bedrängten Juden zur Flucht aus Nazideutschland verhelfen zu können. Von diesem Hieb wird sich unsere "Kultur der Verdächtigung" wohl nicht mehr erholen.
Wie es Schneidern am Ende gelingt, nicht nur die Orgasmusschwierigkeiten seines Helden zu beheben, sondern auch Besetzer und Besitzer miteinander zu versöhnen, das sei hier um der Spannung willen nicht verraten. Wer unbedingt wissen will, daß die Besetzer ebenfalls erben und Eduard das Haus ganz einfach abkaufen, muß es halt selber nachlesen.
Peter Schneider: Eduards Heimkehr. Roman. Rowohlt Verlag, Berlin 1999. 407 Seiten, DM 45
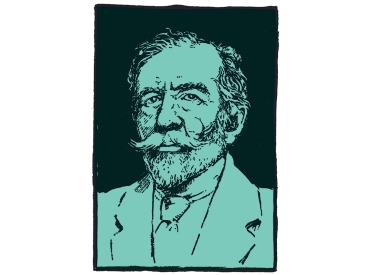


 Rock im Sahel
Rock im Sahel