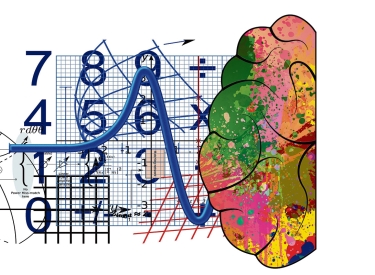Schläger und Boykott
Vieles lief bei der Cricket-WM in Südafrika wie erwartet: die Großen schlugen die Kleinen, das Wetter spielte mit, und Australien gewann, was zu gewinnen war. Doch auch diese Weltmeisterschaft hatte ihr Favoritensterben, ihre Außenseiter und ihre Überraschungen.
Die meisten Aufregungen entstanden jedoch außerhalb des Spielfeldes. Die wichtigste hatte ihren Ursprung nicht einmal in dessen Nähe.
Der Cricketweltverband ICC hatte den Außenseitern aus dem Nachbarland Simbabwe zugestanden, ihre Vorrundenspiele vor heimischem Publikum auszurichten. Die Gruppengegner wollten allerdings nicht nur aufgrund der prekären Sicherheitslage nichts mit dem simbabwischen Mugabe-Regime zu tun haben. Insbesondere protestierte die ehemalige Kolonialmacht England gegen die Ansetzung ihres Spieles in Harare. Zwar konnte ein spezielles Komitee des ICC die Sicherheitsbedenken zerstreuen, nun wurden aber politische Bedenken laut, und zwar nicht seitens des englischen Verbandes, sondern der englischen Regierung.
Premierminister Tony Blair und Entwicklungshilfeministerin Claire Short forderten die Sportler auf, das Spiel zu boykottieren, weigerten sich aber, ihnen eine eindeutige Anweisung zu geben. Schließlich könne man es niemandem verbieten, an sportlichen Veranstaltungen teilzunehmen. Die englischen Cricketer waren ob dieser halbherzigen Haltung enttäuscht und überließen die Entscheidung ihrem Verband. Der wiederum erwog das Problem lange und ausführlich und sprach sich schließlich gegen einen Boykott des Spiels aus. Es sei unangemessen, von Sportlern das zu verlangen, was von Politikern nicht geleistet werde. Immerhin stünden politische oder wirtschaftliche Sanktionen gegen Simbabwe nicht zur Debatte.
So weit, so klar. Die Bedenken der Spieler hielten jedoch an. Auch Versicherungen des ICC, niemand müsse bei irgendwelchen Willkommenszeremonien Mugabe die Hand schütteln oder auch nur neben ihm stehen, genügten den Spielern nicht. Der englische Verband intervenierte beim ICC, um eine Verlegung des Spiels zu beantragen oder doch wenigstens zu erreichen, dass das Spiel nicht ausgetragen und als unentschieden gewertet würde. Nach langem Hin und Her fällte das ICC sein Urteil. Nein, das Match könne nicht verlegt werden. Im Falle eines Boykotts würden alle vier zu vergebenden Punkte Simbabwe gutgeschrieben. Dennoch entschlossen sich die Spieler und der englische Verband zum Boykott; das Spiel fand nicht statt.
Der simbabwischen Mannschaft konnte eigentlich gar nichts Besseres passieren. Durch den englischen Boykott – und Siege über die Nobodys aus Namibia und Holland sowie ein wetterbedingtes Unentschieden gegen Pakistan – erreichten sie als Gruppendritter die Zwischenrunde. England fehlten dagegen genau die Punkte aus dem boykottierten Spiel zum Weiterkommen. Experten hatten zwar nicht ernsthaft erwartet, das Mutterland des Cricket würde gegen Australien, Indien oder Südafrika Wunder vollbringen können; aber in der Vorrunde auszuscheiden, war doch schmachvoll.
Drei Wochen vorher, am zweiten Tag des Turniers, hatte das Simbabweproblem allerdings eine zusätzliche Dimension erhalten. Vor ihrem ersten Spiel gaben zwei prominente simbabwische Spieler ein Statement ab, das ihrer Trauer über den »Tod der Demokratie in Simbabwe« Ausdruck gab. Während des Spiels trugen die beiden Autoren, Captain Andy Flower, Sohn eines weißen Farmers und einziger simbabwischer Spieler von Weltrang, und Henry Olonga, vor acht Jahren der erste Schwarze, der auf internationaler Ebene für Simbabwe spielte, schwarze Armbinden.
Die simbabwischen Cricketfunktionäre waren schockiert. Olonga wurde – aus rein sportlichen Überlegungen, wie es hieß – aus der Mannschaft genommen und von seinem Ligaclub Manicaland gefeuert. Die Absicht, auch Flower aus der Mannschaft zu nehmen, was sie im Endeffekt zu einem drittklassigen Team gemacht hätte, konnte nur durch die Drohung der restlichen Spieler vereitelt werden, dann ebenfalls nicht zu spielen.
Politische Einflussnahme, Intrigen im Verband und Meinungsverschiedenheiten im Team forderten jedoch ihren Tribut: Nach dem glücklichen Erreichen der Zwischenrunde schied Simbabwe, jetzt wieder mit Olonga, sang- und klanglos aus.
Und, was schwerer wiegt, die Zukunft des Sports in Simbabwe ist mehr als ungewiss. Andy Flower beendete seine internationale Karriere, und Henry Olonga wird aus Angst um seine persönliche Sicherheit nicht nach Simbabwe zurückkehren. Damit verliert das simbabwische Cricket zwei seiner besten und erfahrensten Spieler; die schwache Liga des Landes dürfte kaum in der Lage sein, diesen Verlust wettzumachen.
Die Aufregungen auf dem Spielfeld nahmen sich gegen diese Entwicklungen recht bescheiden aus. Zwar schied der Gastgeber und Mitfavorit Südafrika bereits in der Vorrunde aus. Und zwar unter Umständen, die eher komisch als tragisch waren: Ein Rechenfehler in der Kabine besiegelte ihr Schicksal. Auch der letztmaligen Finalist Pakistan und die Geheimfavoriten von den Westindischen Inseln nahmen einen allzu frühen Abschied.
Die größte spielerische Überraschung schafften allerdings die Kenianer, krasse Außenseiter und quasi das Mainz 05 des Cricket. Als erstes Team, desssen Verband kein Vollmitglied des ICC ist, erreichten sie die Zwischenrunde. Durch die etwas eigenwilligen Modalitäten, nach denen die Teams einen Teil der Vorrundenpunkte mitnahmen, reichte ihnen dort ein Sieg über die zerstrittenen Simbabwer zum Einzug ins Halbfinale. Erst die Cricket-Großmacht Indien machte ihren Hoffnungen dort ein Ende.
Unberührt von all dem, schlenderten die Titelverteidiger, die derzeit unschlagbar erscheinenden Australier, ihrem dritten Titel entgegen. Erfolg schafft Neider, doch zehn Siege in den zehn Spielen vor dem Finale erklären nur zum Teil, warum die Australier in der Welt des Cricket so unbeliebt sind: Sie gewinnen nicht nur alles, sie nehmen die Siege auch noch mit einer Arroganz hin, die nur hartnäckige Fans als professionelle Haltung ansehen. Nicht nur dass sie ihre Gegner gerne als mittelmäßig bezeichnen, sie sind auch bereit, für einen Sieg so gut wie alles zu opfern. So erwogen das Team und der Verband anfänglich ebenfalls einen Boykott ihres Spiels in Simbabwe, zogen sich aber schnell zurück, als klar wurde, dass sie vier Punkte verlieren würden.
Und sie gehen fast über Leichen. Wiederholt setzten sie ihren schnellsten Werfer darauf an, sich die besten gegnerischen Batsmen vorzunehmen. Ein Ball von Brett Lee mit über 150 Stundenkilometern kann einem da schon mal einen Knochen brechen. Der australische Captain Ricky Ponting über den gebrochenen Daumen seines srilankischen Kollegen: »Natürlich will man nicht, dass jemand ernsthaft verletzt wird. Aber dies ist die Weltmeisterschaft, und wir versuchen, so zu werfen, dass der Batsman keine Punkte machen kann. Wenn dies erfordert, auf den Körper zu werfen, dann werfen wir auf den Körper. Es macht nichts, wenn einer oder zwei verletzt werden, weil einfach jemand anders auftaucht und sich in das Team einfügt, als hätte er die ganze Zeit gespielt.«
Auf diese Weise wird das australische Team das Problem mit seinem schlechten Ruf nicht lösen. Und auch nicht dadurch, dass es alles gewinnt, was es zu gewinnen gibt.