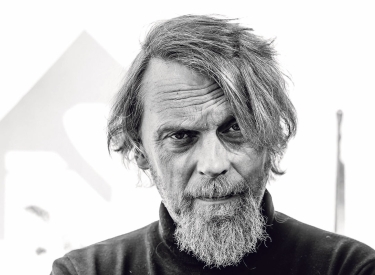Ich bin beim Film
Wer kennt das nicht: Ein beliebiger Tag in einer beliebigen Kneipe in Kreuzberg, Mitte oder Prenzlauer Berg. Man sitzt an einem Tisch und will sich in aller Ruhe auf sein Bier, seine Fanta oder seine Beziehungsprobleme konzentrieren, aber auf einmal schwappen einem die laut vorgetragenen Gesprächsfetzen vom Nachbartisch ans Ohr: »… nur so was ganz Roughes, so mit DV und so …«, »… also zumindest geiles Catering …«, »… hast du dir mal die Vorstoppzeiten angeschaut …?!«, »… und dann waren die noch nicht mal drehfertig …«, »… und das alles in der zwölften Stunde, bei minus zehn Grad …« Und spätestens an dieser Stelle möchte man aufstehen, sein Bier, seine Fanta oder seine Beziehungsprobleme packen und so lange damit auf den Nachbartisch hämmern, bis alle Beteiligten die Kneipe verlassen und versprechen, nie wieder zu kommen.
Wohin man auch geht, schaut oder hört: In Berlin sind alle beim Film, wollen zum Film, waren mal beim Film oder kennen zumindest jemanden, der es ist, will oder war. Mittlerweile wird ein Viertel aller deutschen Film- und Fernsehproduktionen in Berlin hergestellt und bei Crew-United, dem Internetportal der deutschsprachigen Filmschaffenden, kommt sogar fast ein Drittel der weit über viertausend eingetragenen Freelancer aus der Bundeshauptstadt. Rechnet man hierzu noch die Dunkelziffer der unzähligen selbst ernannten Drehbuchautoren und Regisseure, die seit Jahren in den Cafés im Prenzlauer Berg sitzen und darauf warten, dass ihre Stoffe endlich realisiert werden, bekommt man eine ungefähre Ahnung davon, wie es zustande kommen kann, dass einem auf Partys mittlerweile jeder/jede Dritte auf die Frage, was er/sie denn so mache, antwortet: »Ich bin beim Film.«
In einer Zeit, in der sich der geregelte Ausbildungsweg von der Lehre oder dem Studium in den Beruf immer mehr als Sackgasse in die Arbeitslosigkeit erweist, fungiert die Filmbranche als großes, eutrophes Sammelbecken für den ausgeleierten Traum vom aufstiegsintensiven Kapitalismus. »Der Film« (ein sehr schwammiger Begriff, der in der Arbeitswelt Fernsehen, Werbung und Musikclips mit einbezieht) verspricht immer noch die alte Philosophie von Hier-kann-es-jeder-schaffen – und wenn auch nicht direkt vom Kabelträger zum Millionär, so doch zumindest vom Runner zum ersten Aufnahmeleiter oder vom Requisitenfahrer zum Ausstattungsassistenten. Folgerichtig findet man »beim Film« vom studierten Architekten und der Deutschlehrerin über den gelernten Elektriker bis hin zum Punk alles, was die deutsche Gesellschaft an nicht mehr verwertbarem Strandgut zu bieten hat.
Was bringt Menschen überhaupt dazu, sich an Kneipentischen stundenlang mit leuchtenden Augen über Banalitäten auszutauschen, die zwischen Schlagworten wie »Dispo«, »Funkschärfe« und »Postproduktion« mäandern?! Auf der Suche nach einer Antwort muss zuerst einmal ein großes Missverständnis aus der Welt geräumt werden: In den wenigsten Bereichen hat die Arbeit beim Film etwas mit Kreativität zu tun. Ganz im Gegenteil: Die meisten Menschen, die beim Film arbeiten, sind nichts als bloße Befehlsempfänger, die möglichst zuverlässig, möglichst effizient und möglichst schnell die ihnen aufgetragenen Aufgaben abzuarbeiten haben.
Was ist dann so faszinierend am Film? Zuallererst: Beim Film zu sein, verleiht einem auf einen Schlag eine neue Identität. Gestern war man noch die schlechte Schülerin, die es in den Augen des Vaters sowieso nie zu etwas bringen wird, heute darf man als Gardrobiere eigenhändig weithin bekannten Schauspielern und Schauspielerinnen ihre Kostüme anziehen, während sie einem leutselig von ihren Neurosen erzählen. Gestern war man noch der arbeitslose Kfz-Mechaniker, heute hat man als Bühnen-Assistent plötzlich die Hoheit über einen ganzen Lkw und darf mitten auf einer dafür eigens gesperrten Hauptverkehrsstraße eine Dolly-Schiene aufbauen.
Ist man beim Film, hat man aber auch von einem auf den anderen Tag eine feste, hierarchische Struktur, die es jedem ermöglicht, sich sofort zurechtzufinden. Die einzelnen »Departments« beim Film haben nämlich nicht nur eine ganz klare Vorstellung davon, wer wem wann wo und wie gegenüber weisungsbefugt ist, sondern sind in sich organisiert wie kleine paramilitärische Einheiten. Die Unterteilung einer »Lichtcrew« in Oberbeleuchter, Best Boy, Beleuchter, Beleuchterhilfe und Praktikant erinnert in ihrem Aufbau an eine Mischung aus einer Pfadfindergruppe und einem Redneck-Kommando, dessen Mitglieder täglich von ihrem General, dem Kameramann, mit neuen und scheinbar unlösbaren Missionen beauftragt werden. Die paramilitärische Dynamik der Dreharbeiten verleiht den Beteiligten dabei das Gefühl von kameradschaftlicher Geborgenheit und verfestigt immer wieder von neuem ihre Abgrenzung als geschlossene Gruppe nach außen hin. Auf diese Weise erfährt das mittlerweile schon geflügelte Wort vom »Film als Krieg« immer wieder neue Bestätigung.
Genau wie im Krieg gibt es auch »beim Film« kein Vorher, kein Nachher, kein Nebenher mehr. Man ist hier und jetzt als Söldner an der Front, und ob man vorher Kinder unterrichtet, Bilder gemalt, Taxis gefahren oder Menschen verarztet hat, interessiert niemanden mehr. Auf einmal befindet man sich in einer großen Leidensgemeinschaft, die sich in sektiererischer Egozentrik nur noch um sich selber dreht. Und genauso, wie sich Stalingradveteranen nur sehr ungern von anderen in ihre Fronterlebnisse hineinreden lassen, beharrt man auch beim Film auf der alten Soldatenmaxime: Wer nicht dabei war, soll sich bloß nicht einbilden, dass er was zu sagen hat.
Ähnlich wie das Militär fungiert auch der Film in kriegslosen Zeiten zugleich als wärmende Decke für seine Eingeweihten: Ab sofort ist man, selbst wenn man gerade keinen Job hat, nicht etwa arbeitslos wie in der normalen Welt da draußen, sondern man ist selbstverständlich nach wie vor »beim Film«. Einmal Film heißt eben immer Film und nach dem Film ist vor dem Film. Mit diesem trügerischen Gefühl hangeln sich unzählige Menschen jahrelang von Projekt zu Projekt, bis sie eines morgens mit Mitte vierzig völlig ausgebrannt aufwachen und sich überlegen, wie es denn sein kann, dass sie die letzten fünfzehn Jahre ihres Lebens damit verbracht haben, gelbe Fahrräder, Autos aus den fünfziger Jahren und Biedermeiermöbel für irgendwelche profilneurotischen Regisseure zu organisieren, die am Ende entweder nicht im Bild gewesen sind oder aus dem fertigen Film wieder herausgeschnitten wurden. Aber zu diesem Zeitpunkt ist es eigentlich schon zu spät. Denn wer nach zehn, fünfzehn, zwanzig Jahren »beim Film« einfach von heute auf morgen aussteigen will, verliert nicht nur auf einen Schlag alle seine Freunde und Beziehungen, sondern hat auch auf dem normalen Arbeitsmarkt so gut wie keine Chance mehr.
Die völlige Abgegrenztheit des Films von anderen gesellschaftlichen Lebensbereichen spiegelt sich nicht zuletzt auch in den tariflichen Gegebenheiten wider. Während die Gewerkschaften in Deutschland zurzeit allerorts verzweifelt um den Erhalt ihres Einflusses kämpfen, haben sie »beim Film« nichts zu verlieren, weil sie nie etwas hatten. Im Vergleich zu England oder Amerika, wo die Gewerkschaften im Filmbereich nach wie vor eine Macht darstellen, spielen sie in Deutschland überhaupt keine Rolle. Gerade in den Zeiten der allgemeinen deutschen Film- und Fernsehkrise bewegt man sich »beim Film« immer öfter auf tariflichem Brachland. Nur selten wird in der Branche noch wirklich Tarif bezahlt, von Überstunden ganz zu schweigen. Gerade bei den unzähligen ambitionierten Low-Budget-Produktionen, von denen in Berlin und in Brandenburg so viele wie nirgendwo sonst in Deutschland realisiert werden, arbeiten die meisten Beteiligten zu absoluten Dumpinglöhnen. Die unterste Stufe in diesem Ausbeutungssystem bilden all jene, die überglücklich sind, als Praktikanten einen Fuß in die verheißungsvolle Filmtür bekommen zu haben. Nicht selten werden sie gleich freiwilligen Rekruten für gerade mal fünfzig oder hundert Euro in der Woche als Vollzeitarbeitskräfte eingeplant und mit Arbeitszeiten von täglich bis zu 18 Stunden innerhalb von sechs Wochen an der Filmfront verheizt. Doch trotz harter Arbeitsbedingungen und schlechter Bezahlung hält die Begeisterung für »den Film« nicht nur unvermindert an, sondern wird sogar immer größer.
Täglich werden die Büros der gut hundert in Berlin ansässigen Filmproduktionsfirmen mit Praktikantengesuchen überschwemmt. Fast alle sind dazu bereit, monatelang ohne Gage Büroarbeiten zu verrichten, Telefondienste zu erledigen und am Set Kaffee zu kochen. Parallel weitet sich die seit zwei Jahren herrschende allgemeine Krise immer stärker aus, worüber auch die Erfolge einiger weniger deutscher Filme wie »Goodbye Lenin« oder »Das Wunder von Bern« im In- und Ausland nicht hinwegtäuschen können. Die Zeichen stehen auf Sturm. Im Jahr 2003 kam es in den deutschen Kinos zu einem Zuschauerrückgang von 9,7 Prozent, die Kirchkrise wütet unvermindert weiter und neben der Pleite von vielen kleinen Berliner Produktionsfirmen im letzten Jahr mussten in den vergangenen Monaten auch große Firmen wie Ottfilm und die Senator Entertainment AG Insolvenz anmelden.
Wenn die negative Tendenz weiter anhält, kann man davon ausgehen, dass in Berlin bald nur noch die Hälfte der arbeitssuchenden Freelancer ein dauerhaftes Auskommen findet und sich der Rest der Filmschaffenden auf lange Sicht in das große Heer der Arbeitslosen einreihen muss. Wahrscheinlich werden dadurch in den nächsten Jahren zwar etliche Träume zerplatzen, aber immerhin wird damit auch die Hoffnung genährt, dass es bald wieder möglich ist, sich in den Berliner Kneipen in Ruhe auf sein Bier, seine Fanta oder seine Beziehungsprobleme zu konzentrieren.

 Zwischen Tatsache und Fiktion
Zwischen Tatsache und Fiktion