»Zuerst bin ich Antifaschist«
Die Wahlen in den USA waren ein Debakel für die Republikaner und die Regierung Bush. Welche Rolle hat der Irak-Krieg dabei gespielt?
Der Irak-Krieg spielte sicherlich eine bedeutende Rolle, wenn nicht sogar die wichtigste. Die Wahlen zeigen die enorme Unzufriedenheit der Amerikaner mit den bisherigen Ereignissen und der Entwicklung, die der Krieg im Irak genommen hat. Auch der Umstand, dass es keine befriedigende Lösung zu geben scheint, dürfte seinen Teil zu dieser Unzufriedenheit beigetragen haben. Somit waren die Wahlergebnisse eine sehr deutliche Zurechtweisung für die Bush-Administration hinsichtlich ihrer Irak-Politik.
Können sich die Gegner des Irak-Kriegs von 2003 angesichts der gegenwärtigen Lage im Irak im Nachhinein bestätigt fühlen?
Viele Kriegsgegner werden jetzt sicherlich sagen: »Hab’ ich doch gleich gesagt.« Aber während der Debatte um den Irak-Krieg wurden sehr verschiedene Argumente gegen den Krieg vorgebracht, manche waren sehr intelligent, andere falsch und grob vereinfachend. Ich tendiere dazu, in meinen Problemanalysen besonders auf die möglichen Konsequenzen der zu treffenden Entscheidung bedacht zu sein. Beim Irak-Krieg waren die Konsequenzen, wie wir sehen, nicht sonderlich gut. Die intelligenteren Argumente, die gegen den Krieg vorgebracht worden sind, also jene, die sich mit den möglichen Folgen beschäftigten, mussten daher für jeden Kriegsbefürworter wie mich schwer wiegen. Aber es gab auch viele äußerst dumme Argumente, Argumente, die ihre Wurzeln ausschließlich in linken Klischees hatten. In einem solchen Fall konnte uns jemand, nur weil er aus der Linken kam, nicht dabei helfen, die Situation richtig einzuschätzen. Auch heute helfen diese Leute nicht dabei, die politische Lage zu erfassen. Momentan ist es das Wichtigste, eine Möglichkeit zu finden, die ein besseres Leben für die Iraker bringt, eine Situation, in der weder Iraker noch die USA und ihre Verbündeten täglich Blut lassen.
Sie haben den Irak-Krieg 2003 unterstützt. Was waren damals Ihre Gründe?
Ich war ein »linker Falke« hinsichtlich des Irak. Diese Position habe ich aus verschiedenen Gründen eingenommen. Einige dieser Gründe haben sich mittlerweile als falsch herausgestellt. Ein Punkt waren die Massenvernichtungswaffen. Als jemand, der die Entwicklung im Mittleren Osten sehr aufmerksam verfolgt, war ich ziemlich überzeugt von der Gefahr. Genauso wie übrigens fast alle westlichen Geheimdienste glaubte ich, dass die Waffen existieren. Das hat sich offensichtlich als falsch erwiesen.
Die Fehler der Geheimdienste sollten uns allerdings aus verschiedenen Gründen beunruhigen. Nicht nur im Irak haben die westlichen Geheimdienste die Situation falsch eingeschätzt, aus anderen Gründen auch im Iran, in Nordkorea und in Pakistan. Seitdem es eine veränderte Libyen-Politik gibt, haben wir eine Reihe neuer Erkenntnisse, die verdeutlichen, dass ein umfangreiches Untergrund-Netzwerk besteht, das mit nuklearem Material handelt. Wenn Sie also die Fehler der Geheimdienste nicht nur im engen Kontext des Krieges, sondern auch im Hinblick auf die weiteren Zusammenhänge bedenken, dann müssen wir uns Sorgen machen. Da gibt es auf der einen Seite einen geradezu Furcht einflößenden Handel mit gefährlichsten Materialien und Waffen, gleichzeitig auf der anderen Seite ein massives geheimdienstliches Versagen.
Also, die Waffen waren ein wichtiger Punkt. Der Horror des Saddam-Regimes war ein anderer. Der politisch motivierte Mord an rund 300 000 Menschen scheint für mich ein ausreichender Grund, warum Menschen, insbesondere aus der Linken, zutiefst gegen dieses Regime hätten sein sollen. Außerdem bin ich der Überzeugung, dass es sich um ein Regime handelte, welches recht passend als eine Form des Faschismus charakterisiert werden kann, auch wenn ich nicht denke, dass dies alle seine Aspekte beschreibt. Und ich werde immer zuerst Antifaschist und dann erst Kriegsgegner sein.
Denken Sie heute, dass Sie damals falsch gelegen haben mit Ihrer Position zum Irak-Krieg, die, wie Sie sagten, ja vor allem auf den zu erwartenden Folgen beruhte?
Zuallererst muss ich sagen: Ich glaube nicht, das das Problem mit den Massenvernichtungswaffen durch Inspektionen hätte gelöst werden können. Wir wissen jetzt, dass Saddam alle Welt glauben machen wollte, er hätte die Waffen. In der Tat dachte sogar ein großer oder zumindest bedeutender Teil seines Militärs, dass es diese Waffen gab. Vielleicht könnte man sagen: Es handelte sich um nicht existente Waffen, von einem Regime versteckt, welches dich glauben macht, dass es sie besitzt.
Ich habe damals allerdings nicht behauptet, was eine Minderheitsmeinung war, dass das Resultat des Kriegs eine Demokratie im Irak sein würde. Aber ich habe angenommen, dass es ein akzeptables Ergebnis geben könne, bei dem die Iraker nicht mehr unter derartiger Brutalität wie unter Saddam zu leiden hätten. Meine politischen Erwartungen waren also eher bescheiden. Die Konsequenzen des Kriegs sind nicht sehr gut, und es gibt viele Gründe, warum es so gekommen ist. Ich schätze, es hätte vor allem besser gemacht werden müssen: mit intelligenter Planung, dem richtigen Einsatz von Ressourcen und andauernden Anstrengungen, es zu einem multilateralen Projekt anstatt einer reinen US-Unternehmung zu machen.
Wie soll es nun weitergehen im Irak? Haben die Demokraten überhaupt eine Alternative anzubieten?
Die Demokraten fokussierten richtigerweise sehr genau auf die Fehler der Bush-Administration im Irak. Sie haben einige Experten zum Irak, die jedoch unterschiedliche Meinungen vertreten. Auf der einen Seite gibt es die Position des Kongressabgeordneten Jack Murtha aus Pennsylvania, der argumentiert, dass es nichts mehr zu retten gebe und die Truppen sofort abgezogen werden sollten. Wobei jedoch eine schnelle Eingreiftruppe in der Region verbleiben sollte. Mit dieser Ansicht ist er der Position der Kongressabgeordneten Nancy Pelosi sehr nahe, die die Sprecherin des Kongresses werden wird.
Eine etwas andere Position wurde von Senator Joseph Biden eingenommen. Dieser hat einen Plan vorgestellt, welcher in Richtung eines extrem föderalisierten Irak führen würde. Bei diesem Plan wäre die Zentralregierung nur noch für die Grenzsicherung und die Erdöleinnahmen verantwortlich. Ansonsten wäre das Land aus drei sehr autonomen Regionen zusammengesetzt. Dabei würde den Sunniten 20 Prozent der Erdöleinnahmen zugesichert, um sie mit ins Boot zu holen. Außerdem hat Senator Biden eine Regionalkonferenz vorgeschlagen, um in ihrem Rahmen eine Art von Nichtangriffspakt zu etablieren, welcher die äußere und innere Sicherheit des Irak gewährleisten würde. Durch die Regionalkonferenz sollen außerdem maßgebliche regionale Hilfen für den Irak in Gang gebracht werden.
Dies ist wohl einer der intelligenteren Pläne für den Irak, und ich bin recht angetan von ihm. Die Baker/Hamilton-Kommission, die von Präsident Bush berufen wurde, wird vermutlich nicht in Richtung eines so starken Föderalismus tendieren. Ich gehe davon aus, dass viel davon abhängen wird, welche Vorschläge von dieser Kommission kommen.
Droht als Ergebnis einer so starken föderalen Lösung, wie Sie sie gerade beschrieben haben, nicht die Entstehung eines ba’athistischen Sunniten- und eines schiitischen Mullah-Staats?
Die Ausgangsbedingungen sind keine guten, eher schlechte. Ich glaube nicht, dass man einfach zwischen verschiedenen Lösungen, die man gerne haben möchte, auswählen kann. Tatsächlich haben die Iraker bei den letzten Wahlen mit überwältigender Mehrheit für religiöse Repräsentanten gestimmt. Die einzige Alternative, die sich jetzt stellt, ist: kompletter Zerfall oder aber ein Föderalismus, wie Biden ihn vorschlägt.
Das klingt eher resignativ.
Es ist wahr, dass das Ergebnis, von einer Position der westlichen Linken aus betrachtet, wahrscheinlich nicht sehr ansprechend sein wird. Es scheint mir unwahrscheinlich, dass es eine Form von sozial gerechter Demokratie für den Irak sein wird. Aber man muss die Entscheidungen auf der Grundlage der Realität treffen. Eine angemessene Regierung für den Irak kann derzeit nur eine Regierung sein, die der Bevölkerung Sicherheit bietet. Das ist vermutlich der einzig begehbare Weg: eine Form des Föderalismus, wie ihn Biden vorgeschlagen hat, im Gegensatz zum kompletten Zerfall. Das sind die beiden Möglichkeiten, die es gibt, die eine ist vermutlich um einiges schlechter als die andere. Aber beide sind nicht besonders gut.
Welche Rolle spielt der Israel-Palästina-Konflikt? Viele sagen, zuallererst müsse dieser Konflikt gelöst werden. Sehen Sie da einen Zusammenhang?
Ich denke, der Israel-Palästina-Konflikt verdient es, unabhängig davon behandelt zu werden. Es ist ein Jahrzehnte währender Konflikt, der enorme Leiden verursacht hat, und deshalb sollte er gelöst werden. Die Annahme, dass er der Schlüssel zu allen Konflikten der Region ist, ist sowohl historisch als auch politisch falsch. Tatsächlich haben wir dasselbe Argument schon vor dem Irak-Krieg gehört: Wenn nur der Israel-Palästina-Konflikt gelöst würde, dann gäbe es auch kein Problem im Irak. Aber Saddam hat nicht wegen der Situation in Palästina 300 000 Iraker getötet. Ich denke, dass es enorm wichtig ist, die Konflikte der Region eindeutig zu bestimmen und als solche eigenständig zu behandeln.
Die entscheidende Frage zwischen Israelis und den Palästinensern scheint mir derzeit zu sein, wie die Voraussetzungen dafür geschaffen werden können, dass beide Seiten, sowohl die israelische als auch die palästinensische Führung, einen Sinn darin sehen, der anderen Seite ein Angebot zu unterbreiten.
Wird das US-Engagement im Nahen Osten nach dem Erstarken der Demokraten eher zunehmen oder zurückgehen?
Die amerikanische Außenpolitik bleibt ja vor allem in den Händen des Präsidenten. Die Funktionsweise des politischen Systems der USA beinhaltet zwar eine Form der Kräfteverschiebung zwischen Legislative und Regierung, sie findet allerdings vor allem bei innenpolitischen Fragen statt. Manchmal können wir dies zu einem gewissen Teil aber auch in der Außenpolitik beobachten. So war beispielsweise in den fünfziger und sechziger Jahren der Präsident sehr dominant, durch den Vietnamkrieg gewann der Kongress dann aber an Einfluss. Dies sollte jedoch nicht überschätzt werden, in der Außenpolitik bleibt im Wesentlichen die Exekutive, der Präsident, die tonangebende Figur.
Ich gehe jedoch davon aus, dass wir eine Form von Geste oder Initiative sehen werden, mit der versucht wird, die arabisch-israelische Dimension des Irak-Problems anzusprechen. Denn ich denke, die Israelis sind besorgt darüber, dass im Rahmen einer allgemeinen Diskussion darüber, wie die USA aus dem Irak herauskommen, womöglich ihre eigenen Sicherheitsinteressen geopfert werden. Das ist in der Tat eine offene Frage.
Dabei darf man auch das Problem mit dem Iran nicht vergessen, dessen Regierung offen Israel mit einem Völkermord droht. Und der Westen zeigt sich schon unfähig, mit dem stattfindenden Genozid in Darfur umzugehen. Zur gleichen Zeit spricht die Arabische Liga davon, das palästinensische Problem lösen zu wollen – aber zu Darfur sagt sie kein Wort. Nehmen wir noch die Frage nach der Hizbollah und ihrer Zukunft im Libanon hinzu, dann erzeugt das, wie Sie sehen, eine sehr komplexe Situation, für die es keine eindimensionale Antworten gibt.
Sie haben sich selbst als »linken Falken« charakterisiert…
… hinsichtlich des Irak-Kriegs, für gewöhnlich bin ich eher von taubenhaftem Charakter!
Welches Gewicht haben Debatten, wie Sie sie im Dissent führen, in der amerikanischen Linken?
Ich denke, es gibt eine lebhafte Präsenz von Leuten, die ähnlich denken wie ich, aber wir sind eine Minderheit. Ich bin sogar die Minderheit in meinem eigenen Magazin. Also sogar bei meinen politischen Mitstreitern war meine Position zum Irak eine Minderheitenposition.
Sie haben das Euston-Manifesto unterschrieben. Meinen Sie, dass es notwendig und möglich ist, ein internationales Netzwerk für eine neue Linke jenseits von Antiimperialismus und Antisemitismus aufzubauen?
Ich denke, eine Neuorientierung der Linken ist seit ziemlich langer Zeit überfällig. Das Euston-Manifesto, an dessen Entstehung ich nicht beteiligt war – ich habe lediglich die britische Version unterzeichnet –, war eine nützliche Präsentation von Argumenten und Ideen. Ich glaube, die Linke ist sehr häufig in alten Kategorien verfangen. Wir müssen eine Form des sozialen Egalitarismus sowie eine demokratische politische Perspektive aufrechterhalten, sozusagen als regulative Idee, um eine Formulierung von Kant zu benutzen. Wir müssen aber über die existierenden Probleme in neuen und frischen Kategorien nachdenken. Die Welt verändert sich, und wie es aussieht, wird sie mehr und mehr zu einem sehr gefährlichen Ort. Solche Denkweisen, wie die, jedes Problem auf die Frage Totalitarismus und Antitotalitarismus oder auch Imperialismus und Antiimperialismus zu reduzieren, werden uns nicht sehr
*
Übersetzung: Benjamin Engbrocks
Mitchell Cohen schreibt seit 1982 für das US-Magazin Dissent. Seit 1991 ist er neben Michael Walzer Mitherausgeber. Er gehört zum Editorial Board der wissenschaftlichen Zeitschrift Jewish Social Studies.


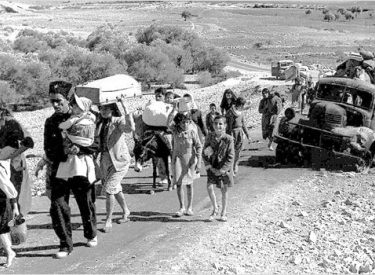

 »Hier geht die Panik um«
»Hier geht die Panik um«