Recyceln wie ein Profi
In amerikanischen Großstädten hört man sie jede Nacht. Meistens kommen sie in den frühen Morgenstunden, zwischen vier und fünf. Sie durchwühlen die Müllcontainer und nehmen alle Glas- und Plastikflaschen mit, die sie nur finden können. Die meisten von ihnen haben Einkaufswagen, in denen sie die Pfandflaschen mit viel Geschepper abtransportieren. Spätestens dann ist es mit der Nachtruhe vorbei. Die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner scheinen die Leute, die nachts die Mülltonnen durchsuchen, als eine normale Begleiterscheinung der modernen Welt hinzunehmen. Aber wer sind sie eigentlich, diese »Müllpiraten«? Warum tun sie das? Und warum sind es so viele? Erstaunlicherweise werden all diese Fragen nur selten gestellt. In US-amerikanischen Medien wird so gut wie nichts über diese Menschen geschrieben. Jeder sieht sie, jeder hört sie, aber scheinbar nimmt sie niemand zur Kenntnis. Dabei hat sich ihr »Geschäft« zu einer informellen Ökonomie entwickelt und es lohnt sich, einen genaueren Blick darauf zu werfen, denn die Leute, die den Müll durchwühlen, verraten viel über die amerikanische Gesellschaft.
Eine der wenigen, die sich mit diesem Phänomen befasst, ist Bevin Ashenmiller, eine Professorin für Wirtschaftswissenschaften am renommierten Occidental College in Los Angeles, wo übrigens auch Barack Obama ein paar Semester lang studierte. Ashenmiller hat mehrere Studien und Untersuchungen zu dem Thema verfasst – bislang die einzigen. Die Müllsammler nennt sie »Profi-Recycler« und bezeichnet sie als ein immer größer werdendes Segment der amerikanischen Gesellschaft, welches sich den Lebensunterhalt zumindest zum Teil durch das Sammeln und Weiterverkaufen von Pfandflaschen und Aluminiumdosen verdient.
»Profi-Recycler sind Leute, die etwas recyclen, was sie nicht gekauft haben«, sagt Ashenmiller. Wer seine eigenen Flaschen recycelt, trage nicht zur Umverteilung von Einkommen bei, »aber wer die Flaschen anderer Leute recycelt, der wird Teil eines ganz anderen Wirtschaftskreislaufs«. Im Juli 2009 verteilte sie einen Fragebogen an Hunderte von Leuten in einem Recycling-Center, so entstand ein Gesamtbild: »Viele Profi-Recycler machen es wie Zeitarbeit, ein paar Flaschen hier und da, zusätzlich zum eigentlichen Job, der oftmals nicht genug abwirft«, schildert die Professorin.
Die ersten Pfandgesetze traten in den USA 1973 in Kraft, seitdem wird in elf Bundesstaaten recycelt. Man kann die Altflaschen jedoch nicht im Supermarkt abgeben, sondern nur in einem Recycling-Center. In Kalifornien wird pro Flasche bezahlt, ab 50 Flaschen geht es dann nach Gewicht. Das Recycling hat in den Vereinigten Staaten wenig oder gar nichts mit Umweltbewusstsein zu tun. Viel dringlicher sind die eigenen Probleme, insbesondere die finanziellen. Und doch hat Recycling auch in Amerika eine gewisse Tradition, wenn auch eine ganz andere als in Europa. Anfang des 20. Jahrhunderts kamen immer mehr europäische Einwanderer nach Amerika, ein großer Teil von ihnen waren Juden, die vorwiegend aus Polen und Russland flüchteten und in den USA eine neue Heimat suchten. Die Straßen in Amerika, so hieß es damals, seien mit Gold gepflastert. Die Wirklichkeit sah ganz anders aus: Statt Gold lag eher Dreck auf den Straßen der amerikanischen Städte. Schon damals verdienten sich viele Migranten ihren Lebensunterhalt dadurch, dass sie Altmetall sammelten und weiterverkauften. Daraus entstanden mit der Zeit die ersten amerikanischen Recycling-Konzerne. Noch in den neunziger Jahren waren nach Schätzungen der jüdischen Tageszeitung Forward 90 Prozent aller Recycling-Firmen in den USA Familienbetriebe, die von den Nachkommen eben jener Einwanderer geleitet wurden. Nach und nach geht diese Tradition jedoch verloren, die Enkel und Urenkel verkaufen die Firmen. Auch die Demographie der Profi-Recycler ist ständigem Wandel unterworfen. »Es sind immer die jüngsten Einwanderer, die diesen Job machen«, konstatiert etwa Ashenmiller, »das liegt daran, dass sie die Sprache nicht richtig können und keine anderen Verdienstmöglichkeiten haben.«
In Südkalifornien sind es hauptsächlich Migranten aus Mexiko oder anderen lateinamerikanischen Ländern, die sich der Tätigkeit widmen. In den großen Recycling-Centern der Stadt wird so gut wie kein Englisch gesprochen.
Für kleine Flaschen kriegt man in solchen Anlagen immerhin fünf Cent pro Stück gezahlt, für Flaschen über einen Liter bis zu zehn Cent. Die Los Angeles Times berichtete im Jahr 2001 von einem mexikanischen Ehepaar, das mit dem Verkauf von Pfandflaschen ihrer Tochter die Studiengebühren finanziert habe. Das war aber vor mehr als zehn Jahren. Heute sieht die Realität anders aus: Um ein Studienjahr an einer staatlichen Universität in Kalifornien finanzieren zu können, müsste man heute nicht weniger als eine Viertelmillion Pfandflaschen sammeln und verkaufen – immerhin fast 5 000 Kilogramm Plastik.
Verkauft werden die gesammelten Flaschen an private Recycling-Firmen. Die Recycling-Center verkaufen die Flaschen dann an die Stadtverwaltung weiter, dann werden sie von gigantischen Müllwagen in sogenannte MRFs gebracht. Das Kürzel steht für Materials Recovery Facility, es handelt sich um Anlagen, in denen die Ladungen aussortiert und weiter verwertet werden. Die »sauberen« MRFs nehmen nur Lieferungen entgegen, die bereits vorsortiert wurden, während die »schmutzigen« MRFs die sprichwörtliche Drecksarbeit – das Aussortieren anderer Abfälle, selbst verrichten.
Die Stadt Los Angeles verarbeitet jährlich fast eine Million Tonnen an recyclebarem Material. Die »Recycling-Rate«, also der Prozentsatz des Gesamtmülls, der aussortiert und weiter verarbeitet wird, lag im Jahr 2011 laut Angaben der Stadtverwaltung bei immerhin 63 Prozent. Der Großteil dieser Materialien kommt von eben jenen örtlichen Recycling-Centern, und diese konkurrieren stark miteinander. Die Profi-Recycler sind stets auf der Suche nach den besten Preisen für ihren »Fang«.
»Es ist genau wie Fischfang«, sagt Ashenmiller. Wie viel man damit verdient, hänge davon ab, wie viele Leute die Stadt auf der Suche nach Dosen und Flaschen durchkämmen: »Je mehr Leute es sind, desto weniger Verdienstmöglichkeiten hat man. Seit einigen Jahren sind immer mehr Leute in dieses ›Geschäft‹ eingestiegen«. Das ist nicht verwunderlich angesichts der Verarmung erheblicher Teile der US-amerikanischen middle class in Folge der Wirtschaftskrise. Das Geld, das für die Pfandflaschen bezahlt wird, kommt von den Abfüllerfirmen.
Die Kunden müssen die Flaschen selbst in ein Recycling-Center bringen, um das Pfand wiederzubekommen, doch das ist vielen Konsumenten zu mühsam. Gerade die Besserverdienenden tun das nicht, und in diese Marktnische drängen die Profi-Recycler. Lange Jahre waren es vorwiegend Obdachlose, die sich auf diese Art ein paar Dollar dazuverdienten, aber das ändert sich. »Die Obdachlosen erkennt man sofort, sie stechen hervor«, sagt Ashenmiller, »aber sie machen mittlerweile nur einen geringen Teil der Profi-Recycler aus.« Seit Beginn der Wirtschaftskrise sehe man in vielen Städten immer mehr Familien, Kinder und Senioren, die den Müll durchsuchen. Dumpster diving nennt man das auch, »Mülltauchen«.
Janet Williamson ist 65 Jahre alt und von Beruf Musikagentin. Sie wohnt in Los Feliz, einer Gegend, die nicht nur unter den Mülltauchern sehr bekannt ist, denn hier wohnen einige Hollywood-Stars, wie Natalie Portman und Angelina Jolie. An Müll von Prominenten heranzukommen ist allerdings so gut wie unmöglich, denn viele Hausbesitzer in dieser Gegend greifen seit einigen Jahren auf abschließbare Mülltonnen zurück. Aus ihrer Sicht durchaus verständlich, denn für die Anwohnerinnen und Anwohner solcher Luxusanlagen ist der Lärm der scheppernden Flaschen eine Zumutung. So lassen Prominente und Wohlhabende hier ihren Müll streng bewachen.
Die meisten Profi-Recycler haben ihre festen Zeiten und ihr festes Revier. Sie kennen ihre Gebiete und die Anwohner kennen ihrerseits die für ihre Gegend »zuständigen« Recycler. Die gewinnträchtigen Gebiete sind mitunter hart umkämpft, und es kommt mittlerweile sogar vor, dass einer der Profi-Recycler die Polizei ruft, wenn ein anderer in sein Revier eindringt. »Heute sind es ständig verschiedene Leute, die in dieser Gegend den Müll durchkämmen«, sagt Williamson. »Jahrelang kamen immer die Üblichen, aber in letzter Zeit, seit es mit der Wirtschaft bergab geht, sieht man immer mehr ganze Familien. Einige sind sehr nett, andere verhalten sich dagegen sehr aggressiv.« Williamson erzählt von einem Seniorenehepaar mit Kampfhund, das nachts mit einem Pickup-Truck im Schritttempo durch die Straßen fährt und die Ladefläche mit Flaschen voll lädt: »Der Ehemann durchsucht die Mülltonnen, seine Frau sitzt am Steuer. Wer Ärger macht, den knurrt der Pitbull an. Probleme gibt es allerdings selten.«
Ashenmillers empirische Studie zeigt, dass in Gemeinden, in denen Pfandgesetze eingeführt worden sind, die Kriminalitätsrate durchschnittlich um elf Prozent niedriger ist als in Gemeinden, die solche Gesetze nicht haben. Das Mülltauchen ist ein weitgehend friedliches Geschäft. »Es sind die Zeiten, die immer härter werden«, sagt Williamson, »die Leute, die ein wenig Geld dazu verdienen wollen, werden immer mehr. Sie müssen irgendwie ihre Familien ernähren.«
In den USA ist das soziale Netz bei weitem nicht so sicher wie in Deutschland. Die Profi-Recycler seien oft »ältere Menschen, die nicht mehr arbeiten können, aber ihrer Familie helfen wollen«, beschreibt Ashenmiller. Altersarmut ist allerdings nur einer der Gründe, die immer mehr Menschen dazu bringen, in den Müll zu tauchen.
Im Recycling-Center am Hollywood Boulevard stehen schon am frühen Morgen die Leute mit ihren Flaschen Schlange. Sie bringen Säcke voll Plastik. Der 56jährige Herman Carrillo und sein jüngerer Kollege Fernando Garcia leiten die Anlage. Bis zu 500 Dollar pro Tag verteilen sie an die Dutzende von Menschen, die mit ihren Flaschen kommen. Die Flaschen werden in riesigen Plastiktüten verpackt und gewogen. »Es ist ein Knochenjob«, sagt Carrillo, »es kommen immer mehr Menschen, viele sind arbeitslos, aber sie müssen trotzdem ihre Rechnungen bezahlen. Wir sehen hier Leute aus allen Gesellschaftsschichten.« Er deutet auf ein nahe gelegenes Krankenhaus und erklärt, dass selbst die dort beschäftigten Krankenschwestern in der Mittagspause die Mülleimer durchstöbern, um so ihr nicht allzu üppiges Gehalt aufzustocken. »Neulich sah ich sogar einen Typen im Anzug, dessen Aktentasche voll mit leeren Flaschen war. Das zeigt einem doch, wie schlimm die Lage ist.«
Die meisten ihrer Kunden sprechen nur Spanisch, und viele weigern sich, interviewt zu werden. Eine ältere Dame mit einem Einkaufswagen voller Plastik winkt ab: »No abla inglés« sagt sie, und entfernt sich. Paul, 57, gehört zu den wenigen Menschen hier, die bereitwillig Auskunft geben. Seinen Nachnamen will er dennoch nicht verraten. Der Mann mit den vergilbten Zähnen und dem wettergegerbten Gesicht stellt sich als Kriegsveteran vor. Er hinkt, und erzählt, dass in seinem rechten Knie Metallfragmente stecken, »von einem Arbeitsunfall in Südamerika«, wie er erklärt. »Ich brauche das Geld«, sagt er lakonisch, »ich kriege nur Invalidenrente«.
Doch die reicht offensichtlich nicht. »Ich kann meine Lebensmittel nicht mehr bezahlen«, sagt er. Mit Recycling verdiene er sich ein paar Dollar am Tag zusätzlich. Früher, vor ein paar Jahren, habe er sogar bis zu 60 Dollar pro Tag zusammengekriegt. »Aber jetzt ist die Konkurrenz größer geworden. Ich kann von Glück reden, wenn ich jetzt 30 zusammenkriege.« Paul ist keine Ausnahme. Ashenmillers Studie zeigt, dass viele Veteranen und Invaliden auf diese informelle Ökonomie angewiesen sind, um ihr eigenes Überleben und das ihrer Familien zu sichern.
»Recycling ist eine gute Sache«, sagt Carrillo. »Aber es ist nicht die Lösung. Es wirkt wie eine Schmerztablette, wenn man krank ist. Die Krankheit bleibt, bloß, man spürt den Schmerz nicht. Es ist traurig. In diesem Land denkt man nie an die Armen. Das Geld wird für Kriege ausgegeben«, lautet seine Analyse.
Aber für die Ärmsten in der Gesellschaft ist die »Schmerztablette« durchaus willkommen. Nur wenige der Kunden im Recycling-Center interessieren sich für die Umwelt. Carrillo schätzt die Zahl der Umweltbewussten auf unter zwei Prozent. Auch Ashenmiller gibt ihm Recht: »Die Anzahl von Leuten, die aus ökologischen Gründen recyceln, ist verschwindend gering. Es ist eben leicht verdientes Geld. Man braucht für diesen Job keine Qualifikationen und keine Ausrüstung. Und die leeren Flaschen gehören zum Gemeingut, wie die Fische im Meer.« Obwohl eher aus finanziellen Gründen praktiziert, sei diese Form der Armutsverwaltung für die Umwelt trotzdem etwas Gutes, findet die Professorin: »Immerhin, die Leute recyceln!«
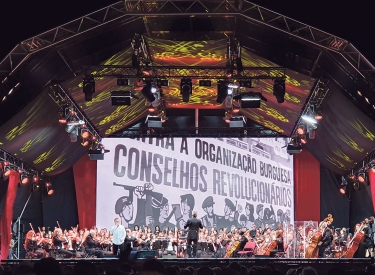
 Im Namen der Nelke
Im Namen der Nelke

