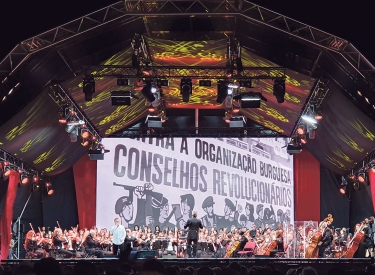Hotel Cinq Etoiles
»Wenn du zuhörst, wirst du verstehen, die meisten hören aber nicht zu«, sagt Khaled Fosseny* mit einem freundlichen Lächeln, seine Zähne blitzen hell auf. Er sitzt mit René Nourah* und Tsenko Kolarov vor einem kleinen Laden beim Flüchtlingsheim Ovcha Kupel in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Lugaru Cissé kommt mit einigen Bechern Kaffee heraus und gibt jedem einen. Nach einer Weile macht René Nourah einen Vorschlag: »Komm, ich will dir zeigen, wo ich wohne.« Die vier Männer stehen auf und gehen um den Block herum, dann durch das Gestrüpp, über eine fußballfeldgroße Wiese, links von Schlingpflanzen überwucherte Bäume, rechts ein grauer Betonblock. Er scheint im Rohbau steckengeblieben zu sein, wirkt wie aus einem apokalyptischen Computerspiel. René Nourah deutet auf die Bauruine, die statt Fenstern klaffende Öffnungen hat. »Das ist das Hotel Cinq Etoiles«, lacht er, »wir nennen es so, da es an der Elfenbeinküste einzigartig ist. So wie dieses hier.« Wir gehen einige Betonstufen hinauf, in den dunklen Schlund hinein, geradeaus zieht sich ein Flur, durch den man auf den Berg Witoscha sehen kann. Ein Hund verschwindet ängstlich in einem der Räume ohne Türen und Fenster. René Nourah sagt, der Hund höre auf den Namen Black. Früher habe man ihm das häufiger nachgerufen, als sich im Bus keiner neben ihn setzen wollte. Heute sei es etwas besser geworden. Im Flüchtlingslager seien die Schwarzen dennoch ganz unten in der Hierarchie. Er lebt seit fünf Monaten hier im »Hotel Cinq Etoiles«, gemeinsam mit 30 weiteren Geflüchteten, die wie er weder ein Bett im Flüchtlingslager bekämen, noch sich eine der überteuerten Wohnungen leisten könnten.
Deren Preise steigen um das Doppelte bis Dreifache, sobald die Vermieter mitbekommen, wer die zukünftigen Mieter seien, bestätigt Maria Shestakova von der NGO »Refugee Project«. Sie hat bereits mehrfach versucht, Menschen mit einem humanitären Flüchtlingsstatus in private Unterkünfte zu vermitteln, doch jedes Mal veränderte sich der Preis oder die Vermieter sprangen im letzten Moment ab.
Khaled Fosseny berichtet mit ruhiger Stimme, wie er im Dezember 2013 beschloss, aus der Türkei nach Bulgarien zu gehen und Asyl zu beantragen, obwohl ihm sein türkischer Chef sehr davon abriet. Für diesen hatte er einige Monate in Istanbul Taschen und Knöpfe in einer Fabrik hergestellt. Dort hatte er damals keine Aussicht auf Asyl. Die Türkei ist zwar Unterzeichnerin der Genfer Flüchtlingskonvention, schränkt diese jedoch auf europäische Bürger ein. Geflüchtete aus anderen Staaten unterliegen dem sogenannten geographischen Vorbehalt – auch noch nach der Einführung eines neuen Gesetzes im April 2013. Möglicherweise behält sich die türkische Regierung damit ein Druckmittel gegenüber der Europäischen Union vor. Lediglich eine temporäre Aufenthaltsgenehmigung hätte Khaled Fosseny bekommen können.
Wir laufen in dem grauen Block umher, in jedem Zimmer stapelt sich Kleidung in den Ecken. Über eine offene Treppe gelangt man in den ersten Stock. Vom Flur gehen zwanzig Räume ab, der dritte links ist René Nourahs Schlafplatz. Man geht direkt auf eine vier Meter breite Öffnung zu, ein frostiger Gebirgswind pfeift um die Ohren. An einer Seite sieht man Rußspuren eines Feuers. Früher hatte René Nourah auch einen Platz im Flüchtlingslager. Er war im Februar 2013 von der Elfenbeinküste nach Bulgarien gekommen. Nach seiner Ankunft sei er zunächst von der Polizei aufgegriffen und in ein Gefängnis gebracht worden. Für die meisten Geflüchteten ist es die erste Station in Europa. Einen legalen Weg, um in einem Land Asyl zu beantragen, gibt es schlichtweg nicht.
Viele berichten über eine herabwürdigende und willkürliche Behandlung durch Grenzbeamte und Polizei. Man habe sie tagelang in einen Käfig gesperrt, dann in winzige Zellen mit anderen Insassen. Es gebe kein Fenster, aber permanentes Licht, die Toilette dürfe man nur zweimal am Tag benutzen, bei offener Tür. Den Schlägen und Übergriffen der Polizisten seien sie schutzlos ausgesetzt gewesen, bis die Befragungen die gewünschten Aussagen ergaben. Der Ton innerhalb der Flüchtlingsagentur SAR ist rau bis rassistisch. Zuletzt bekam der Chef der SAR, Nikolai Tschirpanliew, für sein Interview im kanadischen Fernsehen die Quittung. Er sagte über kurdische Geflüchtete aus Syrien: »Sie sind das größte Problem, da sie Analphabeten sind. Sie wollen nichts lernen, sie sind schlimmer als unsere Roma, sie leben in Erdlöchern. Die Kultur und Tradition der Araber lügt.« Zum Jahreswechsel musste er seinen Posten räumen. Das war wohl zu viel, spiegelt aber die Alltagsverhältnisse im Lager wider. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Meglena Kuneva gab an, sie wolle die Atmosphäre der Flüchtlingsagentur ändern. Sie scheint es zur Chefsache zu machen. Noch besteht das SAR-Personal vollständig aus ehemaligen Soldaten.
Nourah verbrachte nach dem Gefängnis einige Tage im Detention-Center Ljubimez, einem geschlossenen Lager. Andere, wie der Iraner Omid Djalili, wurden in das Detention-Center Busmantzi geschickt. Als das Wort fällt, schütteln Lugaru Cissé* und Khaled Fosseny den Kopf und blicken zu Boden. Auch dort gebe es regelmäßig gewalttätiges Verhalten, Essen und warme Kleidung reichten nicht aus. Nach den Erfahrungen im Gefängnis, in Ljubimez, im Transit-Center Pastrogor, wo seine Fingerabdrücke in die Eurodac-Datei aufgenommen wurden, und im Übergangslager Harmanli, wollte René Nourah Bulgarien nur noch verlassen. Deutschland, Belgien oder Frankreich würde er ansteuern, Länder, von denen er glaubt, dass man ihn als Schwarzen dort wie einen Menschen behandeln würde.
Doch auf dem Weg von Serbien über die Grenze nach Ungarn wurde er von der Polizei aufgegriffen. Nach einigen Tagen im serbischen Gefängnis wurde er zurück nach Bulgarien deportiert. Seinen Platz im Flüchtlingslager habe er dann nicht mehr erhalten, daher lebt er nun im »Hotel Cinq Etoiles« oder bei Freunden. Tsenko Kolarov ist einer der neuen Freunde, der den Geflüchteten mit Papieren und Anträgen in kyrillischer Schrift hilft. Er berichtet, dass die Behörden Menschen sogar willkürlich in die Türkei abschöben, trotz laufendem Antrag, manchmal trotz positiver Asylbescheide. »Man will so offenbar Exempel statuieren, um anderen Einreisewilligen den Mut zu nehmen«, vermutet Tsenko Kolarov.
René Nourah blickt von seinem Schlafplatz durch die große Wandöffnung auf die Randbezirke, über die sich abends der Dunst legt.
Das Witoscha-Gebirge südlich von Sofia färbt sich rosa. Er finde es eigentlich ganz schön in Bulgarien, sagt Khaled Fosseny, und würde gerne ein normales Leben führen, arbeiten, sich etwas aufbauen. Dafür könne er sich auch vorstellen, hier zu bleiben. Eine Zeitlang hatte er einen Job bei einer Baufirma. Er half den Vier-Löwen-Platz im Herzen Sofias zu rekonstruieren und umzubauen. Stolz zeigt er ein Handyfoto, auf dem er Arm in Arm mit einem bulgarischen Kollegen zu sehen ist. 20 Leva habe er dafür bekommen, umgerechnet zehn Euro. Da Geflüchtete, wie in Deutschland, nicht oder nur unter sehr strengen Vorgaben arbeiten dürfen, ging sein Arbeitgeber ein erhebliches rechtliches Risiko ein. Nun hat Khaled wenig zu tun, außer zu warten in Ovcha Kupel, dem ältesten der Flüchtlingslager in Sofia. Innen wellt sich der Putz in vielen Räumen von den feuchten Wänden, die Flure sind mit braunen Eisentüren verschlossen, an manchen muss man anklopfen, damit ein Wärter kommt und aufschließt. Trotz der Renovierung der Flüchtlingsheime in Sofia im vergangenen Jahr, die 6,8 Millionen Euro gekostet hat, und zum Großteil aus EU-Geldern bezahlt wurde, bestehen die Veränderungen meist nur aus einem neuen Farbanstrich an der Außenwand. Ovcha Kupel ist derzeit nur zu drei Vierteln belegt. Das mag auch am Bau des 30 Kilometer langen Zauns an der türkischen Grenze liegen, der vergangenen Juli fertiggestellt wurde. Sein Bau, die unterirdischen Sensoren, Wärmebildkameras und die Videoüberwachung kosteten 20,5 Millionen Euro. Laut SAR belief sich die Zahl der Grenzübertritte auf 10 000 im vergangenen Jahr, zwei Drittel der Menschen kamen aus Syrien. Doch ab Herbst sei die Zahl um das Siebenfache gesunken, rühmt sich nun die bulgarische Regierung. Aber die Berichte von illegalen Push-Back-Aktionen häufen sich. Zuletzt ist eine Gruppe von über 100 irakischen Yeziden in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember in die Türkei zurückgedrängt worden. Dieser gewaltsame Umgang mit Hilfesuchenden und die systematische Abriegelung werfen ein Schlaglicht auf die Politik Bulgariens und dessen Rolle als militärischer Vorposten der europäischen Flüchtlingspolitik. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Meglena Kuneva verkündete am 30. Dezember, dass man entschieden habe, den Zaun um weitere 131 Kilometer zu erweitern. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNCHR) beklagt, dass gefährlichere Fluchtrouten damit billigend in Kauf genommen würden.
Der Umgang mit Geflüchteten wird sich noch verschärfen, denn Bulgarien scheint sich mit dieser Politik der harten Hand auf europäischer Ebene profilieren zu wollen. Nur in einem Punkt war die bulgarische Flüchtlingsagentur bisher nicht einverstanden: den Dublin-Verfahren. Im vergangenen Jahr sollten von Deutschland 4 495 Menschen nach Bulgarien zurückgesandt werden. 7 851 Anfragen von mehr als 20 Staaten gibt es europaweit, 6 873 Menschen sollten wieder in das südöstliche Grenzland gebracht werden. Bisher wurden aber die meisten Rücksendeanträge nach Dublin III in Deutschland rechtlich angefochten, durch überzogene Fristen oder Kirchenasyl ausgehebelt, so dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge BAMF im Jahr 2014 nur sechs Menschen im deutschen Asylverfahren nach Bulgarien zurückschickte. Wenn es nach der bulgarischen Flüchtlingsagentur ginge, würden die Flüchtlinge in Europa gerechter verteilt, vergleichbar dem in Deutschland geltenden »Königsteiner Schlüssel«.
Für die Organisation Pro Asyl geht das aber noch am Kern des eigentlichen Problems vorbei. Sie verabschiedete vergangenes Jahr ein Memorandum, in dem sie sich für die freie Wahl des Asyllandes einsetzte. Die Dublin-Verfahren nehmen keine Rücksicht auf die Flüchtlinge, kritisiert Marei Pelzer von Pro Asyl. Sie würden sich meist für das Land entscheiden, wo sie familiäre oder freundschaftliche Anbindung hätten und damit auch unabhängig Unterstützung erhielten und Einbindung fänden.
Wir gehen durch den frostigen Flur des »Hotel Cinq Etoiles«, steigen die Treppen wieder hinab. Khaled Fosseny sagt nachdenklich, er habe viel erlebt, Frieden und Leiden gesehen und sei nun erwachsen geworden. Doch das Nichtstun nage an ihm. Seit dem Wintereinbruch mit Temperaturen von unter minus zehn Grad nimmt Khaled Fosseny abends seinen Freund René oft heimlich mit ins Flüchtlingslager, wenn die Aufseher am Eingang nicht mehr so genau kontrollieren. Dann kann er die Nacht in der Wärme des acht Quadratmeter großen Zimmers verbringen, das sich sechs Leute teilen. Bald wird die Situation in den Lagern wohl noch angespannter: Die bulgarische Regierung erklärte sich kürzlich bereit, 3 613 Geflüchtete aus anderen EU-Ländern nach dem Dublin-Verfahren wieder aufzunehmen. Wo diese unterkommen werden, bleibt fraglich, da in den Lagern nur noch Platz für 2 000 Asylbewerber ist und im Frühjahr ein Zuzug von Geflüchteten aus Afghanistan erwartet wird. Da wird sich zeigen, was passiert, wenn, wie bei René Noura, die Aufnahme in ein Flüchtlingslager abgelehnt wird oder nach der Vergabe eines Flüchtlingsstatus nicht mehr verpflichtend ist und damit auch die Sozialhilfe von 32 Euro monatlich entfällt. Wenn sich nichts ändert, werden sich in Zukunft wahrscheinlich sehr viel mehr geflüchtete Menschen auf den Straßen Bulgariens wiederfinden.
* Name von der Redaktion geändert.


 Von Raqqa bis Bachmut
Von Raqqa bis Bachmut