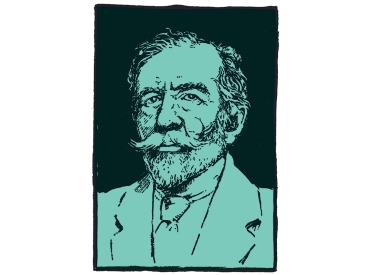Aus dem Wortschatz unserer Kämpfe
Wofür Martin Walser den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekam, vermochte selbst sein Laudator Frank Schirrmacher nicht zu sagen. Warum er ihn bekam, ist sonnenklar.
Alle anderen Preise hat er schon: den Hesse-, den Schiller-, den Büchner-, den Hauptmann- und den Huch-Preis, die Heine- und die Zuckmayer-Medaille, den Großen Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, die Ehrendoktorwürde der Universitäten Konstanz, Hildesheim und Dresden, das Große Bundesverdienstkreuz und den "Pour le mérite". ("Unbestechlich" nannte Walsern die Frankfurter Oberbürgermeisterin, und an seiner Unbestechlichkeit ist nicht zu zweifeln; allerdings wird sie doch, da sie derart honoriert wurde, nicht sonderlich schwer gefallen sein.)
Weil offenbar kein Jahr vergehen darf, ohne daß Walser einen Preis bekäme, der Nationalpreis, den er sich redlich verdient hat und der gewiß nicht lange ausbleiben wird, heuer schon an Biermann vergeben war und niemand einen Martin-Walser-Preis für besondere Verdienste um Martin Walser stiften mochte, blieb nur der Friedenspreis.
Schirrmacher verzichtete darauf, dem Preisträger besondere Verdienste um denWeltfrieden und die Völkerverständigung anzudichten. Diesmal reichte schon Walsers beträchtliches Verdienst um die Verständigung der Deutschen über und mit sich selbst. Daß die Deutschen ein ganz normales Volk unter anderen Völkern seien, müsse dem Terror der "Meinungssoldaten" zum Trotz endlich gesagt werden dürfen, sagte Walser in seiner Dankesrede nicht zum ersten Mal. Die Versammelten nickten beifällig. Und von Walsers Bekenntnis, er könne, obwohl man Auschwitz nie vergessen dürfe, die Bilder aus den Konzentrationslagern nicht ertragen, er müsse wegschauen, wenn das Fernsehen sie wieder und wieder zeige, werden sie nur so viel verstanden haben: Von Auschwitz ist inzwischen abzusehen.
Walser mißtraut allen Meinungen und verläßt sich lieber auf sein "Geschichtsgefühl". Eine Meinung tauge nur dazu, eine Gegenmeinung zu provozieren. Wenn er geschwiegen hätte, sinnierte er einst, wären seine Gegner wohl angeln gegangen oder ins Kino; da er nicht an sich halten konnte, formulierten sie ihren Widerspruch.
Walsers Gefühl erwachte 1978, als er tief in deutscher Geschichte den Landsmann Schlageter traf, der im Baltikum gekämpft und an der Ruhr die französische Besatzungsmacht sabotiert hatte, deshalb hingerichtet und deshalb von den Nazis zum nationalen Helden ernannt worden war. Ihn vor den Nazis und für Deutschland zu retten, verbündete Walser sich mit Heidegger.
Dieser nämlich "sagt, Schlageter sei 'den schwersten und größten Tod gestorben'. Weil wehrlos und allein. Er fragt, woher Schlageter die 'Härte des Willens' und die 'Klarheit des Herzens' gehabt habe, für dieses Schwerste und dieses Größte. Er führt die Willenshärte auf das Urgestein der Schwarzwaldberge, den Granit, zurück. Die 'Klarheit des Herzens' werde von der 'Herbstsonne des Schwarzwaldes' genährt. Außerdem wird nur noch gesagt: 'Er mußte ins Baltikum, er mußte nach Oberschlesien, er mußte an die Ruhr.' (Ö) Ich gestehe, daß ich finde, so könne man über Schlageter reden." Denn "warum soll man die Sozialgeschichte nicht auch durch Daten der Naturgeschichte ausdrücken. Komisch ist dieses Heidegger-Vokabular nur, wenn man es für metaphorisch hält."
Wir müßten Schlageter, "schon um des historischen Anstandes willen", den Nazis streitig machen und ihn nicht länger hart wie Kruppstahl nennen, sondern hart wie Schwarzwaldgranit. Denn er war kein Nazi, sondern katholisch. Von diesem Gefühl war es nicht weit bis zur Meinung, Hitler sei eine Ausgeburt des Versailler Diktats gewesen und die Wehrmacht unschuldig an Auschwitz. Walser brauchte trotzdem fast zwanzig Jahre.
Während der Historikerstreit ihn erfreut hatte, weil man fortan ganz öffentlich und nicht mehr nur im "Samisdat" eine abweichende Meinung zur deutschen Geschichte äußern durfte, die Noltesche nämlich, stimmte ihn die Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung unfroh: "Ich habe die Ausstellung nicht gesehen. 'Verbrechen in der deutschen Wehrmacht', also, daß man den ganzen Verein so generell kriminalisiert, ich weiß nicht (...) 'Die Wehrmacht': Das geht mir total gegen den Strich. Es gibt einen Satz, den ich damals zum Historikerstreit gehört habe, der mir auch nicht einleuchtet. Da wurde die Wehrmacht angegriffen, weil durch ihren Einsatz der Betrieb von Auschwitz weiterhin möglich geworden sei. Verstehen Sie, diesen Zusammenhang herzustellen. Die Soldaten, die sich haben erschießen lassen, die haben doch gar nicht gewußt, daß es Auschwitz gibt, die haben doch nicht das Gefühl gehabt, daß sie Auschwitz verteidigen sollen. Deshalb darf man nicht nachträglich sagen: Die haben Auschwitz ermöglicht!"
Ein Kritiker, wehrte Walser sich in seiner Dankesrede, habe ihn neulich beschuldigt, Auschwitz komme in seinen Büchern nicht vor. Der Mann habe ja wohl überhaupt keine Ahnung von den Gesetzen des Erzählens. Das ist gelogen. Nicht Auschwitz hat Reich-Ranicki vermißt, sein Geschichtsgefühl kränkte nur der Umstand, daß in Walsers neuestem Roman über eine Kindheit im Dritten Reich keine Nazis vorkommen.


 Nazis am Nil
Nazis am Nil