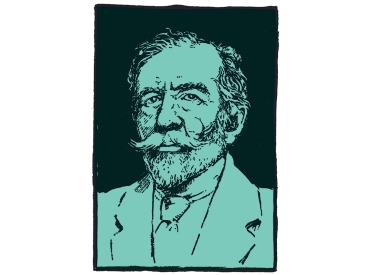Knocking on Busfahrers Tür
Gestern in der Nacht ist Rabin gestorben. Eine Vespa mit Beiwagen hat ihn überfahren. Der Fahrer der Vespa wurde schwer verletzt und verlor das Bewusstsein, und eine Ambulanz kam und brachte ihn ins Krankenhaus. Rabin rührten sie nicht einmal an, so mausetot war er, absolut nichts mehr zu machen. Also nahmen ich und Tiran ihn mit und begruben ihn bei mir im Hof.« So beginnt die Erzählung »Rabin ist tot« von Etgar Keret.
Natürlich geht es nicht um den israelischen Ministerpräsidenten, der 1995 ermordet wurde. Rabin heißt eine Katze. Zwei Jungen finden sie auf einem Platz, sie friert, sucht Schutz, und weil die beiden Yitzhak Rabin mochten, geben sie der Katze seinen Namen. Und der Vespafahrer wird nicht, wie man annehmen könnte, bei dem Zusammenprall mit der Katze verletzt, sondern bei der anschließenden Schlägerei. Denn wer in Israel seine Katze Rabin nennt oder derartige Erzählungen veröffentlicht, bekommt schnell Ärger.
Kritiker werfen Keret vor, mit der Erinnerung an zentrale Ereignisse der jüdischen und israelischen Geschichte zu spielen, um zu provozieren. Etwa wenn er über einen Jungen schreibt, der von seiner Mutter Adidas-Turnschuhe bekommt und sich nicht traut, damit herumzulaufen, aus Angst, seinem toten Großvater wehzutun, weil man ihm in einer Holocaust-Gedenkstätte erzählt hat, dass in Deutschland alles aus den Überresten der dort ermordeten Juden hergestellt werde.
Etgar Keret gehört zu den Nachkommen jüdischer Einwanderer, er wurde 1967 geboren, lehrt Drehbuchschreiben und arbeitet als Comic-Zeichner und Regisseur. Für einen seiner Filme, »Skin Deep«, erhielt er mehrere internationale Auszeichnungen und den israelischen Oscar. Berühmt gemacht haben ihn aber seine Kurzgeschichten und Kolumnen. Die Sammelbände »Missing Kissinger« und »Pipeline« sind in Israel Bestseller und liegen nun auch auf Deutsch vor: »Gaza Blues« (Erzählungen, 1996), »Pizzeria Kamikaze« (Roman, 2000) und »Der Busfahrer, der Gott sein wollte« (Erzählungen, 2001), in dem auch »Rabin ist tot« enthalten ist.
An Keret und seinen Geschichten scheiden sich die Geister, die älteren Israelis sehen in ihm das enfant terrible der Literatur und die jüngeren, die den Holocaust aus dem Unterricht, den Medien oder den Erzählungen der Eltern kennen und nicht permanent daran erinnert werden möchten, verehren Keret als Sprecher ihrer Generation.
Der Autor aus Tel Aviv fühlt sich von beiden Seiten missverstanden und erklärt in Interviews, dass er sich keineswegs von der eigenen Geschichte distanziert, sondern im Gegenteil eine Erstarrung und Automatisierung der Vergangenheitsbewältigung verhindern und eine neue Art der »Vertrautheit mit der Erinnerung« herstellen wolle.
Seine kurzen, komischen und vertrackten Erzählungen rühren am Selbstverständnis der israelischen Gesellschaft, an ihren Ritualen und Konventionen, und zeigen durch den oft hintergründigen schwarzen Humor das tiefe Misstrauen des Autors gegenüber jeder ideologischen Vereinnahmung. In »Die Sirene« klauen ein paar ansonsten musterhafte Schüler dem Hausmeister, einem Holocaust-Überlebenden, das Fahrrad. Als ein Schüler - der Ich-Erzähler - die Jungs verpetzt, drohen sie ihm Prügel an. Die Musterschüler haben ihn schon eingekreist und ihre Hemdsärmel hochgekrempelt, da ertönt eine Sirene und plötzlich stehen die Diebe starr wie Wachsfiguren und rühren sich nicht vom Fleck. Dem Erzähler fällt ein, dass heute der Tag der Gefallenen ist, er nutzt die Situation sowie den Konformismus seiner Klassenkameraden und macht sich auf den Heimweg.
Kerets Helden sind Slacker, Arbeitslose, Studenten, Selbstmörder und Langschläfer. Sie alle sind frei von den Identitätsproblemen der Eltern, sie glauben nicht mehr an große allumfassende Parteiprogramme, und ahnen, dass die von beiden Seiten oft verwendete Floskel vom »gerechten Frieden« zwischen Palästinensern und Israelis ein Versprechen ist, das niemals eingelöst werden kann. Sie leben im Nahen Osten, wo der Krieg zum Alltag gehört, wo Glauben und Geschichte unüberwindbare Grenzen schaffen, und gleichzeitig wachsen sie in einer globalisierten Welt auf, mit McDonald's, Coca-Cola und den Simpsons.
Kerets Geschichten spielen in der Gegenwart, die Personen sind leicht angeschlagen, verbringen ihre Tage in der Gewissheit, dass »nichts wirklich was ändern« würde, und sind viel zu sehr damit beschäftigt, eine Freundin zu finden, pünktlich zur Verabredung zu erscheinen und die anstehenden Aufnahmeprüfungen zu bestehen, als dass sie sich politisch engagieren oder um Traditionen kümmern würden.
Nicht der große Entwurf steht bei Keret im Vordergrund, keine ausführlichen Beschreibungen der Herkunft und der Ziele seiner Protagonisten, keine Sentimentalität, kein Pathos, statt dessen: Lakonie, Poesie und Witz. Oft gelingt es Keret schon im ersten Satz, die Dramatik aufzuheben und den Grundriss für eine doppelbödige Situation zu schaffen: »Hans und ich hatten nichts gemeinsam, außer der Tatsache, dass wir beide an Gehirnkrebs litten.« Oder: »Das ist die Geschichte von einem Busfahrer, der nie bereit war, die Autobustür für Leute zu öffnen, die sich verspäteten.« Kaum eine der fast fünfzig Erzählungen in »Der Busfahrer, der Gott sein wollte« ist länger als ein paar Seiten.
Es sind kurze Prosastücke, Miniaturen, wie man sie hierzulande vielleicht von Wladimir Kaminer kennt, alltägliche Begebenheiten, geraffte Schicksale, rasant und originell erzählt, überraschend, absurd, manchmal auch verstörend und traurig, und nie langweilig.
Etgar Keret: Der Busfahrer, der Gott sein wollte. Luchterhand, München 2001, 220 S., DM 34



 Nazis am Nil
Nazis am Nil