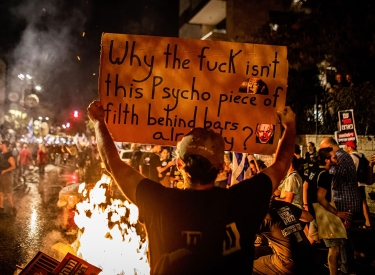Rücktritt mit Kalkül
Mehrere hundert Menschen versammelten sich am Dienstag der vergangenen Woche vor dem Sitz der niederländischen Regierung in Den Haag. Die Neugierigen trieb die Frage um, ob die Regierung zurücktreten werde. Am Nachmittag wurden die Gerüchte bestätigt. Der sozialdemokratische Ministerpräsident Wim Kok und mit ihm die Regierungskoalition aus der sozialdemokratischen Partij van de Arbeid (PvdA), der rechtsliberalen Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) und den linksliberalen Democraten '66 (D'66) traten zurück, um, wie es Kok ausdrückte, »die politische Mitverantwortung der Niederlande am Massaker im bosnischen Srebrenica 1995 sichtbar zu machen«.
Auslöser für den Rücktritt war die Präsentation des Abschlussberichtes des Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Niederländisches Institut für Kriegsdokumentation, Niod) am 10. April. Das Institut untersuchte seit November 1996 im Auftrag der Regierung Kok das Vorgehen der niederländischen Uno-Schutztruppe in Srebrenica. Im Juli 1995 war die Stadt von bosnisch-serbischen Soldaten eingenommen worden. Unter den Augen des niederländischen Militärs sollen rund 7400 Menschen ermordet worden sein. In dem Bericht des Niod wird der niederländischen Regierung eine Teilschuld gegeben. Die Soldaten seien auf eine unklare Mission in eine ungenau definierte Schutzzone geschickt worden, »um den Frieden zu wahren, wo keiner war«, heißt es dort.
Eigentlich hatte die niederländische Regierung nur eine Parlamentsdebatte über diesen Bericht geplant, aber am 13. April gerieten der Umweltminister Frank Pronk (PvdA) und Wim Kok derart aneinander, das sich die Debatte zu einer Regierungskrise ausweitete. Pronk meinte, das Parlament hätte 1995 eingreifen müssen, um das Massaker zu verhindern. Kok entgegnete, dass es Pronk war, der damals in einer Sitzung des Ministerrates erklärte, ein Massaker in Srebrenica sei nicht zu erwarten. Er warf Pronk vor, er wolle sich nur mit der »Weisheit des Rückblicks« profilieren. Am 15. April geriet Kok unter Zugzwang, als Pronk und der Verteidigungsminister Frank de Grave (VVD) ihren Rücktritt ankündigten. Die Eigenmächtigkeit der beiden Politiker erschwerte eine Lösung der Regierungskrise und beschleunigte das Ende der Koalition.
Den Rücktritt der Regierung nahmen die Parlamentsparteien überwiegend zustimmend zur Kenntnis. Der Vorsitzende der VVD, Hans Dijkstal, erklärte der Volkskrant: »Der Niod-Bericht kam nicht zum Ergebnis, dass Kok persönlich versagt hat. Hätte er sachlich und nüchtern reagiert, hätte er nicht abtreten müssen. Aber Kok macht sich offenbar selbst dafür verantwortlich.«
Größere politische Auswirkungen dürfte der Rücktritt allerdings nicht haben, denn am 15. Mai wird sowieso ein neues Parlament gewählt. Kok hatte bereits im August 2001 seinen Abschied als Ministerpräsident und Parteivorsitzender der PvdA angekündigt. Das Staatsoberhaupt, Königin Beatrix, bat die Regierung aber, bis zur Neuwahl die Amtsgeschäfte kommissarisch weiterzuführen.
Mit dem Rücktritt kommt die Regierung vermutlich ihrer eigenen Abwahl im Mai zuvor. Der paarse koalitie (lila Koalition), die seit 1994 regiert, wird in Meinungsumfragen eine Niederlage vorhergesagt. Die Bevölkerung kritisiert die Regierung vor allem wegen ihres Vorgehens nach den Brandkatastrophen in Enschede, wo im Mai 2000 eine Munitionsfabrik explodierte, und in Volendam im Januar 2001. In beiden Fällen konnte die Justiz lokalen Behörden unzureichende Kontrolle von Brandschutzbestimmungen nachweisen, ohne dass die Regierung daraus Konsequenzen gezogen hätte.
Viele Niederländer sind auch unzufrieden mit der momentanen Gesundheits- und Verkehrspolitik. Es gibt zu wenig Ärzte in den Niederlanden, der Ballungsraum Amsterdam-Den Haag-Rotterdam erstickt im Autoverkehr, und das privatisierte Eisenbahnunternehmen »Nederlandse Spoorwegen« hat zu wenig Personal und Fahrzeuge, um die den reibungslosen Ablauf des öffentlichen Nahverkehrs zu garantieren.
Aber auch innerhalb der Koalition gab es Konflikte. Mehrere Male drohten koalitionsinterne Streitigkeiten, das Bündnis vorzeitig zu beenden. Dass nun die Vorgänge in Srebrenica zum Rücktritt geführt haben, ist jedoch bemerkenswert. Noch nie ist eine Regierung wegen eines Kriegsverbrechens zurückgetreten, wenn sie weder am Verbrechen noch am Krieg beteiligt war.
Mit dem sicheren Ende vor Augen, ist es der Koalition allerdings leicht gefallen, zurückzutreten. Dieser Schritt erschwert es der Opposition zudem, aus dem Abschlussbericht der Niod politisches Kapital zu schlagen. Und Angst vor Stimmenverlusten bei der Wahl Mitte Mai haben sowohl die Regierungskoalition als auch die Opposition.
Denn zwei neue politische Parteien bemühen sich um die Gunst der Wähler: Leefbaar Nederland (lebenswerte Niederlande) und Lijst (Liste) Fortuyn. Vor allem die Lijst Fortuyn, eine Abspaltung von Leefbaar Nederland, versucht mit rechtspopulistischen Äußerungen, Wechsel- und Protestwähler für sich zu gewinnen. Der Spitzenkandidat und Namensgeber Pim Fortuyn formulierte Mitte März das Wahlprogramm seiner Partei. »Bürokratie zurückdrängen«, »Computer in den Schulen abschaffen«, »Wehrpflicht wieder einführen« sind die Schlagworte des Programms, das den Titel »Die Trümmerhaufen aus acht Jahren lila Koalition« trägt.
Den Schwerpunkt seines Wahlkampfes hat Fortuyn auf das Thema Einwanderung gelegt. Seit zwei Jahren beherrscht es die öffentliche Diskussion. Ausgangspunkt war ein Artikel im NRC Handelsblad, in dem die These aufgestellt wurde, die multikulturelle Gesellschaft sei gescheitert. Neuerdings werden in der Gesellschaft die mangelnde Integration von Migranten und die gestiegene Kriminalität in einen kausalen zusammenhang gebracht. Fortuyn versuchte mit markigen Sprüchen wie »16 Millionen Niederländer sind genug, das Boot ist voll« politischer Nutznießer dieser Debatte zu werden.
Seit den Anschlägen in den USA gilt Fortuyns besonderes Interesse den muslimischen Migranten. Er fordert unter anderem ein Einreiseverbot für Muslime. Anfang Februar nannte er den Islam eine »rückständige Kultur«. Bei den Kommunalwahlen im März war er mit seinen rechtspopulistischen Äußerungen bereits erfolgreich. In mehreren Städten, unter anderem in Rotterdam, stellt seine Partei die Bürgermeister.
Mit dem Ende der lila Koalition haben die ehemaligen Koalitionäre nun die Möglichkeit, gegeneinander Wahlkampf zu führen und sich politisch zu profilieren, um eine Machtübernahme Fortuyns zu verhindern. Die VVD kündigte bereits an, sich als Mitglied einer neuen Regierung für ein schärferes Einwanderungsgesetz einzusetzen, und der Vorsitzende des Christlich Demokratischen Appells (CDA), Jan Peter Balkenende, erklärte in der Volkskrant: »Ich bin dagegen, dass keine Asylsuchenden mehr in die Niederlande kommen. Aber in unseren Einbürgerungskursen wird zu wenig Kenntnis von unserer Gesellschaft, Kulturgeschichte und von unserem Rechtsstaat verlangt. Das muss sich ändern.«