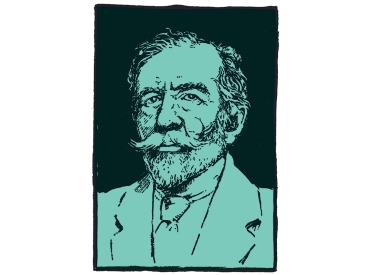Jüdische Friedhöfe zu Abstellplätzen!
Die Stimmung war aggressiv im Saal des Roten Rathauses in Berlin. Ehemalige DDR-Kader waren vertreten, vor allem bei den Äußerungen Wolf Biermanns brannte die Luft. »Aufhören!« hörte man halblaut aus verschiedenen Ecken. Grund für das Zusammentreffen am Mittwoch der vergangenen Woche war eine Podiumsdiskussion zur Eröffnung einer Ausstellung über Antisemitismus in der DDR. »Das hat es bei uns nicht gegeben!« lautet der treffsicher gewählte Titel. Ein Teil des Publikums schien hinter vorgehaltener Hand ebenfalls dieser These zuzuneigen, auch wenn Kritiker öffentlich vor allem die »Einseitigkeit« der Ausstellung ansprachen. Möglicherweise hinderte die Kamera des RBB trotz aller provokanten Äußerungen Biermanns viele daran, sich als kritikresistente DDR-Anhänger zu outen.
Begleitet von Mitarbeitern der Amadeu-Antonio-Stiftung und unterstützt von einem wissenschaftlichen Beirat und der Historikerin Bettina Leder, forschten 76 Jugendliche in acht ostdeutschen Städten drei Jahre zum Thema Antisemitismus in der DDR. Sie recherchierten in Stadtarchiven und Archiven der Stasi-Unterlagenbehörden, suchten in Zeitungen der DDR und führten zahlreiche Interviews mit Zeitzeugen und NS-Opfern. Entstanden ist eine sehr sehenswerte Ausstellung über einen tabuisierten Bereich der DDR-Gesellschaft. Man hatte den Klassenkampf per Staatsgründung abgeschafft und die vielen kleinen Nebenwidersprüche wie Rassismus und Antisemitismus gleich dazu. Aber natürlich habe es in der DDR ähnlich wie in Westdeutschland antisemitische Einstellungen im Privaten, in der Familie und im Freundeskreis wie in Vereinen und am Stammtisch gegeben, sagt die Kuratorin der Ausstellung, Heike Radvan.
Zwar ist es eine Tatsache, dass es in der DDR eine öffentliche Erinnerung an die NS-Opfer gegeben hat und sich der Staat auch um ehemalige NS-Verfolgte kümmerte. Aber, und das ist wichtig zum Verständnis des Antifaschismus in der DDR, die ermordeten Juden wurden nicht als solche sichtbar gemacht. Es wurde verwischt, dass die Juden als Juden ermordet wurden, stattdessen erschienen sie subsummiert unter nationale Kategorien wie Russen, Polen oder Holländer, an die etwa in den Gedenkstätten erinnert wurde.
Dass die DDR grundsätzlich anti-israelische Länder unterstützte, staatsoffiziell einen als Antizionismus verbrämten Antisemitismus pflegte, keine diplomatischen Beziehungen zu Israel aufnahm, die Arisierungen nicht Rückgängig machte und sich sowieso in keiner Weise als Nachfolgestaat des »Dritten Reichs« verantwortlich fühlte, diese Schändlichkeiten sind bekannt. Auch, dass in der DDR – vor allem am Anfang der fünfziger Jahre, der Zeit des Slánský-Prozesses in der Tschechoslowakei oder der Ärzte-Prozesse in der Sowjetunion – Juden drangsaliert wurden und versuchten, sich als Juden unsichtbar zu machen oder auszureisen. Das große Verdienst der Ausstellung ist allerdings, dass sie Antisemitismus auf lokaler Ebene sichtbar macht und Details, die im kollektiven Gedächtnis nicht mehr vorhanden waren, ausgegraben hat. Beispielsweise, dass etwa ein Viertel der jüdischen Gemeindemitglieder Anfang der fünfziger Jahre die DDR verließ, darunter die gesamte Dresdner Gemeinde.
Bedrückend ist auch eine Chronik antisemitischer Vorfälle in der DDR, die natürlich unvollständig ist. Von unzähligen Schändungen jüdischer Friedhöfe ist dort zu lesen, ebenso von antisemitischen Schmierereien und Beschimpfungen. Etwa im Jahr 1960 in Karl-Marx Stadt, wo in der gewerblichen Berufsschule III Jugendliche die Worte »Juden raus« in eine Mauer ritzten, nachdem sie erfahren hatten, dass bei der dort tätigen Maurerkolonne ein Arbeiter jüdischer Abstammung arbeitete. Oder sechs Jahre später in Wingwitz im Bezirk Dresden, wo Schüler der Polytechnischen Oberschule auf die Frage »Wer ist der größte Führer aller Zeiten?« mit »Adolf Hitler« antworteten und dann andere Mitschüler zwangen, das Lied »Schmiert die Guillotine ein mit Judenfett« zu singen. Oder im Oktober 1977, als die FDJ-Bezirksleitung insgesamt etwa 40 Fälle registrierte, in denen in Potsdam und Umgebung Mitglieder der Organisation sich antisemitisch äußerten und den Hitlergruß verwendeten.
Der staatliche Umgang mit den wenigen Spuren, die nach der Shoah ehemaliges jüdisches Leben bezeugten, beweist einen ähnlichen Ungeist wie die Aktivitäten der Untertanen, das zeigen die Recherchen der Ausstellungsmacher. In Neubrandenburg errichtete die DDR-Staatsführung auf dem ehemaligen jüdischen Friedhof das Redaktionsgebäude der SED-Zeitung Freie Erde. In Hagenow wurde der Friedhof zum Abstellplatz für städtische Müllfahrzeuge. Grabsteine wurden zum Straßen- oder Gebäudebau verwendet. Auf dem Fabrikgelände in Dessau, auf dem das Zyklon B für die Gaskammern hergestellt wurde, erinnerte nichts an die Produktion des Vernichtungsgases.
Besonders erschütternd ist Anetta Kahane, der Vorsitzenden der Amadeu-Antonio-Stiftung, zufolge auch die »riesige Gleichgültigkeit« gewesen, auf die die Jugendlichen bei ihren Recherchen stießen. »Ist ja keiner mehr da«, ist die Antwort Hagenower Bürger, die nach ihrer Meinung zur Verwendung jüdischer Grabsteine als Straßenbaumaterial befragt wurden.
Ein Teil der Ausstellung widmet sich auch der bemühten Zuwendung, die die DDR-Staatsführung für die jüdischen Gemeinden am Ende der achtziger Jahre übrig hatte, als wirtschaftliche Kontakte mit dem so genannten Klassenfeind als Ausweg aus der Misere dienen sollten. Handelserleichterungen waren von den USA nur bei einer umfassenden Entschädigung beziehungsweise Rückerstattung von arisiertem Eigentum zu haben. Daher wurde etwa in dieser Zeit den Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Reichspogromnacht, der Restaurierung jüdischer Synagogen oder den Beziehungen zu Israel beachtlich viel mehr Engagement entgegengebracht als jemals in den Jahren zuvor. »Instrumentalisierung der Jüdischen Gemeinden« ist dieser Teil der Ausstellung überschrieben.
Es sei in beachtlichem Maße die dargestellte Tabuisierung der Shoah gewesen, die nach der Wende die Zahl antisemitischer und rassistischer Taten ansteigen ließ, sagt Heike Radvan. Zwar bescheinigten Untersuchungen zu Beginn der neunziger Jahre den Bewohnern des Ostens noch eine geringere Neigung zum Antisemitismus als den Westdeutschen, aber die Kuratorin verweist darauf, dass etwa das Wort »Jude« in der DDR quasi nicht existiert habe. Daher habe es auch weniger negative Reaktionen etwa auf die Frage, ob man sich einen Juden als Nachbarn vorstellen könne, gegeben. In den vergangenen Jahren seien bei Umfragen neue Kriterien hinzugekommen, die bestätigten, dass antisemitische Einstellungen in Ost wie West gleichermaßen vorhanden seien.
Es wäre wünschenswert, dass die Ausstellung zahlreiche Auseinandersetzungen und das Aufbrechen der Tabus provozieren könnte, die bereits in der Gründung eines antifaschistischen Staats mit der Bevölkerung aus dem NS angelegt waren, auch wenn nicht immer ein leidenschaftlicher Polarisierer wie Biermann anwesend sein kann, der das Ganze befeuert.
»›Das hat’s bei uns nicht gegeben‹ – Antisemitismus in der DDR« ist bis zum 24. April im Rathaus Berlin-Lichtenberg zu sehen. Sie kann angefordert werden, Infos unter: www.amadeu-antonio-stiftung.de



 Nazis am Nil
Nazis am Nil