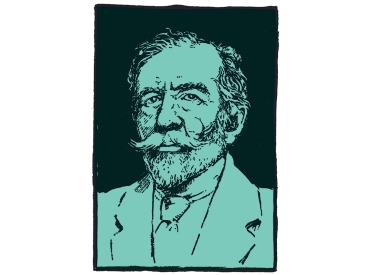Schirrmacher. Mosebach. Löffler. Greiner. Spiegel. Winkler. Jäger. Semler. Heni. Und Krause.
Wir bräuchten eine Debatte, sagte Frank Schirrmacher, der im Kreis der Herausgeber der FAZ fürs Feuilleton zuständig ist, irgendwann zwischen der Sommerpause und den Weihnachtsferien, als ihm der »Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache« umgehängt worden war und er sich zu bedanken hatte. Er wollte aber nicht darüber debattieren, worin seine von der Jury gewürdigten »sprachlichen Leistungen als Zeitungsjournalist und Buchautor« bestünden und was es mit der »Stilsicherheit, Eleganz und beispielhaften journalistischen Qualität« seiner Texte auf sich habe. Es ging ihm vielmehr um die Jugend, denn er hatte im Internet, namentlich bei Youtube, schier Unerträgliches entdeckt: »Was Kinder und Teenager heute unkontrolliert sehen können, ist pornographischer und gewalttätiger Extremismus, wie ihm niemals zuvor eine Generation ausgesetzt war.« Die Sprache der heutigen Jugend sei »beängstigend roh«, und sie entstehe aus dem »ikonographischen Extremismus« des Internets (denn so heißen schlimme Bilder auf Hessisch).
Wie so oft, wenn Schirrmacher redet oder schreibt, war es also wieder einmal fünf vor zwölf, und ein Borstenvieh lief durch die Gemeinde. Was war nun zu tun? »Wir riskieren, die wenigen Kinder, die unsere Gesellschaft in Zeiten des demographischen Wandels hat, mit seelischem Extremismus zu programmieren – wenn wir nicht bald eine Debatte über pornographische und kriminelle Inhalte im Internet beginnen.« Weil er aber wusste, dass die Jugend schon mindestens zweitausend Jahre lang verdirbt und verkommt und verroht und dass diejenigen, die sich um die Zukunft und das Gemeinwohl sorgen, diesen alarmierenden Prozess schon ebenso lange beklagen, fügte er seiner Brandrede den schlichten Satz hinzu: »Dies ist kein Kulturpessimismus.«
Während die Parteien und die interessierten Verbände sich inzwischen auf die Imagekampagne verlegt haben, um der Bevölkerung klar zu machen, dass das Kondom gut gegen Aids, die Familie aber gut für Kinder sei, vertraut der »Qualitätsjournalismus«, wie Schirrmacher ihn begreift, noch immer auf die Debatte. Sie ist die höchste und schönste Aufgabe des Feuilletons, und diejenige Zeitung darf die Meinungsführerschaft beanspruchen, der es gelingt, Debatten zu beginnen und nach ihren politischen Absichten zu lenken. Doch leider gehören zu einer Debatte mindestens zwei. Deshalb war die Debatte über den pornographischen und gewalttätigen bzw. ikonographischen bzw. seelischen Extremismus im Internet auch schon wieder beendet, als Schirrmacher das Rednerpult verließ, denn niemand mochte ihm widersprechen.
Aber die nächste Gelegenheit ergab sich bald. Im Herbst regnet es Kulturpreise, und der Büchnerpreis fiel heuer auf Martin Mosebach. Im Juni, als die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung ihre Wahl bekannt gegeben hatte, war der Jubel groß. »Martin Mosebach, der Erzähler, Romancier und Essayist, der Grandseigneur in der Apfelweinkneipe, der orthodoxe Katholik und unorthodoxe Kenner der Künste, der konservative Anarch und hemmungslose Bewahrer von Stil und Form, ist ein glanzvoller Büchner-Preisträger. Mit Martin Mosebach ehrt die Akademie einen genuinen Erzähler und einen Essayisten von ungewöhnlicher stilistischer und intellektueller Brillanz.« Mit diesen Worten brillierte Hubert Spiegel in der FAZ. Ulrich Greiner behauptete in der Zeit, einer der »intelligentesten, einfallsreichsten und sprachmächtigsten Dichter der Gegenwart« werde nun endlich nach seinem Verdienst geehrt. Greiners besonderer Beifall galt dem Umstand, dass »der Schritt, den die Akademie damit in die Gegenwart oder vielleicht sogar in die Zukunft getan hat, größer ist, als es den Anschein hat. Denn Mosebach, der seit rund 20 Jahren Romane der schönen Saumseligkeit und der sarkastischen Abschweifung schreibt, wäre vor zehn Jahren noch kaum einem Literaturkritiker als möglicher Kandidat für den Büchnerpreis eingefallen. Dafür lag Mosebachs formaler und inhaltlicher Konservatismus einfach zu sehr am Rande dessen, was der Geist der Zeit erforderte. Dieser nun hat sich gedreht.«
Gerade dieser Umstand aber nötigte Sigrid Löffler im Oktober zum Angriff auf Mosebach und seine Freunde in den Feuilletons. Denn der sich wendende Zeitgeist habe den wichtigsten deutschen Literaturpreis einem Autor zugeweht, der ihn, wenn es nur um literarische Qualität und nicht um politische Anschauungen und kulturelle Attitüden ginge, nicht verdiente. Mosebach sei von einigen neukonservativen »Pseudo-Saloniers« zu ihrem Lieblingsschriftsteller erwählt worden, in Wirklichkeit handle es sich bei ihm aber um einen »Bildungsposeur, der seinen Stil mit ornamentalen Sprach-Antiquitäten umschnörkelt und nostalgisch einer Zeit nachhängt, als man zum Kitsch noch ›Horreur‹ sagte«. Gar nicht wahr, antwortete Hubert Spiegel in der FAZ, Mosebachs Werk sei »intelligent, humorvoll, ironisch, glanzvoll verschroben und manches andere mehr«. Im Übrigen freute sich die Literaturredaktion der FAZ auf den Tag der Preisverleihung und war gespannt darauf, was Mosebach über Büchner sagen werde.
Er sprach über das Drama »Dantons Tod« und zeichnete ein Bild seines Autors, eines blutrünstigen Feindes nicht nur der Aristokratie, sondern auch des Besitzbürgertums, das nach dem Urteil von Experten mit dem wirklichen Büchner nicht viel zu tun hatte. In diesem Zusammenhang zitierte er einen Ausspruch Saint-Justs, der den Terror der Französischen Revolution rechtfertigte: »›Soll eine Idee nicht ebenso gut wie ein Gesetz der Physik vernichten dürfen, was sich ihr widersetzt? (…) Der Weltgeist bedient sich in der geistigen Sphäre unserer Arme ebenso, wie er in der physischen Vulkane oder Wasserfluten gebraucht. Was liegt daran, wenn sie nun an einer Seuche oder an der Revolution sterben? Das Gelangen zu den einfachsten (…) Grundsätzen hat Millionen das Leben gekostet, die auf dem Weg starben. Ist es nicht einfach, dass zu einer Zeit, wo der Gang der Geschichte rascher ist, auch mehr Menschen außer Atem geraten?‹ Wenn wir diesen Worten nun noch das Halbsätzchen einfügten: › … dies erkannt zu haben, und dabei anständig geblieben zu sein … ‹, dann wären wir unversehens einhundertfünfzig Jahre später, und nicht mehr in Paris, sondern in Posen, in Himmlers berüchtigter Rede vor SS-Führern.«
Man kommt aber nur dann »unversehens« von Saint-Just zu Himmler, wenn man ganz unhistorisch die psychische Konstitution von Menschen betrachtet, die den Massenmord rechtfertigen oder ihn selbst begehen. Einem anderen wären vielleicht auch noch sämtliche Monarchen von Otto dem Großen bis Wilhelm II. eingefallen, die allerdings keine besondere Idee, sondern bloß ein ererbtes Recht und den Willen zur Vergrößerung des Reichs und des eigenen Ruhms brauchten, um Tausende in den Tod zu schicken. Mosebach allerdings, so heißt es, ist Monarchist.
»Ultima ratio regis« lautete der Titel der Dankesrede. Von der FAZ wurde sie debattengerecht zubereitet und erschien nun mit der Überschrift: »Saint-Just. Büchner. Himmler. Kann es Gründe für den Massenmord geben?« Der Historiker Heinrich August Winkler erkannte nun in dieser Rede, zumal da Mosebach ausführlich über den Ruf »Es lebe der König« meditiert hatte, der am Ende von »Dantons Tod« den verzweifelten Protest gegen die Revolution und ihren Terror ausdrücke, die reaktionäre Absicht, den Totalitarismus des 20. Jahrhunderts auf die Aufklärung des 18. zurückzuführen, um sie zu delegitimieren und als Irrweg des Denkens erscheinen zu lassen. »Man kann solche Linien ziehen, man kann solche Ähnlichkeiten der Denkstruktur nachweisen«, sagte Winkler im Deutschlandradio. Wer aber den Unterschied zwischen dem revolutionären Terror in Frankreich, bei dem es sich um eine »Perversion der Aufklärung« gehandelt habe, und dem nationalsozialistischen Kampf gegen die Aufklärung verwische, betreibe eine »Geschichtsklitterung«.
Dazu fiel nun Lorenz Jäger in der FAZ nichts Besseres ein, als die alte Schmonzette vom Vergleich und der Gleichsetzung zu bemühen und sich gegen ein vermeintliches Vergleichsverbot zur Wehr zu setzen. Wer nicht vergleichen dürfe, könne auch keine Unterschiede erkennen. »Die Fürsprecher des Vergleichsverbots haben dieses logische Problem bis heute nicht überzeugend zu lösen vermocht.« Machen wir einen Versuch: Vergleichen darf man alles mit jedem. Man darf sogar den Holocaust mit einem Glas Bier vergleichen. Aber wenn man ernst genommen werden will, sollte man erklären können, warum man das tut, und man sollte zum Ergebnis kommen, dass die Gemeinsamkeiten gering sind.
Und weil nun Christian Semler sich in der taz zur Unterstützung der Argumente Winklers vernehmen ließ und Jäger ihm vorwarf, er rede immer noch »Kaderwelsch«, wie in den Zeiten, da er die maoistische KPD/AO anführte, konnte auch der Vorwurf des Antisemitismus nicht ausbleiben. Erhoben wurde er von dem Politikwissenschaftler Clemens Heni auf Welt-Online: »Mit diesem Wort generiert der FAZ-Kommentator Lorenz Jäger ein antisemitisches Wort.
›Welsch‹ meint jüdisch, französisch, unlauter, betrügerisch, romanisch, un-deutsch. Die Gegenaufklärung nimmt weiter an Fahrt auf.«
Ihren Tief- und Endpunkt erreichte diese Debatte, als Tilman Krause die Gelegenheit gekommen sah, endlich einmal das zu tun, was der Deutsche am liebsten tut: seine Meinung sagen, ohne Rücksicht auf Verluste. Weil sich aber womöglich niemand für seine Meinung interessiert, erhob Krause sich zum Sprecher einer »großen Bewegung«, in deren Auftrag er nun auf Welt-Online zum »letzten Gefecht« blies. Mosebach, »ihr Exponent«, sei aber schon vor der Entscheidungsschlacht »auf der sicheren Seite«, weil die Bewegung »endlich, endlich selbstbewusst hinwegrollt über das unfrohe, beleidigte, sauertöpfische, musterschülerhafte Hochhalten der Plakate ›Revolution‹ und ›Dekonstruktion‹, ›Aufbrechen‹ und ›Niederreißen‹«. (Das muss man sich auch einmal vorstellen: wie da eine Bewegung hinwegrollt über das Hochhalten des Niederreißens.)
Seine Siegesgewissheit gewann Krause aus der Überzeugung, dass die Bewegung gar nicht größer sein könnte, als sie ist. Es sind nämlich »die Leute«, die umstellt und gequält werden von den künstlerischen Hervorbringungen der Moderne und die sich nun endlich, endlich zur Wehr setzen. »Die Leute sind’s jetzt leid. Sie sind es leid, sich von autistischen Architekten ihre Städte verschandeln zu lassen. Wie viele Jahrzehnte sollen sie noch unter Beweis stellen dürfen, dass sie keinen Sinn für urbane Strukturen haben und am Menschen vorbeikonstruieren? Wahrlich, sie haben ihre Chance gehabt. Bauen wir halt wieder auf, was seine Probe bestanden hat!« Die Niedlichkeit der Postmoderne ist Krauses Wahrnehmung offenbar entgangen, oder reicht sie ihm noch nicht? Was will er? Er will »Bürgerlichkeit, Bildungsbewusstsein, Herkunftsstolz« und ästhetische Darstellungsmittel, »die nicht ›provozieren‹, sondern den Sinn für Schönheit befriedigen«. Also will er ganz gewiss das Berliner Stadtschloss, von dem man allerdings schwerlich sagen könnte, es habe seine Probe bestanden? Aber will er auch zweistöckige Fachwerkhäuser mit Reetdächern auf dem Alexanderplatz? Oder lieber neoneoklassizistische Pracht? Man weiß es nicht, und wollte man es herausbringen, müsste man mit ihm über den Sinn für Schönheit diskutieren, von dem er offenbar glaubt, er sei unwandelbar den Leuten angeboren. Und dann wäre man wieder mitten in der Moderne.
Krauses Schönheitsempfinden wird nicht nur von der Architektur der sechziger Jahre beleidigt. »Die Leute sind es auch leid, in der Malerei und in den anderen darstellenden Künsten das konzeptuelle Getue von handwerklichen Stümpern bestaunen zu sollen, deren Grips allenfalls für die zeitgeistgemäße Selbstdarstellung reicht. Darum: Her mit der figürlichen Malerei! Und schließlich haben die Leute es satt, sich in der Literatur anöden lassen zu sollen von Autoren, die nichts erlebt, durchdacht und folglich nichts zu sagen haben und mit Befindlichkeitsprosa langweilen, die noch nicht einmal durch Charme für sich einnimmt. Darum hoch die welthaltigen Erzählwerke eines Martin Mosebach!« Ob ein Autor etwas »erlebt« hat, gilt also neuerdings wieder als Kriterium literarischer Qualität. (Mosebach selbst sprach übrigens einmal von seiner »an äußeren Ereignissen armen Biographie«.) Und die Kunst hat sich wieder nach dem Volk zu bemühen, pardon: nach den Leuten. Nun gab es aber eine Zeit, in der die Kunst sich dem gesunden Leuteempfinden unterwerfen musste, und wenn wir den Wutausbruch des Leutetribuns Krause im Sinne Lorenz Jägers mit dem Geist und der Rhetorik jener Zeit vergleichen wollten, dann müssten wir in Mosebachs verquerem Deutsch sagen: Wir sind unversehens siebzig Jahre früher. Einem Denker wie Krause fällt aber gar nichts auf, nicht einmal wenn es aus ihm heraustönt: »Die ästhetische Moderne war die Krankheit, für deren Widerspiegelung auf hohem Reflexionsniveau sie sich hielt.«
Zum Glück ist eine Bewegung, wie Krause sie ersehnt, nirgends auszumachen. Es gibt nur ein paar korrekt gekleidete Herren, die sich konservativ und elitär gebärden und in den Feuilletons mit ihrem Abiturzeugnis herumwedeln. Sie reden von Traditionen, Tugenden und Werten und von der Familie und sind dabei genauso hilflos wie die Achtungsechziger, von denen sie sich noch immer unterdrückt und bevormundet fühlen. Ihr intellektueller Brennwert ist gleich Null; doch eines haben sie ihren vermeintlichen Feinden, die zu überrollen sie sich nun anschicken, immerhin voraus: Die Achtundsechziger erreichten das Stadium ihrer kompletten Lächerlichkeit erst nach anderthalb Jahrzehnten, unsere selbstbewussten Konservativen aber haben dasselbe in ein paar Wochen geschafft.
Am Ende bleibt nur eine Frage: Was sollen uns eigentlich diese nervtötenden Debatten, an deren Beginn jemand anlässlich eines Anlasses auf den Nazipudding haut, in deren Verlauf der Winkler sagt, was des Winklers ist, und der Jäger antwortet, wie er es nicht anders kann, und die schließlich ohne Ergebnis verstummen, weil sie innerhalb weniger Tage aufs Niveau Krause hinabgesunken sind? Darüber sollten wir einmal reden! Wir brauchen eine Debatte!



 Nazis am Nil
Nazis am Nil