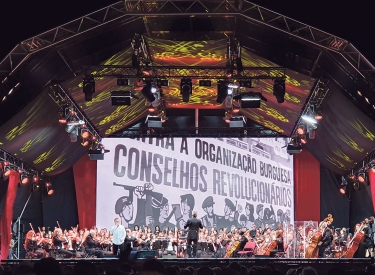Mission impossible für Chávez
Mit einem breiten Grinsen deutet Marcel Quintana auf den Demonstrationszug, der sich gut 20 Stockwerke tiefer durch die Straßenschlucht schlängelt. »Oh, sind das wenige«, sagt er spöttisch. »Wir können viel mehr mobilisieren«, sagt Quintana und schmunzelt mitleidig. Mitleid hat er allerdings nicht mit den Demonstranten – Studenten, Angestellten der Universität und Anhängern der Opposition, die gegen die Regierung von Präsident Hugo Chávez auf die Straße gehen. Es ist ein langer Demonstrationszug, der sich durch die Stadt in Richtung Präsidentenpalast schlängelt, doch er ist eben nicht groß genug, um die Anhänger der Regierung zu beeindrucken.
Zu denen gehört auch Marcel Quintana. Der bekennende Homosexuelle ist zwar nicht mit allem einverstanden, was die venezolanische Regierung macht, aber »die Fortschritte können sich sehen lassen«, so viel steht für ihn fest. »Schauen Sie sich um«, sagt er und deutet mit einer ausladenden Armbewegung auf den Schrank in seinem Büro, wo sich Medikamentenpackungen stapeln. Auf dem Schreibtisch steht eine große, mit Kondomen gut bestückte Glasschale. Im Flur öffnet er eine Tür zum Behandlungsraum, dort eine weitere zum Computerschulungsraum und wieder eine, die zum Büro der Krankenschwester führt. »Hier kann jeder herkommen, hier wird jedem geholfen, egal ob er oder sie einen Bluttest machen, sich informieren oder einfach nur ein bisschen quatschen will.«
Die Einrichtung heißt Ases de Venezuela und ist eine Anlaufstelle für Schwule, Lesben und Transsexuelle. Ermöglicht wird ihre Arbeit durch die Unterstützung der Regierung. »Wir haben Fortschritte bei der HIV-Prävention gemacht, gehen gegen Vorurteile vor und werden wahrgenommen«, erklärt Quintana. »Venezuela ist das einzige Land in Lateinamerika neben Brasilien und Argentinien, das allen HIV-positiven Menschen im Land Medikamente zur Verfügung stellt.«
Darauf ist Quintana, Sohn einer Venezolanerin und eines Berliners, ausgesprochen stolz. Politik werde in Venezuela nicht mehr von oben, sondern immer öfter von unten gemacht, behauptet der 44jährige und blickt noch einmal etwas schadenfroh auf den Demonstrationszug. »Wir sind die Mehrheit und gestalten nun die Geschicke dieses Landes«, erklärt er mit einem schelmischen Lächeln. Nur zu deutlich ist, dass er nicht viel vom alten Establishment hält. Dieses ist zwar im Demonstrationszug in Form der einst tonangebenden Parteien, Acción Democratica und Copei, auch vertreten, aber sie sind nicht die einzigen Kräfte, die eine Opposition gegen die Politik von Chávez zu artikulieren versuchen. Dominiert wird der zwar schmale, aber lange Zug von Studenten, ihnen haben sich aber auch Angestellte von Krankenhäusern und Bildungseinrichtungen angeschlossen. Transparente mit der Forderung »Sofortige Zahlung der Schulden« finden sich genauso darunter wie Appelle, das Rechtssystem nicht zu verbiegen, oder ein »Nein zur Ideologisierung der Kinder«. Ein Sammelsurium von Forderungen, darunter auch verbale Angriffe gegen den Präsidenten, der hier und da als Verursacher allen Übels dargestellt wird, so zum Beispiel als Justicia (Gerechtigkeit), wobei die Waage sich in die gewünschte Richtung neigt. Die Demonstranten lehnen die Politik von Chávez rigoros ab, doch ein Großteil der Bevölkerung bewundert den Präsidenten, der sich gerne als »Kämpfer für die Armen« darstellt.
»Die Polarisierung in der venezolanischen Gesellschaft ist deutlich spürbar und derzeit vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo demonstriert wird«, sagt Pablo Fernández Blanco von der Menschenrechtsorganisation »Netzwerk zur Unterstützung von Gerechtigkeit und Frieden«. Der 38jährige Argentinier mit dem sorgsam gestutzten Kinnbärtchen lebt seit 15 Jahren in Venezuela. »Die sozialen Spannungen nehmen zu, auch wegen der Wirtschaftskrise, die sich in Venezuela immer bemerkbarer macht«, lautet seine Meinung.
Der Ton auf beiden Seiten – der Chávez-Anhänger und der Opposition – hat sich verschärft, was auch daran liegt, dass die Regierung seit dem Sinken der Erdölpreise weniger zu verteilen hat. Auf gerade mal 40 US-Dollar pro Barrel belief sich der Durchschnittspreis in den ersten vier Monaten des Jahres. Im ersten Quartal des Jahres sanken die Einnahmen des staatlichen Erdölkonzerns um 55,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Statt 20,4 Milliarden US-Dollar gingen nur 9,1 Milliarden US-Dollar in die Kassen des größten Unternehmens des Landes.
Eine Tatsache, die sich auch in den Sozialprogrammen der Regierung, den »Misiones«, durchaus bemerkbar macht. Denen stehen deutlich weniger Mittel zur Verfügung, wie der Bilanz des nationalen Erdölkonzerns Petróleos de Venezuela aus dem Jahr 2008 zu entnehmen ist. Seit 2003 legt das Unternehmen keine eigenen Sozialprogramme auf wie früher, sondern verteilt direkt an die insgesamt 28 »Misiones« Geld, die im Laufe der Jahre von der Chávez-Regierung aufgelegt wurden. Für das staatliche Gesundheitsprogramm Barrio Adentro, das eine medizinische Versorgung in den Armenvierteln sicherstellen soll, sowie für die staatliche Supermarktkette Mercal – eines der wichtigsten Sozialprogramme der Chávez-Regierung – waren 2007 noch 7,1 Millionen US-Dollar investiert worden, 2008 waren es nur noch drei. Einer Studie zufolge sollen 30 Prozent der Gesundheitsposten, die im Rahmen des Programms Barrio Adentro eröffnet wurden, bereits 2007 geschlossen worden sein. Ein Grund dafür ist auch die Abwanderung vieler kubanischer Ärzte, die das Land in Richtung Miami verlassen haben und den Dienst am »Brudervolk« quittiert haben. »Wer will es den Kubanern vorwerfen, wenn sie in Miami bessere Bedingungen haben«, sagt Deanna Albano. Die Psychologin arbeitet seit über zwei Jahrzehnten mit Straßenkindern bei der Organisation Muchachos de la Calle, im Armenviertel Los Erasos im Zentrum von Caracas.
Nur einen Steinwurf vom ultramodernen Hospital de Clínicas entfernt, einem weitläufigen Krankenhauskomplex, liegt das Armenviertel Rancho, das sich einen Hügel hinaufzieht und faktisch aus drei Teilen besteht, in denen rund 16 000 Menschen auf engstem Raum leben. Enge ist typisch für die Lebensbedingungen in den Armenvierteln, doch anders als in Los Erasos gibt es in vielen der bekannten Viertel wie 23 de Enero oder La Vega funktionierende Strukturen.
»Hier in Los Erasos haben wir die Leute unten, die in der Mitte und die oben, und die ziehen nicht unbedingt an einem Strang«, erzählt Jorge Gregorio Santiago. Der 24jährige verdient etwas Geld als Parkwächter am Wochenende und versucht, sich aus den Streitereien im Stadtviertel herauszuhalten. Die Auseinandersetzungen und das fehlende gemeinsame Auftreten des barrio gegenüber den staatlichen Stellen haben dafür gesorgt, dass sich in Los Erasos in den vergangenen Jahren wenig getan hat. »Andere Viertel haben deutlich stärker von den Misiones profitiert als wir«, ärgert sich der junge Mann, nimmt die Sonnenbrille vom Kopf und geht zum Fenster seiner Werkstatt im dritten Stock. Von hier aus kann man den Blick über die unzähligen Wellblechdächer schweifen lassen, die neben Backstein und Beton die einfachen Konstruktionen prägen. Jorge fehlen Perspektiven, und das bisschen, das ihm im Zentrum zu tun bleibt, wo er kunstvoll dekorierte Notizblöcke, Mappen und Schnellhefter mit anderen Jugendlichen fabriziert, reicht ihm nicht. »Was wir brauchen, ist Arbeit, damit wir uns selbst ernähren können und nicht auf die staatlichen Hilfen angewiesen sind«, sagt er mit bitterer Stimme. Er träumt von einem festen Job, würde sich am liebsten mit einem Schuhgeschäft selbständig machen, aber das – das weiß Jorge Gregorio – wird wohl ein frommer Wunsch bleiben.
Arbeit ist auch im zehnten Jahr der von Chávez ausgerufenen »bolivarischen Revolution« knapp. Zwar liegt die offizielle Arbeitslosenquote nur knapp über acht Prozent, doch Unterbeschäftigung ist weit verbreitet. Auch Jorge Gregorio taucht in der Statistik nicht auf, obwohl er Arbeit sucht. Nichts Ungewöhnliches in Lateinamerika, wo ein Großteil der Bevölkerung im informellen Sektor arbeitet. Doch mit dem Gewinn aus dem Erdölgeschäft der vergangenen Jahre standen der Chávez-Regierung ausreichend Mittel zur Verfügung, um die Wirtschaft anzukurbeln. Zwar sind mit den beiden wichtigsten »Misiones«, dem Gesundheitsprogramm Barrio Adentro und den Mercal-Supermärkten, Schätzungen zufolge rund eine Million Jobs entstanden, aber klassische Programme zur Reduzierung von Arbeitslosigkeit wie Infrastruktur- und Wohnungsbauprogramme waren nur bedingt erfolgreich. Ein großes Problem angesichts der zwei bis drei Millionen fehlenden Wohnungen, das auch durch die Verstaatlichung der Zementindustrie im vergangenen Jahr nicht gelöst werden konnte. Für die Verzögerungen bei der nationalen »Wohnungsbauoffensive« hat Chávez die überhöhten Preise für Baustoffe verantwortlich gemacht. Doch am Zement allein kann es nicht liegen, denn Mitte Mai gab der stellvertretende Wohnungsbauminister José Vicente Rodríguez bekannt, dass statt der im Januar veranschlagten 107 000 Wohnungen nur rund 20 000 in diesem Jahr gebaut würden. Gründe gab er für diesen Kurswechsel nicht bekannt, doch es gilt als offenes Geheimnis in Caracas, dass es der Regierung schwer fällt, die verstaatlichten Unternehmen effizient zu managen.
Eine Ursache ist der latente Mangel an qualifiziertem Personal, an dem sich auch zehn Jahre nach Beginn der »bolivarischen Revolution« in Venezuela nichts Wesentliches geändert zu haben scheint. »Der Pool der Chávez-Anhänger gibt nicht viel her«, heißt es lapidar in Unternehmerkreisen. Weshalb der Nachwuchs ausbleibt, ist jedoch selbst Sympathisanten der Regierung wie Marcel Quintana nicht ganz klar. Dass nicht alles reibungslos läuft, gibt auch er zu. »Doch bei der Armutsbekämpfung haben wir Fortschritte gemacht, und auch im Gesundheitsbereich sieht es deutlich besser aus.« Fortschritte, die allerdings angesichts knapper Kassen schnell auf dem Spiel stehen könnten.
Experten wie der in Caracas lehrende Politikprofessor Friedrich Welsch kalkulieren, dass die Regierung pro Barrel Öl um die 75 US-Dollar kassieren muss, um allen Verpflichtungen gerecht zu werden. Ob das so stimmt, weiß niemand genau, da zwar im offiziellen Haushalt mit einem deutlich niedrigeren Barrelpreis von etwa 40 US-Dollar kalkuliert wird, aber darin tauchen längst nicht alle Ausgaben auf. So sind die Ausgaben für die »Misiones«, die gleichzeitig mit den Programmen des Gesundheits- und Bildungsministeriums laufen, aber nicht institutionalisiert sind, nicht komplett aufgeführt. Derzeit weist der Preis pro Barrel zwar eine steigende Tendenz auf, aber nach etlichen Monaten mit reduzierten Einnahmen scheinen die liquiden Mittel der Regierung knapper zu werden. Das macht sich negativ in den Regalen bemerkbar, aber auch im Portemonnaie der Einwohner. Die Preise steigen, und die heimische Währung, der Bolívar fuerte, kommt immer stärker unter Druck. Im vergangenen Jahr betrug die Inflation 30 Prozent, in diesem Jahr könnten es 40 Prozent werden. »Man kann förmlich zusehen, wie einem das Geld zwischen den Händen zerrinnt«, klagt der Sozialarbeiter und Lehrer Gustavo Misle. Nichts Neues in Venezuela, wo in schöner Regelmäßigkeit mit der hohen Inflation gekämpft wird, aber es sind die Armen, die hauptsächlich davon betroffen sind. »Bei Lebensmitteln liegt die Inflation sogar bei 50 Prozent, und auch in den staatlichen Mercal-Supermärkten steigen die Preise«, erklärt Misle.
Zwar liegen die Preise in diesen staatlich subventionierten Läden rund 40 Prozent unter denen in den normalen Supermärkten, aber die Kaufkraft der unteren Einkommensschichten sinkt schneller als die der oberen.
Ein nicht gerade kleines Problem für Hugo Chávez, den selbst ernannten »Kämpfer für die Armen«. Die Beteiligung der armen Bevölkerungsschichten an den nationalen Reichtümern, vor allem Öl, aber auch Gold, Diamanten oder Edelhölzern, sinkt. Obendrein sind die Lücken in den Regalen der Mercal-Supermärkte kaum mehr zu übersehen. Von 20 Grundnahrungsmitteln gab es Ende Mai in der Filiale in Cristo Rey immerhin sieben, in La Quebradita nur drei, und im Stadtteil Catia war nur eines der Produkte zu finden, berichtete die Tageszeitung Ultimas Noticias, die eher der Regierung als der Opposition zugerechnet wird.
Die Probleme bei der Versorgung mit Lebensmitteln sind das Ergebnis einer weitgehend gescheiterten Agrarreform, denn statt wie gewünscht mehr Lebensmittel herzustellen, sinkt die Produktion, und der Importbedarf steigt. Auf großen Farmen wie El Charcote, die einst Fleisch en gros produzierte und 2006 nationalisiert wurde, wird heute kaum mehr produziert. Man hat schlicht vergessen, die Kleinbauern – denen man das Land überantwortete – mit Krediten, Beratung und Saatgut auszustatten. Verantwortlich dafür ist unter anderem der Mangel an Spezialisten, der trotz der Hilfe aus Kuba kaum zu kaschieren ist. Angeblich gehen die guten Leute ohnehin lieber ins Ausland, weil dort die Perspektiven besser seien, so ist aus Unternehmerkreisen zu hören. Die sind der Regierung ohnehin nicht gerade wohlgesonnen, weshalb von privater Seite kaum mehr investiert wird. Auch ein Beispiel für die tief greifende gesellschaftliche Polarisierung. Doch daran wird sich in nächster Zeit vermutlich kaum etwas ändern.


 Von Raqqa bis Bachmut
Von Raqqa bis Bachmut