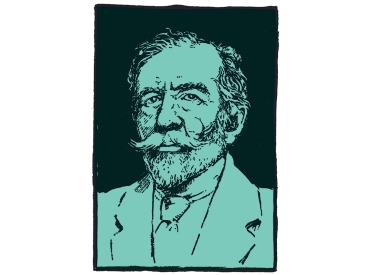Herr Lehmann, geh’ doch crowdfunden!
Der Redakteur und Journalist L., der im letzten Jahr gefeuert wurde, nachdem er gegen seinen langjährigen Arbeitgeber, eine Tageszeitung, auf Festeinstellung und angemessene Bezahlung geklagt hatte, hegt seitdem eine Vision: die von einem Journalistenbüro, das nur noch Aufträge mit einem Tagessatz von mehreren hundert Euro annimmt und dessen Mitarbeiter mit der Lufthansa zur Konferenz eingeflogen werden. Natürlich nicht, um journalistische Leistungen zu erbringen, sondern um PR-Aufträge von jenen Institutionen zu übernehmen, über die L. zwei Jahrzehnte lang kritisch berichtet hat.
Fluchtgedanken pflegen, sich still ärgern, sich mit allem arrangieren: Das sind die Bewältigungsstrategien in der deregulierten Kreativbranche. Oder eben eine Wutrede halten – so wie Sven Regener, Autor (»Herr Lehmann«) und Musiker (Element of Crime), kürzlich im Bayerischen Rundfunk, als er zum Thema Urheberrecht interviewt wurde. Es war ein Rundumschlag gegen die »Kostenlos-Kultur« im Internet. »Es wird so getan, als ob wir Kunst machen als Hobby. Das Rumgetrampel darauf, dass wir uncool seien, wenn wir darauf beharren, dass wir diese Werke geschaffen haben, ist im Grunde nichts anderes, als dass man uns ins Gesicht pinkelt«, erklärte er. Seine Meinung zu Youtube (»Ein Geschäftsmodell, das darauf beruht, dass diejenigen, die den Inhalt liefern, nichts bekommen, ist Scheiße«) ist ebenso deutlich wie die zur Piratenpartei (»Der örtliche Chef von der Piratenpartei hat eine Firma, die machen Apps für I-Phones. Das ist ein geschlossenes System, hundert Prozent Copyright.«).
Regener hat damit eine Debatte über eine juristische Problematik ausgelöst, mit der vor noch gut zwei Jahrzehnten nur wenige Branchenfachleute zu tun hatten. Dann kam das Internet und zerstörte vor allem in der Musikindustrie die traditionellen Distributionswege. CDs waren kaum noch verkäuflich, stattdessen wurde über das Netz getauscht, später stand Youtube zur Verfügung.
Ende März gingen 51 »Tatort«-Autoren mit einem Offenen Brief an die Öffentlichkeit: Der »ganze Diskurs über das Netz und seine User« schlage einen hohen Ton an und kaschiere »damit die Banalität von Rechtsverstößen«; dies diene »lediglich der Aufwertung der User-Interessen, deren Umsonstkultur so in den Rang eines Grundrechts gehievt wird«. Unterzeichner sind unter anderem Friedrich Ani, Felix Huby und Klaus Gietinger.
Die Vehemenz, mit der seitdem gestritten wird, rührt auch daher, dass Gesetzesänderungen (wie die Hartz IV-Gesetze), die auch Künstler und Autoren betreffen, ihre ohnehin prekäre Lage weiter verschärft haben.
Bei den Piraten, der Protestpartei der Stunde, sind die Vorstellungen zum Urheberrecht nicht am Ende des Parteiprogramms versteckt, sondern der zentrale Gründungsmythos. Allzu präzise sind die Vorstellungen für eine Reform des Urheberrecht bislang allerdings nicht. »Zwar sind wir uns über viele Tücken des bisherigen einig, allerdings kristallisieren sich unsere konkreten Änderungsvorschläge erst langsam aus der hitzigen Diskussion heraus«, heißt es im Piraten-Wiki. Die Grundzüge werden im Parteiprogramm allerdings deutlich. Die Nutzung von Kopien von digitalen Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken soll unbegrenzt erlaubt werden, die Urheber des Content, also die Künstler sollen sich aus alternativen Quellen finanzieren: Es existiere »eine Vielzahl von innovativen Geschäftskonzepten, welche die freie Verfügbarkeit bewusst zu ihrem Vorteil nutzen und Urheber unabhängiger von bestehenden Marktstrukturen machen können«.
Mit anderen Worten: Der Rechtsanspruch auf eine Vergütung wird durch freiwillige Leistungen der Nutzer ersetzt – eine klassisch liberale Position. Der Bundesvorsitzende Sebastian Nerz hat dies gerade in einem Interview mit der FAZ bekräftigt. Ganz wie ein langjähriger Berliner Politprofi beschwichtigte er zunächst und beteuerte, die Piraten befürworteten ein »Urheberrecht, das die Künstler in den Vordergrund stellt, nicht die Verwertungsgesellschaft. Die Finanzierungsfragen sind wichtig.« Dann empfahl er als Beispiel für eine alternative Finanzierung das sogenannte Crowdfunding, also das Geldeinwerben für Projekte im Netz: »Manche Künstler verdienen damit viel Geld.«
Ein paar Stufen weiter unten in der Piratenhierarchie ist der Tonfall rauer, die Botschaft diesselbe. »Mensch, Alter, mach die Augen auf, die haben dich verarscht«, schreibt Fritz Effenberger, Vorsitzender im bayerischen Bezirk Schwaben, auf seiner Website als Antwort an Sven Regener. »Du warst zu oft mit den Unkreativen beim Biertrinken. Die Wirklichkeit ist: Noch nie war es es für uns Urheber besser als heute, zu Zeiten von Internet und digitaler Kopie.« Bei »industriellen Verwertern« bekomme man nicht mehr als fünf Prozent vom Endverkaufspreis, beim eigenen Youtube-Channel dagegen 50 Prozent der Werbeeinnahmen, bei Amazon 70 Prozent des Umsatzes. »Nur weil jemand Kunst macht, hat er kein Recht auf Geld dafür. Er muss die Leute überzeugen, ihm Geld zu geben.« Nicht wenige Musiker lebten inzwischen von neuen Geschäftsmodellen, schreibt er: »Mach das doch auch, bitte.«
Man weiß nicht so recht, ob dieser schneidig-schnoddrige Tonfall der von Revolutionären ist, die den Gang der Geschichte auf ihrer Seite wissen, oder der von neoliberalen Reformern. Die meisten Leute in seinem Umfeld zählten zum »Prekariat der Besserverdienenden«, hat der wirtschaftspolitische Sprecher der Berliner Piratenfraktion, Pawel Meyer, kürzlich erklärt. Meyer ist IT-Unternehmer. Bei den Piraten planen die Gewinner der digitalen Revolution Gesetze, welche die Rechtsposition der Verlierer weiter verschlechtern. Was passiert mit denjenigen, die mit dem Modell der reinen Selbstvermarktung weniger verdienen als bisher? Im Programm der Piraten finden sich darauf keine Antworten.
Das Urheberrecht ist in den letzten Jahren von zwei Seiten attackiert worden: Die Piraten greifen es von der Seite der User an, die Verlage und Rundfunkanstalten von der Seite der Verwerter, indem sie mit immer dreisteren Buy-out-Verträgen den Autoren nahezu alle Rechte abpressen. Wer nicht unterzeichnet, erhält keine Aufträge mehr. Der Chaos Computer Club empfiehlt daher in einer Antwort an die »Tatort«-Autoren die seit längerem diskutierte Kulturflatrate. Das Modell würde eine rechtsverbindliche Absicherung als Alternative zum jetzigen Urheberrecht bieten. Internetnutzer würden dann wie bei der GEZ-Gebühr eine pauschalen monatlichen Beitrag zahlen. Dafür dürften sie Musik oder Filme im Netz kostenlos herunterladen. Das eingenommene Geld würde anschließend wieder unter Künstler und Autoren aufgeteilt.
Die Probleme des Modells liegen im Detail: Wie hoch ist die Abgabe – und wie lässt sich verhindern, dass über die Höhe die jeweilige Regierung bestimmt? Ist die Aufgabe des Urheberrechts zugunsten der Flatrate-Ausschüttung verpflichtend oder freiwillig? Nach welchen Kriterien soll ausgeschüttet werden? Dürfen auch die Verleger mit ihren Buy-out-Verträgen profitieren? Verdienen manche Autoren weniger als heute?
Notwendig wäre eine Diskussion darüber, ob ein solches Modell funktionieren kann. Aber solange sich der Siegeszug der Piraten ungebremst fortsetzt, wird auch der Opportunismus der Berliner Politik zunehmen und damit der Drang, irgendetwas zu unternehmen. Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin etwa befürwortete Anfang April die »Kulturflatrate«, natürlich ohne Aussagen zu Einzelheiten. Auf die Schwarmintelligenz, eventuell folgenden Gesetzesunsinn zu verhindern, sollte man nicht setzen. Ein paar Wutreden wären vermutlich hilfreicher.



 Nazis am Nil
Nazis am Nil