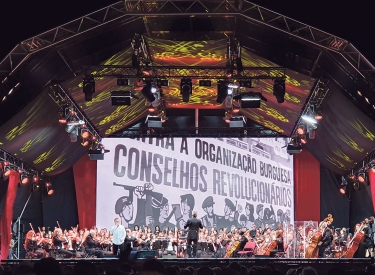Vom Trauma zur Pizza
In der Woche, in der sich alles änderte, schneite es das erste Mal in Kiew. Die Temperaturen lagen nur knapp über dem Gefrierpunkt. Trotzdem versammelten sich täglich bis zu 10 000 Demonstrierende auf dem Maidan, einem zentralen Platz der ukrainischen Hauptstadt. Auf Plakaten forderten sie »Eine EU für Millionen, nicht Millionäre«, »Eine Welt ohne Grenzen« sowie einen Politikwechsel der ukrainischen Regierung, und vor allem eines: eine Annäherung an die Europäische Union.
Es war der 29. November 2013, wie Ivona Kostyna später erzählen wird, »das Epizentrum der Revolution«. Um sich zu wärmen, versammelten sich die Protestierenden in einer offenen Kapelle der Sophien-Kathedrale oberhalb des Maidan, als die Spezialeinheit Berkut anrückte. Die vermummten Beamten hatten den Auftrag, den Platz zu räumen, etwa 300 Demonstrierende in der Kathedrale beschlossen zu bleiben. Männer bildeten einen schützenden Kreis und Frauen drängten sich in der Mitte zusammen. Gemeinsam stimmten sie die ukrainische Hymne an, sangen immer lauter gegen die Angst vor den in Reihe positionierten Einsatzkräften an. Der Gesang verstummte, als die Polizisten anfingen, mit Schlagstöcken auf die Protestierenden einzuschlagen. »Überall war Blut«, wird sich Kostyna erinnern. Sie flieht aus dem Turm. Die damals 16jährige habe zwei Mädchen an der Hand gegriffen, die später ihre besten Freundinnen werden sollten, und sei losgerannt. »Ich konnte sogar die Polizisten weinen sehen.«
Der 29. November markiert den Übergang von friedlichen Protesten zum offenen Konflikt. In der Ukraine werden die Ereignisse als »Revolution« beschrieben, im westlichen Ausland oft als »Ukraine-Krise«, Russland spricht von »Bürgerkrieg«. Hunderte Demonstrierende, Passanten und Journalisten wurden in jener Nacht teils schwer verletzt. Einen Tag zuvor war bekannt geworden, dass das geplante Assoziierungsabkommen zwischen der Ukraine und der EU nicht unterzeichnet werden sollte.
Knapp vier Jahre Jahre später scheint die Forderung der Protestierenden von damals Wirklichkeit zu werden: Das EU-Assoziierungsabkommen soll im September in Kraft treten. Bereits seit dem 11. Juni können Ukrainerinnen und Ukrainer bis zu 90 Tage ohne Visum in die EU einreisen.
»Heldin« in zivil
»Als es hier losging, wusste ich, dass ich Ukrainerin bin«, sagt Kostyna heute an der Stelle des Maidan, an der für sie alles begann. Die Tochter zweier Diplomaten ist mittlerweile 20 Jahre alt, trägt abgetragene Chucks und ein knöchellanges Kleid. Mit ihrem erhobenem Kinn und dem britischen Akzent wirkt sie eher wie eine der Touristenführerinnen als wie eine Demonstrantin, die hier monatelang für eine »neue Ukraine« kämpfte. Mit dem Smartphone in der rechten Hand gestikulierend zeigt sie über den zentralen Platz. Überall seien Protestzelte gewesen, sagt sie vor einer Reihe Springbrunnen. Touristen posieren vor Blumenbeeten, wo damals die Barrikaden standen. Anstatt Protest herrscht heute Jahrmarktstimmung. »Freedom is our religion« steht auf einem Banner, das über die Vorderseite eines Hochhauses gespannt wurde. Während der Proteste brannte das ehemalige Gewerkschaftsgebäude komplett ab. Früher sei es ein Ort gewesen, wo Verletzte versorgt wurden, heutzutage werde es für Kiews Stadtmarketing genutzt, sagt Kostyna. Auf einer Anhöhe über dem Maidan habe sie mit anderen nächtelang für bis zu 15 000 Menschen gekocht, erzählt sie und legt ihre Hand auf die Säulen des kapellenartigen Gebäudes, als könnte sie die Kälte noch fühlen.
An den Steinwänden hängen vergilbte Bilder von Getöteten, darunter liegen Plastikblumen. »Wir haben uns an die Opfer gewöhnt. Wir haben aufgehört, ihre Namen zu nennen«, sagt Kostyna. Für sie in Kiew, rund 700 Kilometer vom Krisengebiet im Osten entfernt, sei der Krieg fast nur noch durch die spürbar, die zurückkommen. »Wir sind 300 000 mit der gleichen Erfahrung gegenüber 40 Millionen ohne«, beschreibt sie die Schwierigkeiten derer, die dort waren: Binnenflüchtlinge, ehemalige Soldaten und Freiwillige wie sie selbst. Zum 18. Geburtstag schenkten ihr Freunde eine schusssichere Weste. Ein Jahr später arbeitete sie im Konfliktgebiet, bis sie sich dazu entschied nicht länger eine »Heldin« sein zu wollen. »Es ist nicht meine Aufgabe, im Krieg zu sterben, sondern etwas anderes mit meiner Erfahrung zu machen«, sagt sie, als ihr Handy klingelt. »Ein Meeting.«
Ihr Studium gab sie auf, um sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie die Menschen in der Ukraine mit ihren Erfahrungen der vergangenen Jahre umgehen. Mittlerweile ist sie stellvertretende Leiterin der NGO Pobratymy. Die Organisation leistet Traumaarbeit, gibt Vorlesungen und bietet Trainings für Rückkehrer und Betreuer an, versucht aber vor allem, die Vorurteile gegenüber Kriegsveteranen zu entkräften – durch Filme, Kunst und Vorträge. »Eigentlich müsste die Regierung psychologische Betreuung gewährleisten«, so Kostyna. Doch die Kapazität oder der politische Wille dafür fehle. Für Kostyna geht es nicht nur um das individuelle, sondern um das kollektive Trauma in der Ukraine, auf das die Regierung bisher keine Antwort habe.
Wo die Veteranen kochen
Das Problem, junge Soldaten wieder in die Gesellschaft zu integrieren, verband Leonid Ostaltsev mit einer Geschäftsidee: Er eröffnete eine Pizzeria für Kriegsrückkehrer und schuf damit eine der zivilen Anlaufstellen für Veteranen. Nur vereinzelt verirren sich Touristen in das Restaurant in Laufnähe zum Maidan. Die Wände des Restaurants sind mit Militärabzeichen, einer riesigen Kalaschnikow und einer Bildergalerie mit blau-gelben Emblemen behangen. Auf gläsernen Tischplatten, unter denen Patronen zur Schau gestellt werden, essen die Gäste Pizza. Es riecht nach gebackenem Käse und frischem Holz. Am Tresen warten vereinzelte Paare auf einen freien Tisch. Das Emblem der Pizzeria, ein grinsender Mann mit Schnurrbart vor einem Camouflagehintergrund mit dem Schriftzug »Pizza Veterano«, könnte auch eine hippe Bar in Berlin zieren. Doch an diesem Ort werden Kriegserfahrungen verarbeitet.
Inmitten seiner Gäste sitzt Ostaltsev. Zurückgelehnt und die Hände auf seinem Bauch verschränkt wirkt er eher wie ein Tätowierer aus dem Viertel als der Manager einer Franchise-Kette mit mehr als 33 000 Likes auf Facebook. Immer wieder grüßt er Hereinkommende. Seine Kunden nennt er »Gäste«, seine Angestellten »Freunde«. Fast alle seiner etwa 100 Angestellten sind Kriegsveteranen. »Ich fühle mich mit ihnen wohler als mit normalen Angestellten«, sagt Ostaltsev und steckt sich die zweite Zigarette in Folge an. »Ich weiß, wie es den Jungs geht.«
Im Juni 2014 wurde der damalige Koch Ostaltsev eingezogen. Ein Jahr lang diente er bei der »Antiterroroperation« (ATO) in der Ostukraine. Zurück in Kiew gründet er mit Hilfe eines Grundkurses in Geschäftsführung und 150 US-Dollar Startkapital ein Unternehmen. Neun Kaffeeläden, drei Restaurants und ein Brownie-Café führt der 30jährige mittlerweile. »Ich wollte den Leuten zeigen, dass die Ukraine mehr als nur Kriegsgebiet ist und wir Veteranen coole Typen sind, die unser Land verändern können«, sagt der Jungunternehmer. Der Kaffee auf dem Tisch ist schon kalt. Ohne Pause erzählt er seine Geschichte, wie schon vielen Investoren, Gästen und Journalisten. Im Gang hängt eingerahmt ein Bericht der New York Times. Sein Lebensmotto sei es, nicht auf Hilfe zu warten. »Niemand schuldet mir etwas, ich muss die Dinge selbst tun«, sagt der ehemalige ATO-Soldat, der seinen Aussagen zufolge bislang keinerlei Unterstützung von der Regierung erhalten habe.
Nicht jedem gelingt das Zurückkehren so gut wie Ostaltsev. Einem Bericht der Weltbank zur Situation von Veteranen und Binnenflüchtlingen in der Ukraine vom Mai zufolge sind 23 Prozent der Kriegsveteranen nach ihrer Rückkehr erst einmal arbeitslos. Arbeitgeber nannten psychische Einschränkungen wie eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) als einen der Hauptgründe, warum sie eher zögern, einen Kriegsveteranen einzustellen. PTBS beschreibt nach der internationalen Klassifikation von Krankheiten (ICD-10) »eine verzögerte Reaktion auf ein belastendes Ereignis mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß«. Tatsächlich leiden viele Kriegsveteranen darunter, doch sie sind auch Vorurteilen ausgesetzt. Experten wie Markus Brunner, Professor für politische Psychologie, geben zu Bedenken, dass es problematisch sei, Traumatisierte als handlungsunfähige Opfer zu betrachten.
Dass viele Arbeitgeber zögern, jemanden anzustellen, der gerade aus dem Krieg kommt, weiß auch Ostaltsev aus eigener Erfahrung. Nach dem Krieg bleibe kaum Zeit zur Rehabilitation: »Die meisten müssen sofort arbeiten und Geld verdienen, um zu überleben.« Doch Arbeit zu finden, sei die größte Hürde. Arbeitslose würden in die Illegalität abwandern. Nicht nur deshalb sei sein Geschäftskonzept wichtig: In seinen Restaurants und Kaffeeläden arbeiten neben Kriegsrückkehrern zwei Psychologen. Zwei Mal in der Woche hätten alle seine Angestellten einen Pflichtbesuch: »Nur wenige reden freiwillig über ihre Erfahrung aus dem Krieg.«
Sport statt Gewalt
»Die Menschen gewöhnen sich an den Krieg, man muss damit klarkommen«, sagt Oleksandr Chub. Er sitzt heute zwei Tische weiter in der Pizzeria. Er habe auf See gearbeitet, als er das erste Mal von den Euromaidan-Protesten gehört und entschieden habe, zurück in die Ukraine zu gehen, erzählt der 30jährige. Am Anfang seiner Sätze stottert er etwas. Sie enden meist mit einem gepressten Lachen und einer rhetorischen Frage, als sei er es gewohnt, dass seine Erzählung bestätigt wird: »Ich wollte mittendrin sein, wenn etwas passiert, weißt du?« Freiwillig habe er sich für den Dienst an der Front gemeldet. Mit Worten wie Abenteuer, Stolz und Pflicht beschreibt er seinen Einsatz für die Privatarmee des »Rechten Sektors«, einer paramilitärischen rechtsextremen Gruppe. Bis zu »diesem einen Tag«: Er sei Teil der Truppe gewesen, die Ende Oktober 2014 den Flughafen Donezk gegen ostukrainische Separatisten verteidigte. »Es war der schlimmste und der schönste Tag meines Lebens«, sagt er. »Menschen starben, ein paar konnte ich retten.« Bei einem Schusswechsel verletzte eine Granate sein linkes Bein. Die Knochen werden mittlerweile von zwei 30 Zentimeter langen Metallstangen zusammengehalten.
Zwei Monate lang habe er nicht laufen können, ein halbes Jahr sei er auf Krücken gegangen, so Chub. Eines Tages sei an einer Kreuzung ein älterer Mann aus einem Auto ausgestiegen. Im Vorbeifahren habe Chub die Krücken des Mannes, die aus dem Auto herausragten, für Waffen gehalten und den Mann auf offener Straße zusammengeschlagen. »Ein Automatismus«, rechtfertigt er sich, »im Krieg musst du eben schnell reagieren, sonst gehst du drauf«. Natürlich seien das Züge einer PTBS, sagt er. Dass er für den »Rechten Sektor« kämpfte, lässt aber auch darauf schließen, dass er zuvor schon ein Aggressionsproblem hatte.
Wie Ostaltsev wartete er in diesen »dunkelsten Monaten« auf Unterstützung der Regierung. Bislang habe er keine Invalidenrente bekommen, so Chub. Die betreffende Resolution 416 unterscheidet nicht zwischen ATO-Veteranen und anderen Soldaten, die im Krieg für die Ukraine gekämpft haben. »Nur weil es ein Gesetz gibt, heißt das in der Ukraine nicht, dass du dich darauf berufen kannst«, klagt Chub. »Als Soldat wurde mir immer geholfen.« Seit seiner Rückkehr fühle er sich von der Regierung alleingelassen. Irgendwann habe er genug gehabt, seine Krücken weggeworfen und sei wieder auf das Fahrrad gestiegen, »weil es besser funktionierte als mit dem Laufen«. Was in den »dunkelsten Monaten« geholfen habe? »Darüber zu sprechen«, sagt er und lächelt, »und Sport natürlich.«
Chub bewarb sich für die »Invictus Games«, eine paralympische Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten. Der Rennfahrer wurde als einer von 15 aus 200 Bewerbern ausgewählt. Unterstützt wird das erste ukrainische Team vom Ministerium für Sport und Gesundheit. Die Tickets für den Wettbewerb in Toronto im September überreichte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg persönlich. Zwei Mal in der Woche trainiert Chub mit seinen Teammitgliedern. Ein Fitnessstudio in Kiews Touristengegend, zwischen Anwalts- und Ärztehäusern, stellt dem Team die Räume zur Verfügung. Im September möchte er mit seinem Team auf den Siegertreppchen in Toronto stehen. »Wenn wir eine Veränderung wollen, müssen wir unsere Körper einsetzen«, sagt er. Er möchte die Ukraine nun in einem ganz anderen Kampf auf der globalen Tribüne vertreten.
Noch kein Frieden
Um den andauernden Krieg im Osten des Landes geht es an diesem Tag nur 500 Meter vom Maidan entfernt im Ukraine Crisis Media Center, einem alternativen Pressezentrum. Auf Krücken läuft Andriy Lysenkodes, ein Sprecher des Verteidigungsministeriums, zum Podium, um die Neuigkeiten aus dem Osten des Landes vor fünf Journalisten zusammenzufassen. »Ich habe gute Nachrichten«, sagt er zu Beginn. »Keine Verwundeten oder Toten in den letzten 24 Stunden.« Nur zwei Mal sei die Waffenruhe gebrochen worden. Dann berichtet der Sprecher in Uniform vor einer rotmarkierten Landkarte von sieben Schusswechseln, der längste habe über eineinhalb Stunden gedauert. »Drei Verwundete wurden zu unseren deutschen Freunden geflogen.« In Militärkrankenhäusern in Berlin, Hamburg und Koblenz seien seit Beginn des Konflikts mehr als 80 Soldaten in Behandlung. Der heutige Tag sei noch einer der guten Tage.
Offiziell zählt die Ukraine seit Ausbruch des Kriegs 1,7 Millionen Binnenflüchtlinge, der »UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine« zufolge wurden fast 23 000 Menschen verletzt und 9 700 getötet. Fast täglich wird die 2015 mit den EU-Partnern ausgehandelte Waffenruhe des Minsker Abkommens gebrochen. Seit Beginn des Jahres zählte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 339 zivile Todesopfer – ein Anstieg um fast 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, vor allem in der Nähe größerer Städte wie Donezk. »Die Anhäufung von Waffen und Kräften in diesen Gebieten könnte auf eine bevorstehende Zunahme der Gewalt hindeuten«, warnt Alexander Hug, stellvertretender Leiter der Sonderüberwachungsmission in der Ukraine (SMM). Das Ukraine Crisis Media Center meldet mittlerweile, die Lage habe sich seit Ende Juli nach einigen Wochen der Ruhe wieder zugespitzt.






 Von Raqqa bis Bachmut
Von Raqqa bis Bachmut