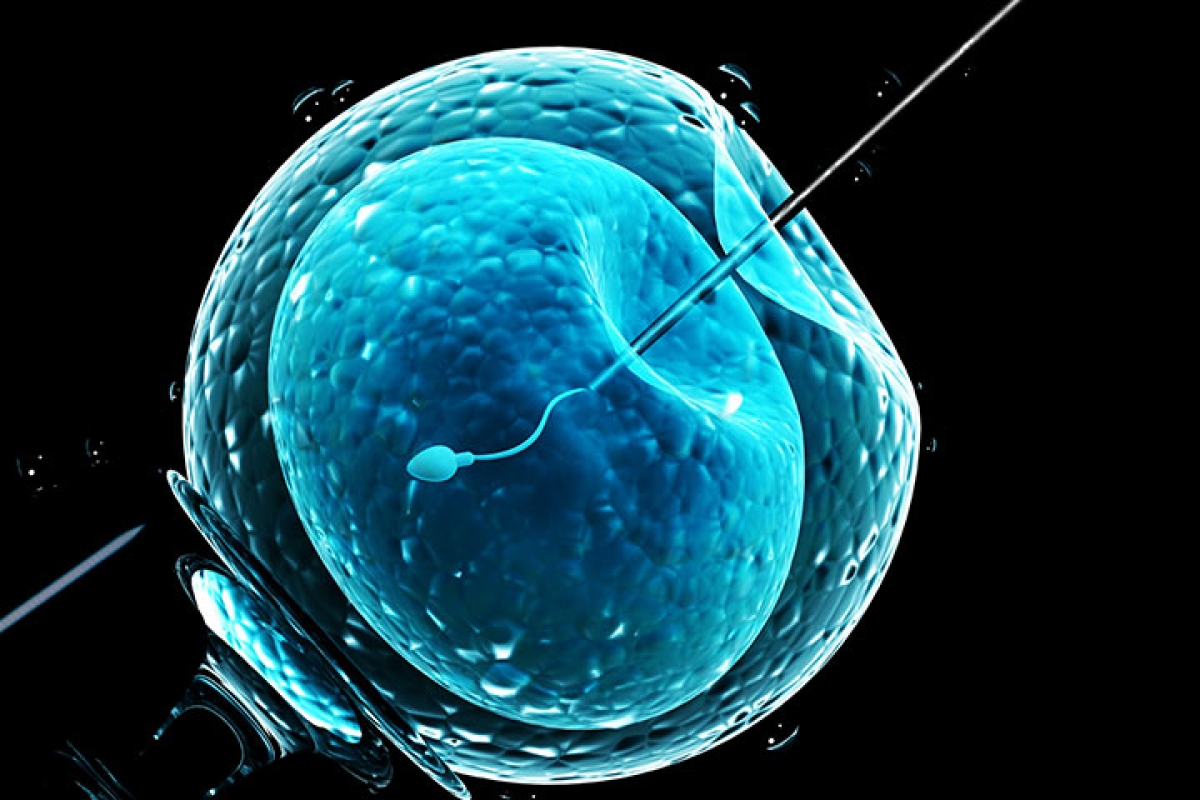»Reproduktive Autonomie ist ein Menschenrecht«
Sie beziehen sich in Ihrem Buch stark auf das Konzept der reproduktiven Autonomie. Können Sie das kurz umreißen?
Andrea Büchler: Reproduktive Autonomie ist ein normatives Konzept: Menschen sollen selbstbestimmt entscheiden können, ob, wann und mit wem sie Kinder bekommen. Lange Zeit stand die Freiheit von Fremdbestimmung im Vordergrund. Die Frauenbewegung kämpfte für den Zugang zu sicheren Methoden des Schwangerschaftsabbruchs und zu Empfängnisverhütung. Der Schwerpunkt der Debatte hat sich seitdem verschoben. Es geht heute stärker darum, inwiefern es auch einen Anspruch auf Zugang zu Technologien gibt, die dabei helfen können, einen Kinderwunsch zu verwirklichen. Dabei geht es nicht um ein Recht auf ein Kind, wie fälschlicherweise immer wieder gesagt wird, sondern darum, nicht daran gehindert zu werden, verfügbare Technologien zu nutzen. In diesem Zusammenhang steht auch die Frage, wer diese Technologien in Anspruch nehmen kann. Gleichgeschlechtliche und unverheiratete Paare oder alleinstehende Frauen sind etwa in der Schweiz vom Zugang zur Samenspende ausgeschlossen. Die reproduktive Autonomie ist ein Menschenrecht, das als Teil der persönlichen Freiheit verstanden werden muss. Eher konservative Strömungen wollen diese dagegen dem Schutz von Ehe und Familie zuordnen.
In feministischen Kreisen wird in letzter Zeit verstärkt das Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit diskutiert, das systematisch gesellschaftliche Bedingungen für Entscheidungen einbezieht. Es fokussiert nicht nur auf die Personen mit dem Kinderwunsch wie das Konzept der reproduktiven Autonomie. Warum haben Sie sich dagegen entschieden, dieses Konzept zu diskutieren?
A.B.: Dass wir reproduktive Autonomie als individualrechtliche Position vertreten, heißt ja nicht, dass gesellschaftliche Perspektiven keine Rolle spielen würden. Fragen der Gerechtigkeit und Menschenwürde, das Anliegen, Diskriminierung zu verhindern oder andere Personen zu schützen und das Kindeswohl zu wahren, können es rechtfertigen, die individuelle reproduktive Autonomie zu beschränken. Um festzustellen, ob diese jeweils vorliegen, muss man diese definieren und die jeweiligen Bedingungen untersuchen. Das tun wir in dem Buch.
Barbara Bleisch: Wir gehen relativ ausführlich auf das Konzept der relationalen Autonomie ein, das betont, dass wir immer auch verletzliche und abhängige Wesen sind, die sich in sozialen Kontexten bewegen. Dass Menschen keine »free-floating islands« sind, gilt natürlich besonders im Kontext der Reproduktion. Hier sind ja immer mindestens zwei erwachsene Menschen beteiligt, und es geht im Kern um ein werdendes drittes Wesen. So hilfreich das Konzept als ein Korrektiv eines zu individualistischen Konzepts von Autonomie ist, bleibt die Frage offen, was sich daraus konkret ableiten lässt, wenn wir entscheiden wollen, ob jemand von seiner reproduktiven Freiheit Gebrauch machen darf. Zumal Frauen ganz anders betroffen sind als Männer, weil auch ihre körperliche Integrität tangiert ist. Allerdings ist es durchaus richtig, insofern von biopolitischen Kontexten zu sprechen, als technologische Entwicklungen stets tief in die Gesellschaft eingreifen und Normvorstellungen sich dadurch verändern.

Barbara Bleisch ist Philosphin und Journalistin. Sie lebt in Zürich und ist Mitglied des Ethik-Zentrums der Universität Zürich. Andrea Büchler ist Professorin an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich und Präsidentin der Nationalen Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin der Schweiz. Zusammen haben sie das Buch "Kinder wollen Über Autonomie und Verantwortung" geschrieben, das im Mai bei Hanser erschienen ist.
Was sollte man dabei besonders beachten?
B.B.: Uns ist da vor allem die Frage der Routinisierung wichtig, also ob sich normative Vorstellungen dahingehend verändern, dass ein Druck auf Frauen entsteht, von bestimmten Technologien oder Prüfverfahren Gebrauch zu machen. Werden Technologien angeboten, ohne die Betroffenen hinreichend über die Risiken des Verfahrens und sich möglicherweise ergebende Entscheidungsnöte zu informieren, ist dies ganz klar zu kritisieren.
A.B.: Es reicht bei der reproduktiven Autonomie nicht, nur danach zu fragen, wo die äußeren Grenzen individueller Freiheit zu ziehen sind. Um reproduktive Autonomie ausleben zu können, benötigen die Menschen auch die Umstände, die ihre Wahrnehmung ermöglichen. Es reicht zum Beispiel nicht, ein Recht auf Schwangerschaftsabbruch zu haben, wenn gleichzeitig viele Hürden errichtet werden, die den Zugang erschweren oder verunmöglichen, zum Beispiel weil die nächste Klinik sehr weit entfernt ist oder die Finanzierung nicht gewährleistet ist. Wir vertreten ein Recht auf reproduktive Autonomie, das diese Bedingungen selbstbestimmter Entscheidungen in den Blick nimmt.
Es geht in den aktuellen Debatten sehr viel um die Legalisierung bestimmter Technologien. in ihrem Papier »Fortpflanzungsmedizin in Deutschland – für eine zeitgemäße Gesetzgebung« forderte beispielsweise die Leopoldina, die nationale Akademie der Wissenschaften in Deutschland, im vergangenen Jahr die Aufhebung des Verbots der Eizellabgabe in Deutschland. Ihr Buch scheint das auch zu befürworten. Was wären denn aber in Ihren Augen Gründe, um das Verbot einer Technologie aufrechtzuerhalten?
B.B.: Verbote sind legitim, wenn eine Technologie klarerweise schädigend, menschenverachtend oder ausbeuterisch ist. In vielen Fällen ist jedoch nicht die Technologie an sich das Problem, sondern es sind allenfalls die Umstände, unter denen sie zum Einsatz kommt. Wir müssen also die Frage stellen, was mit einem Verbot genau geschützt werden soll. Und dann gelangt man vielleicht zu einer Position wie der unseren: Gewisse Formen der Eizellspende, der Leihmutterschaft oder der selektiven pränatalen Diagnostik sind mit Sicherheit problematisch. Aber es sind auch Formen denkbar, in denen schützenswerte Motive vorliegen und Frauen nicht instrumentalisiert oder ausgebeutet werden. Ein Verbot kann nicht differenzieren – eine an klare Vorgaben geknüpfte Legalisierung schon.
Auch aus pragmatischen Gründen kann sich eine Aufhebung eines Verbots zugunsten einer Erlaubnis mit Auflagen empfehlen. Verbote führen oft dazu, dass die entsprechenden Dienstleistungen in anderen Ländern nachgefragt werden, wo wir keinen Einfluss darauf haben, ob es zu Ausbeutung oder Verletzungen der Menschenwürde kommt. Frauen besser schützen zu wollen, kann auch ein Motiv sein, eine Praxis kontrolliert im Inland zuzulassen.
Bei der These, dass es besser sei, diese Technologien geregelt zuzulassen, um damit den Reproduktionstourismus einzudämmen, bin ich skeptisch. Werden sich nicht viele Menschen mit Kinderwunsch aus den Ländern, in denen die Technologien unter hohen Auflagen legalisiert sind, diesen Wunsch trotzdem im Ausland erfüllen? Etwa weil unter reglementierten Bedingungen Wartezeiten für Eizellen entstehen oder die Kosten viel höher sind als in anderen Ländern. Ist das nicht ein Dilemma, dass hohe Auflagen diesen Reproduktionstourismus dann eben nicht eindämmen oder verhindern?
A.B.: Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Für viele dieser Technologien, vor allem für die Eizellspende und die Leihmutterschaft, braucht es unbedingt eine internationale Verständigung und entsprechende Abkommen, welche die Standards definieren.
B.B.: Eine liberalere Regelung, die sinnvollerweise an hohe Auflagen geknüpft ist, hat leider tatsächlich nicht unbedingt den Effekt, dass es einige nicht weiterhin attraktiver finden, entsprechende Dienstleistungen in anderen Ländern nachzufragen, wo keine Auflagen erfüllt werden müssen. Ein Verbot bei uns macht die Situation der entsprechenden Frauen im Ausland aber auch nicht besser.
Sie bezeichnen in Ihrem Buch den Kinderwunsch als existentiell. Die Art, wie Menschen mit ihren Wünschen umgehen, verändert sich aber sehr dadurch, welche Mittel zu deren Erfüllung bereitstehenzustehen scheinen. Lässt man sich nicht von der technologischen Entwicklung den Rhythmus der Debatten diktieren?
B.B.: Es ist eine alte Erkenntnis nicht nur, aber auch der Frauenbewegung, dass unheilvolle Allianzen entstehen, wenn technologische Entwicklung und ökonomische Anreizsysteme Hand in Hand gehen. Wenn die Entwicklung der Reproduktionstechnologie hauptsächlich dazu dient, Nachfrage für eine Industrie zu generieren und Geld zu verdienen, dann ist dies in aller Schärfe zu kritisieren. Wenn dies zudem auf dem Rücken von Frauen geschieht, die verunsichert zurückbleiben und nicht mehr wagen, sich auch gegen gewisse Technologien zu entscheiden oder für ein Kind mit besonderen Bedürfnissen, dann gilt das umso mehr.
Umgekehrt darf nicht vergessen werden, dass viele Technologien auch positive Auswirkungen haben, etwa Frauen geholfen haben, ihren Kinderwunsch zu verwirklichen, und dass Geburten sicherer geworden sind. Einige befürchten dennoch, dass wir Entwicklungen, die wir einmal losgetreten haben, nicht mehr aufhalten können. Der Risikoforscher Ulrich Beck hat mal gesagt, die Ethik und das Recht seien wie eine Fahrradbremse an einem Flugzeug. Das ist ein gutes Bild dafür, dass wir dazu tendieren, die kritischen Stimmen zu spät einzubeziehen. Diese Sorge entbindet uns aber nicht davon, diese Debatten gesellschaftspolitisch mit aller nötigen Sorgfalt und Genauigkeit zu führen.