Die Niederlage des Westens
Am 11. September 2001 jubelten Jihadisten in aller Welt: 19 al-Qaida-Kader töteten Hunderte Flugzeugpassagiere und sich selbst, um Tausende an ihren Arbeitsplätzen im World Trade Center und im Pentagon zu ermorden. Die zu dieser Zeit den größten Teil Afghanistans beherrschenden Taliban weigerten sich, die für dieses Inferno verantwortlichen al-Qaida-Führer auszuliefern. Deshalb begannen Großbritannien und die USA im Oktober 2001 ihre erste Militäroperation in Afghanistan und verjagten die Islamisten aus Kabul.
Der Fehler der Nato-Alliierten bestand nicht darin, gleichzeitig al-Qaida und die Taliban zu bekämpfen. Ihr Fehler war, dass sie dies weder konsequent noch zielgenau taten.
20 Jahre später jubeln Jihadisten in aller Welt erneut: Während des Rückzugs der USA und ihrer Verbündeten haben die Taliban Afghanistan überrannt. Sie wurden von Islamisten aus Tschetschenien und Usbekistan sowie von Kadern al-Qaidas und des »Islamischen Staats« unterstützt. Gemeinsam befreiten sie ihre Mitkämpfer aus den Gefängnissen und eroberten Kabul zurück.
Diese Demütigung des Westens ist ein Debakel für die Welt. Erstens beweist der Sieg der Islamisten: Terror lohnt sich! Man kann mit Geduld auch den stärksten Feind zermürben und aus einer Position der Stärke heraus zu Verhandlungen zwingen. Zweitens hat der Westen diesen Krieg gegen den mörderischen Islamismus nicht einfach beendet, sondern politisch und militärisch verloren. Und drittens ist der Vertrauensverlust immens: Der Westen verrät derzeit all diejenigen, die an seine Versprechen geglaubt und sich in Afghanistan für Freiheit und Menschenrechte eingesetzt haben.
Wie sind der Sieg der Taliban und ihrer Unterstützer über das stärkste Militärbündnis der Welt und der desaströse Abzug des Westens aus diesem Land zu erklären?
Weltanschauungskrieger
Der Westen hat sich in Afghanistan nicht »hoffnungslos überhoben«, wie es nun häufig heißt, sondern die Taliban vollständig unterschätzt. Deren Kader sind keine »Steinzeitislamisten« oder »Motorradbanden«, wie es oftmals verharmlosend heißt, sondern moderne Weltanschauungskrieger, die geduldig und taktisch flexibel auf ihr strategisches Ziel hinarbeiten: die Errichtung einer rigiden Sharia-Herrschaft zunächst in Afghanistan, dem Anspruch nach aber weltweit. Ihr Repertoire ist vielfältig: Es umfasst keineswegs nur Waffengewalt, sondern zum Beispiel auch zahlreiche Internetseiten und eine starke Präsenz bei Telegram und Whatsapp sowie kalkulierte außenpolitische Vorstöße.
Ihren größten Erfolg erzielten die Taliban jedoch mit Selbstmordattentaten, dem schlimmsten denkbaren Terror. Diese Kampfform erzeugt Angst und bewirkt, dass Soldaten hinter jedem Zivilisten einen Mörder vermuten. Die alliierten Streitkräfte waren vor allem auf den Selbstschutz konzentriert und konnten folglich bei der Bevölkerung kaum um Vertrauen werben. Die Taliban hingegen hatten ein leichtes Spiel. Sie verbreiteten, wo sie herrschten, Angst und Schrecken, konnten aber zugleich ein gewisses Maß an Sicherheit garantieren und verschafften sich so Sympathien in der Bevölkerung.
Gegen das Instrument des Selbstmordattentats hatten die Verantwortlichen der Nato kein Konzept – sie gaben sich mit der Truppenstationierung und gelegentlichen Drohneneinsätzen zufrieden. Man erwies sich insbesondere als unfähig, Strategien zu entwickeln, die sich auch auf den Islam beziehen. So verzichteten die Alliierten auf den Versuch, Islamgelehrten Gehör zu verschaffen, die Selbstmordattentate als Verstoß gegen den Koran verdammen.
Ihr Fehler bestand nicht darin, gleichzeitig al-Qaida und die Taliban zu bekämpfen. Ihr Fehler war, dass sie dies weder konsequent noch zielgenau taten; dass sie nie wirklich gegen die ideologische Quelle des Terrors vorgingen. Das hatte Folgen.
Angeblich kein Krieg…
Insbesondere in Deutschland wollte man über Jahre hinweg von »Krieg« in Afghanistan nichts wissen, wie eine Episode aus dem Jahr 2008 illustriert. »Wir befinden uns im Krieg gegen einen zu allem entschlossenen, fanatischen Gegner«, sagte der damalige Vorsitzende des Bundeswehrverbands, Bernhard Gertz, der Neuen Osnabrücker Zeitung. Er hatte recht. Doch das Verteidigungsministerium widersprach sofort: Die Bundeswehr befinde sich in Afghanistan nicht im Krieg. »Ich verstehe unter Krieg etwas anderes«, sagte der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Jung (CDU) bei einem Besuch in Kabul. Im Kern gehe es darum, Sicherheit zu gewährleisten und so den Aufbau des Landes zu ermöglichen.
Das entsprach dem Willen der Bundesregierung. »Vor allem Deutschland« habe den Ansatz gewählt, »den Schwerpunkt auf den Bereich ziviler Wiederaufbau zu legen und Militär nur dann einzusetzen, wenn es unbedingt nötig« sei, berichtete 2013 die Zeitschrift Internationale Politik. Glaubte man, damit bei den Taliban punkten zu können?
Zuletzt diente die Anwesenheit der Bundeswehr hauptsächlich dem Zweck, den USA Bündnistreue zu demonstrieren. »Mehr als ein Symbol ist das nicht«, bemerkte im März 2020 die FAZ. »Wenn der amerikanische Oberkommandierende in Kabul deutsche Truppen für schwierige Missionen anderswo anfragt, bekommt er stets Absagen.«
Man fragt sich also, was das strategische Ziel des Bundeswehreinsatzes war. Was wollte man im Hinblick auf al-Qaida und die Taliban erreichen? Deckten sich die Ziele der Regierung in Berlin mit den Absichten der USA? Und vermied man Begriffe wie »fanatische Gegner«, um mit den Taliban im Gespräch bleiben zu können?
… stattdessen Dialog
Bereits 2005 suchte Deutschland unter Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) den Dialog mit den Taliban. In diesem Jahr kamen in Zürich Vertreter des Bundesnachrichtendiensts (BND) wiederholt mit Delegierten der Taliban zusammen. Wie der Spiegel später berichtete, bot die deutsche Regierung bei dieser Gelegenheit Wirtschaftshilfen an, falls die Taliban bereit seien, sich von al-Qaida zu lösen. Das aber wollten die Islamisten nicht. »Ziviler Wiederaufbau (…) sei den Taliban nicht wirklich wichtig«, resümierten die Agenten des BND. Damit war über die diesbezügliche Haltung der Taliban eigentlich alles gesagt.
Dennoch rief 2017 gar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die afghanische Regierung bei einem Besuch im Feldlager der Bundeswehr in Mazar-i-Sharif zu einer »politischen Verständigung« mit ihrem Todfeind, den Taliban, auf. Dieses Jahr wurde die Naivität dieses Appells noch überboten. Außenminister Heiko Maas (SPD) gab sich im April bei einem Besuch in Afghanistan davon überzeugt, dass den Taliban daran gelegen sei, »dafür zu sorgen, dass dieses Land eine gute Zukunft hat«. Diese Worte führen erneut vor Augen, wie viel die deutsche Außenpolitik von der Deobandi-Doktrin verstanden hat – jener radikal islamistischen Lehre, auf der die Ideologie der Taliban aufbaut, die alles Westliche hasst und den Krieg gegen die Ungläubigen zur obersten Maxime erklärt.
Erst nach dem Einmarsch der Taliban in Kabul räumte Maas ein: »Wir alle – die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft – wir haben die Lage falsch eingeschätzt.« Und weiter: »Wir werden viele, auch grundsätzliche Fragen in der Zukunft stellen und auch beantworten müssen.« Ob auch der illusionäre Versuch, mit den Taliban in Dialog zu treten, überprüft werden wird?
Trumps Ausstiegsplan
In den vergangenen Jahren hatten die Taliban weiter Terror und bewaffnete Kämpfe genutzt, um ihre Position zu stärken. Für die US-Regierung unter Präsident Donald Trump kam es nicht in Frage, weiterzumachen wie bisher. Verständlicherweise – immerhin hatte die US-Armee etwa 2 400 gefallene und 20 000 verletzte Soldaten zu beklagen. Warum sollte man ohne Aussicht auf einen Sieg über die Taliban das Leben weiterer US-Amerikaner aufs Spiel setzen? Also begann die Supermacht 2018, mit einer Terrorgruppe zu verhandeln.
Dann aber stellte sich heraus, dass es Trump weniger um ein gutes Verhandlungsergebnis ging als vielmehr darum, Afghanistan um jeden Preis so schnell wie möglich zu verlassen. Diese Ungeduld wussten die Taliban für sich zu nutzen; das Verhängnis nahm seinen Lauf. Das am 29. Februar vorigen Jahres von den USA und den Taliban unterzeichnete »Abkommen von Doha« ist ein Dokument der Schande: Hier ging die Supermacht vor der Terrorgruppe in die Knie.
Das offenbart bereits der Titel des Dokuments: »Abkommen, um Frieden nach Afghanistan zu bringen, zwischen dem Islamischen Emirat Afghanistans, das von den Vereinigten Staaten als Staat nicht anerkannt wird und als Taliban bekannt ist, und den Vereinigten Staaten von Amerika«. Dieser überlange Titel zeichnet sich gleichwohl durch eine Leerstelle aus: Die gewählte afghanische Regierung kommt darin nicht vor. Auch in dem vierseitigen Text des Abkommens wird der wichtigste US-amerikanische Bündnispartner im Land nicht ein einziges Mal erwähnt. So hatten es die Taliban verlangt, so wurde es gemacht. Mit diesem Separatabkommen hatten die USA die afghanische Regierung bereits 18 Monate vor ihrem Sturz verraten und die Weichen für den jüngsten Vormarsch der Taliban gestellt.
Zweitens versprachen die USA in dem Abkommen, sich für die Abschaffung von Sanktionen gegen die Taliban und für die Freilassung von bis zu 5 000 inhaftierten Islamisten im Austausch gegen bis zu 1 000 von den Taliban festgehaltene afghanische Soldaten einzusetzen. Im Gegenzug versprachen die Taliban, Gruppen wie al-Qaida von antiwestlichen Angriffen abzuhalten – dies allerdings nur in den von ihnen kontrollierten Gebieten und auch nur bis zur Etablierung einer neuen Regierung in Kabul.
Wie es um das tatsächliche Verhältnis zwischen den Taliban und al-Qaida steht, belegt ein Bericht an den UN-Sicherheitsrat von Mitte Juli dieses Jahres. Diesem zufolge hatten sich die Taliban selbst noch während ihrer Verhandlungen mit den USA »immer wieder mit al-Qaida ausgetauscht – und zugesichert, dass sie die historische Bande zwischen beiden Gruppen ehren wollen«, wie die FAZ zitierte. Zudem sei al-Qaida »in mindestens 15 der 34 Provinzen Afghanistans präsent«; es gebe Anzeichen, dass sie »im Schatten und unter dem Schutz der Taliban langsam stärker werden«.
Das Abkommen ist drittens ein selektiver Nichtangriffspakt: Die USA sagten zu, bis zum 1. Mai dieses Jahres all ihre Soldaten, Ausbilder, Techniker, Berater und das militärische Wartungspersonal aus Afghanistan abzuziehen. Als Gegenleistung stellten die Taliban zwar ihre Angriffe auf die internationalen Truppen ein. Gleichzeitig konnten sie aber, da die Alliierten mit dem Abzug beschäftigt waren, den Krieg gegen ihre innerafghanischen Feinde eskalieren.
So, wie die Taliban erst ihre Macht in den ländlichen Gebieten sicherten, um anschließend Kabul zu stürmen, werden Islamisten irgendwo auf der Welt wohl früher oder später erneut auch westliche Metropolen angreifen.
So töteten die Taliban nach Angaben der britischen Tageszeitung The Times in den elf Monaten, die dem Doha-Abkommen folgten, 8 574 Sicherheitskräfte der afghanischen Regierung, mehr als 25 pro Tag. Seit November vorigen Jahres konzentrierten sich die Terroristen zudem auf die gezielte Ermordung von Angehörigen der Intelligenz, die man noch vor der Gründung des Islamischen Emirats loswerden wollte: Journalisten, Menschenrechtler, Richter, Universitätsdozenten, Künstler.
Völlig zu Recht bewertete Mullah Hibatullah Akhundzada, der Führer der Taliban, das Doha-Abkommen als einen »bedeutsamen Meilenstein« und »großartigen Sieg«: Es sei »der kollektive Sieg der gesamten muslimischen und den Jihad ausübenden Nation«, verkündete er am Tag der Unterzeichnung. Diese Rede ließ Akhundzada am 29. Februar vorigen Jahres auf der offiziellen Website der Taliban auch in englischer Sprache verbreiten. Offenkundig gab es aber weder in Berlin noch in anderen westlichen Hauptstädten Regierungsberater, die fähig oder willens waren, dieses Dokument zur Kenntnis zu nehmen und richtig zu deuten. Andernfalls hätten spätestens ab diesem Zeitpunkt Evakuierungspläne für EU-Bürger und deren afghanische Helfer erarbeitet werden müssen.
Bidens Vollzug
Im April entschied die US-Regierung unter Präsident Joe Biden, an dem schändlichen Doha-Abkommen festzuhalten und mit dem Truppenabzug am 1. Mai zu beginnen. Dieser sollte – schwarzer Humor im Weißen Haus – bis zum 11. September abgeschlossen sein. Nach dieser US-amerikanischen Entscheidung beschlossen auch die Mitglieder des Nato-Rats – einige von ihnen unter Protest –, alle sonstigen Truppen abzuziehen, ohne dies von Gegenleistungen der Taliban abhängig zu machen.
Sein Plan sei im nationalen Interesse, versicherte Biden, da die Taliban andernfalls ihre Angriffe auf US-Soldaten wiederaufnehmen würden. Gewiss. Doch der Preis, den Biden für die Unversehrtheit seiner Soldaten – für dieses America first! – zu zahlen hat, ist hoch: Er liefert den Rest der afghanischen Bevölkerung dem Terror der Taliban aus und ruiniert den Ruf der USA.
Noch im Juli begründete Biden seine Entscheidung mit der Stärke der afghanischen Streitkräfte, die den Beistand durch US-Streitkräfte nicht länger benötigten. Nachdem sich diese Einschätzung als Illusion erwiesen hatte, stellte Biden seine Argumentation auf den Kopf und sagte, dass gerade das Versagen dieser Streitkräfte seine Entscheidung legitimiere. Warum, so Biden, sollten die USA einem Land beistehen, dessen Armee sich nicht einmal selbst verteidigen kann?
Er vergaß zu erwähnen, dass zuvor fast 70 000 afghanische Soldaten ihren Kampf gegen die Taliban mit dem Leben bezahlt hatten. Zudem war das Kriegsgerät, das die USA an ihre afghanischen Verbündeten geliefert hatten, zu 80 Prozent von US-Amerikanern gewartet worden. Als die Offensive der Taliban begann, war vom Wartungspersonal der USA nichts mehr zu sehen, weshalb viele der Waffensysteme ausfielen. Und warum sollten afghanische Soldaten für eine Regierung sterben, die die USA bereits seit Beginn der Doha-Gespräche de facto aufgegeben hatten?
Bidens auf Afghanistan gemünzte Bemerkung, dass die USA nicht »jedes einzelne Problem der Welt mit Gewalt lösen« könnten, verweist auf den Irrtum seiner Politik: Es handelt sich bei den Taliban nicht um ein »einzelnes Problem«, sondern um einen Vorposten des globalen Jihad.
Zwar sucht der islamistische Terror die westlichen Metropolen nicht mehr so stark heim wie noch vor zehn Jahren, dafür wütet er jedoch auf dem afrikanischen Kontinent umso mehr, unter anderem in Mali, Burkina Faso, Kenia, Mosambik, Somalia, dem Kongo und in Nigeria – allein in diesem Land haben Islamisten seit 2009 rund 40 000 Menschen getötet und zwei Millionen, darunter 500 000 Kinder, in die Flucht getrieben.
Man hat es nicht mit einem Bürgerkrieg oder einem einzelnen Problem zu tun, sondern mit einem globalen Krieg radikaler Islamisten gegen die Zentren der Aufklärung. So, wie die Taliban erst ihre Macht in den ländlichen Gebieten sicherten, um anschließend die Provinzhauptstädte und Kabul zu stürmen, werden es die Islamisten wohl nicht bei Ländern des globalen Südens belassen, sondern früher oder später erneut auch westliche Metropolen angreifen.
Mit dem afghanischen Debakel hat der Kampf gegen den globalen islamistischen Terror einen herben Rückschlag erlitten. Er ist gleichwohl weder beendet, da die Terroristen weiter zuschlagen werden, noch verloren. Wird man aber in den westlichen Metropolen die notwendigen Lehren aus den Katastrophen von 2001 und 2021 ziehen?





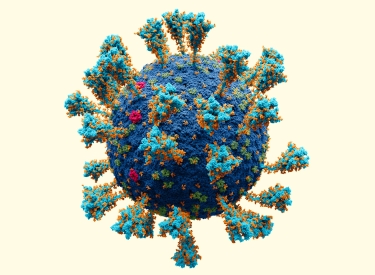
 Noch lange nicht zu Ende
Noch lange nicht zu Ende