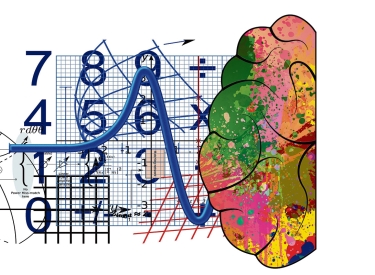Es gibt keinen richtigen Sport im falschen
Mit Abscheu blicken wir auf die Zeiten zurück, als Mord und Totschlag noch als Volksvergnügen galten. Dass Menschen nicht mehr vor einem begeisterten Publikum abgeschlachtet werden, wird gerne als Beleg dafür angeführt, dass Zivilisierung eben doch kein leeres Versprechen sei. Aber wie jeder Fortschritt in der Vorgeschichte ist auch dieser prekär. Gut möglich, dass kommende Generationen mit dem gleichen Ekel, den wir über die Gladiatorenkämpfe im Kolosseum empfinden, auf das zurückschauen werden, was sich heutzutage in den Stadien abspielt.
Die öffentliche Inszenierung des Körpers ist immer ambivalent, schwankend zwischen Bewunderung und Sadismus. Sport ist die Zurschaustellung, wozu Muskeln, Hirn und Nerven fähig sind, wenn ihnen alles abverlangt wird: Je mehr die Beteiligten Kopf und Kragen riskieren, desto größer der schließliche Triumph. Dass Fans ihre Helden leiden sehen wollen, liegt ebenso in der Logik der Sache wie die Großaufnahme des schmerzverzerrten Gesichts. Nicht immer mag man sich das eingestehen, und manche Sportarten machen es den Zuschauern vergleichsweise leicht, diesen Zusammenhang zu verdrängen. Beim American Football, dessen Faszination gerade auf dem Zusammenspiel von Grazie, Geistesgegenwart und roher Gewalt beruht, liegt er offen zutage. Das macht es leicht, ihn zum Sinnbild einer misslungenen Kultur abzustempeln. Zu den Evergreens des Antiamerikanismus gehört das Naserümpfen über die eigenwilligen Sportarten, die »nur in Amerika« hätten entstehen können: Baseball sei bloß langweilig, Football aber schlichtweg barbarisch.
Die USA sind darin einzigartig, dass ein Massenmarkt für strikten Amateursport existiert: College Football, wie er seit dem späten 19. Jahrhundert gespielt wird, ist extrem populär, und nicht nur in Bundesstaaten wie Alabama oder Oklahoma, wo kein Profiteam ansässig ist.
Was empirisch schwer zu bestreiten ist. Seit Jahren warnen Mediziner vor den neurologischen Spätschäden durch wiederholte Gehirnerschütterungen. Der Helm, der die Spieler vor Schädelfrakturen schützt, taugt zugleich perfekt als Waffe, sowohl für den ballführenden Spieler, der mit dem Kopf voran versucht, die Verteidigung zu überlaufen, als auch für die Verteidiger, die ihn zu Boden bringen müssen. Ob allerdings Football wirklich so viel ruinöser für die Gesundheit als Fußball, wo man ganz ungeschützt mit dem Kopf zum Ball geht, oder auch Sportarten wie Radrennen oder Rodeln ist, wo Stürze tödlich enden können, ist wissenschaftlich zumindest umstritten. Und ein Land, das Handball zelebriert, hat ohnehin wenig Grund, sich über Rohheit im Sport zu mokieren.
Der wirkliche Sonderweg besteht nicht in der physischen Beanspruchung, sondern in der institutionellen Organisation. Anders als beim Baseball, wo es neben der Major League auch die Minor Leagues gibt, besitzt die National Football League (NFL), die US-amerikanische Profiliga, keinen eigenen Unterbau. Für den Nachschub an Spielern sorgen nicht Vereine, sondern die Schulen und Universitäten. Die USA sind darin einzigartig, dass ein Massenmarkt für strikten Amateursport existiert: College Football, wie er seit dem späten 19. Jahrhundert gespielt wird, ist extrem populär, und nicht nur in Bundesstaaten wie Alabama oder Oklahoma, wo kein NFL-Team ansässig ist. Mannschaften wie die Georgia Bulldogs, die Ohio State Buckeyes oder die Michigan Wolverines verfügen über eine größere Anhängerschaft als die regionalen Pendants in der NFL und tragen ihre Heimspiele in Stadien aus, die Platz für mehr als 90 000 Zuschauer bieten – und so gut wie jeden Spieltag ausverkauft sind.
Das ist umso bemerkenswerter, als das Wettbewerbssystem zum Bizarrsten gehört, was sich überhaupt nur denken lässt. Colleges vereinbaren nach individuellem Gusto vor der Saison zwölf oder 13 Spiele, sowohl gegen ausgewählte Mannschaften aus der Conference, der sie angehören, als auch gegen Teams aus anderen Conferences – wobei einige Colleges, wie Notre Dame, gar keiner Conference angehören. Zum Abschluss der Saison werden dann besonders erfolgreiche Teams zu den rund um Silvester stattfindenden Bowl Games eingeladen. Jede Woche stimmen zudem Sportjournalisten für eine Rangliste der 25 besten Mannschaften, und lange durfte, wer am Ende der Saison ganz oben stand, sich anschließend »National Champion« nennen. Seit 2013 wiederum lädt ein Komitee der National Collegiate Athletic Association (NCAA), des Dachverbands für College-Sport, vier nach opaken Kriterien ausgewählte Teams zu Ausscheidungsspielen ein, die den nationalen Meister ermitteln sollen. Und weil auch das System immer wieder für Knatsch sorgt, hat man nunmehr beschlossen, die Anzahl der Playoff-Teams ab spätestens 2026 auf zwölf zu erhöhen.
Dass Football an den Schulen und Hochschulen entstand, entspricht historisch der Entwicklung von Fußball und Rugby an den englischen Eliteinternaten. Abhärtung galt als wichtiger Bestandteil der Erziehung zum Mitglied der herrschenden Klasse, und der Sport sollte zudem dafür sorgen, dass die Schüler ihre Energien nicht durch Masturbation verausgabten; in weniger zivilisierten Weltgegenden wie Deutschland erfüllte diesen Zweck die allgemeine Wehrpflicht. In Großbritannien freilich machte sich schon bald die Arbeiterklasse den Fußball zu eigen, und der aufkommende Professionalismus bescherte den aristokratischen Amateuren zumeist ein Nischendasein. In den USA hingegen waren es die Profi-Footballer, die ein Nischendasein führten: Die 1920 gegründete NFL blieb bis in die fünfziger Jahre im Wesentlichen auf den industrialisierten Nordosten beschränkt. Vielleicht, weil das Klassenprivileg, anders als in England, nicht auf eine winzig kleine adelige Kaste beschränkt blieb, konnte es auch weit länger prägend wirken: Bis heute dominiert beim Football, anders als bei Baseball und Basketball, im Publikum die Mittelschicht.
Zum Klassenprivileg gehört, dass man es sich leisten kann, Sport nicht um des Geldes willen zu betreiben. Die NCAA wacht geradezu zwangsneurotisch darüber, dass das Ideal des Amateurismus unbefleckt erhalten bleibt. Selbst ein als Belohnung für einen Sieg ausgegebenes Essen wird mit drakonischen Sperren geahndet. Mit der Wirklichkeit hat das selbstverständlich nichts zu tun. Was die Spieler antreibt, ist kein hehres Ideal, sondern die Hoffnung auf eine lukrative Profikarriere. Sie halten drei, vier oder fünf Jahre in den Universitätsteams ihre Knochen hin für eine minimale Chance – weniger als fünf Prozent aller College-Footballer schaffen es in die NFL, und noch weniger bleiben, angesichts einer durchschnittlichen Karrieredauer von nicht einmal vier Jahren, dort lange genug, um tatsächlich den großen Reibach zu machen.
Davon profitieren andere. College Football ist ein gigantisches Geschäft; zu den Zuschauer- und Fernsehgeldern kommen noch die Spenden Ehemaliger und die Bewerbungen neuer Studierender, wenn eine Siegesserie die Universität in die Schlagzeilen bringt. Die unbezahlte Arbeit mehrheitlich schwarzer Spieler sorgt dafür, dass die (fast durchgehend weißen) Trainer und Funktionäre sich eine goldene Nase verdienen: Der Head Coach eines College ist meist der mit Abstand bestbezahlte öffentliche Angestellte des entsprechenden Bundesstaats – und darf sich dafür aufführen wie ein Gottkönig.
Zur Rechtfertigung verweisen die Verantwortlichen gerne darauf, dass die Spieler zwar keine finanzielle Gegenleistung erhalten, dafür aber etwas weit Wertvolleres: ein kostenloses Studium. Angesichts der horrenden Studiengebühren sind die Sportstipendien, mit denen die talentiertesten High-School-Footballer geködert werden, in der Tat nicht zu verachten. Wer jedoch aus Verletzungsgründen oder wegen anderer Anlässe aus der Mannschaft fliegt, ist freilich auch sein Stipendium los; und erst 2011 wurde auf Druck der Regierung unter Präsident Barack Obama die bis dahin übliche Praxis, dass Stipendien Jahr für Jahr genehmigt werden müssen, abgeschafft. Der Anteil der Spieler, die ihr Studium mit einem Abschluss beenden, ist seither signifikant gestiegen; beim amtierenden Meister Georgia liegt er dennoch gerade einmal bei 59 Prozent. Erfolgreich Football zu spielen, ist auch am College de facto ein Vollzeitjob.
Seit Jahren wird daher gefordert, der Realität Rechnung zu tragen und die Athleten endlich zu entlohnen. Mit immerhin ersten Erfolgen: Zwar erhalten die Spieler weiterhin keine Prämien, verfügen aber seit dieser Saison, dank einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, zumindest über ihre eigenen Marketingrechte, dürfen also ihren Namen und ihr Bild zu Werbezwecken verkaufen. Kritiker unkten, dies werde die Diskrepanzen im Leistungsniveau nur noch weiter verschärfen: Bereits derzeit verteilten sich die besten Sportler vor allem auf jenes kleine Handvoll Colleges, das stets im Fokus der NFL-Scouts steht, und nun kämen auch noch pekuniäre Anreize dazu.
Möglich aber auch, dass genau das Gegenteil eintritt. Der umworbenste High-School-Spieler, der Cornerback Travis Hunter, jedenfalls entschied sich statt für eine der Spitzenmannschaften für Jackson State, eine der traditionell afroamerikanischen Hochschulen, welche sich die konsequente Umsetzung der neuen Regelung auf die Fahnen geschrieben hatte. Ein Star an einem sonst nicht eben mit Stars verwöhnten College kann, so das Kalkül, allemal die lukrativere Option sein: ein Beispiel für, wie Karl Marx sagen würde, den zivilisierenden Einfluss des Kapitals.