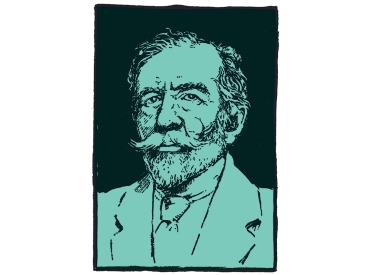Die Versöhnungsfalle
Das deutsche Haus rüstet sich zum Weihnachtsfest - dem Fest familiärer Harmonie und humaner Gesinnung. Klaus von Dohnanyi stellte die Frage, ob Martin Walser unter Umständen zur Versöhnung mit Ignatz Bubis bereit wäre; Walter Jens appellierte an Bubis, den an Walser gerichteten Vorwurf des "geistigen Brandstifters" zurückzunehmen. Der FAZ gelang schließlich, woran noch Bundestagspräsident Wolfgang Thierse und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels gescheitert waren: Walser und Bubis zu einem Gespräch zusammenzubringen - als Vermittler nahmen Salomon Korn, Mitglied des Zentralrats der Juden in Deutschland, und Frank Schirrmacher von der FAZ teil. Auf der Titelseite und im Feuilletonteil ist es dann als große Versöhnung inszeniert - schon die Fotos, die den Abdruck des Gesprächs begleiten, sind in dieser Weise angeordnet: Zu Beginn sitzen die Kontrahenten weit voneinander entfernt, dazwischen die anderen Teilnehmer als Pufferzone; am Ende nebeneinander bei einem Glas Wein und mit freundlicher Miene, einander förmlich zugeneigt.
Was man wollte, war klar: Bubis sollte mit Deutschland wiedervereinigt werden. In seinem Leitartikel sieht Schirrmacher in der Reaktion des Präsidenten des Zentralrats der Juden auf die Rede Walsers in der Paulskirche einen "explosiven Gehalt" und damit Handlungsbedarf für seine Zeitung: "Nichts anderes war nämlich damit gesagt, als daß sich die Spitzen des Staates und der Gesellschaft anläßlich einer rhetorischen 'Brandstiftung' begeistert von ihren Sitzen erhoben." Nun aber sei die Bombe glücklich entschärft: Bubis habe sein Wort vom "geistigen Brandstifter" zurückgenommen.
Walser hat nichts zurückgenommen. Im Gegenteil: Er konnte seine Position weiter ausbauen und sich als "verfolgende Unschuld" (Karl Kraus) in Szene setzen. Zunächst empört er sich über Bubis' Aussage, er habe mit seiner Rede einen Schlußstrich ziehen wollen: "Ich habe mich vielleicht mehr als jeder andere Autor meiner Generation ununterbrochen damit auseinandergesetzt (sic!) (...). Und, Herr Bubis, da muß ich Ihnen sagen, ich war in diesem Feld beschäftigt, da waren Sie noch mit ganz anderen Dingen beschäftigt."
Für die Eingeweihten ist dies ein deutlicher Hinweis auf die geschäftliche Tätigkeit von Bubis u. a. im Rahmen des Umbaus des Frankfurter Westend zum Banken- und Versicherungszentrum. So zart und verhalten äußert sich der deutsche Schriftsteller darüber, worin er die für den Juden Bubis vordringlichste Beschäftigung sieht. Statt aber Walser auf diese Unterstellung anzusprechen, öffnet sich Bubis: "Ich hätte nicht leben können. Ich hätte nicht weiterleben können, wenn ich mich damit früher beschäftigt hätte" - und Walser nutzt die Gelegenheit sofort, um mit seiner schönen Seele aufzutrumpfen: "Und ich mußte, um weiterleben zu können, mich damit beschäftigen." Auch sonst spielt der Empfindsame nur an, gibt versteckte Hinweise, spricht zu Eingeweihten, macht diskrete Andeutungen - so daß nicht alles offen bleibt, aber doch die Hintertüre, durch die er verschwinden kann, sobald ihm Antisemitismus vorgeworfen wird. Diese Zweideutigkeit, was die Einstellung zu den Juden betrifft, ist alte deutsche Künstler-Tradition - von Achim von Arnim über Richard Wagner bis zu Ernst Jünger. Und in dieser Hinsicht ist es logisch, daß Walser im Gespräch mit Bubis sich immer wieder auf den Status des Poeten zurückzieht: Es ist die sicherste Bastion, solange das Terrain nicht vollständig sondiert ist.
Hans J. Syberbergs Buch "Vom Unglück und Glück der Kunst in Deutschland nach dem letzten Kriege" von 1990 konnte noch als Spinnerei eines kuriosen Außenseiters abgetan werden - ähnlich wie zuvor Rainer Werner Fassbinders Darstellung des "reichen Juden" (im Stück "Der Müll, die Stadt und der Tod"). Walsers Rede von 1998 zeigt hingegen, daß deutschnationale Künstlerideologie wieder staatstragend werden und eine Avantgarde bilden kann, um das deutsche Nationalbewußtsein zu "befreien" von den Zwängen und dem Druck seiner äußeren und inneren "Feinde".
Mögen insbesondere nach dem FAZ-Gespräch auch einige Intellektuelle von Walser abrücken, umso näher kommt er seiner eigentlichen Klientel. Ein Walser dürfe aussprechen, was ein Kanzler nicht sagen dürfe, meinte Kanzler Gerhard Schröder. Der Poet als Medium des Unbewußten eines Volks: So begreift sich dieser Autor, wenn er sagt, er habe mit dem "Selbsterkundungssprachgebrauch eines Schriftstellers" gesprochen: "(Es) muß etwas gegeben haben, was ausdrucksbedürftig geworden ist." Und der Schriftsteller drückt eben aus, das ist sein Beruf in Deutschland - nicht aber das Denken.
Wie er auf die frühere Tätigkeit von Bubis nur anspielt, so weigert Walser sich auch, die konkreten Forderungen der Naziopfer beim Namen zu nennen - "weil ich diese Zusammenhänge nicht konkret kenne (...). Ich kenne nicht die Berechtigungen, ich kenne nicht die Widersprüche. Das ist einfach nicht mein Thema" -, spricht aber davon, daß Auschwitz für aktuelle Zwecke instrumentalisiert werde und prägt den poetischen Begriff von "Auschwitz als Moralkeule". Das ist sein Thema.
Im Grunde poetisiert Walser die Linie der Jungen Freiheit - mag er diese Zeitung nun kennen oder nicht. Sein Ausgangspunkt ist die Attacke auf political correctness: "Es ist ein Sprachgebrauch entstanden, in dem dem Gewissen Vorschriften gemacht werden, wie es an Auschwitz denken soll. Und das ist eine unerträgliche Vorschrift. Ich will mir nicht vorschreiben lassen, wie ich mich zu erinnern habe ( Ö), wie sich jeder einzelne in seinem Empfinden und in seinem Gewissen, in seiner Familie oder seinen Kindern gegenüber fühlt, das muß ihm überlassen bleiben (...). Jetzt kommt es darauf an, daß jeder sich selber damit beschäftigt. Ich glaube nicht, daß das Gewissen von jungen Menschen öffentlich, durch öffentliche Akte geschult oder entwickelt werden kann (...)." Das ist das Neue an Walser gegenüber Fassbinder oder Syberberg - und in Deutschland offenbar Voraussetzung für die staatstragende Rolle des Autors: Die Vergangenheit wird durch die Innerlichkeit, die schöne Seele, entsorgt. Günter Gaus hat dies erkannt, wenn er sagt, es habe immerhin ein Jahrzehnt nach der Wende gedauert, "bis ein prominenter Schriftsteller Auschwitz ins Private rückte und damit dem souveränen Deutschland die Last von den Schultern nahm. Das ist zwar ein Irrtum, aber er ist offenbar mehrheitsfähig."
Was Gaus jedoch als Irrtum verharmlost, ist in Wahrheit Index nationaler Politik auf demokratischer Basis. Die Zeit der Gedenkstätten ist in Deutschland demnach vorbei. (Ein Holocaust-Mahnmal ist für Walser ein Denkmal, das "so beschaffen ist, daß es Leute zur Schändung provoziert".) Nur im Inneren der Staatsbürgerseele läßt sich - solange die Ausländer und die Juden nicht zum Schweigen gebracht worden sind - das Holocaust-Mahnmal zu einem deutschen Heldenfriedhof umbauen.
"Mir ist ein freies Gewissen, das zu inakzeptablen Ergebnissen kommt, lieber als ein gebundenes Gewissen, das letzten Endes im Nachbeten von Wohlempfohlenen ein Auskommen findet." Worin nun diese inakzeptablen Ergebnisse konkret bestehen könnten, auch darüber schweigt der Dichter. Statt dessen spricht er immerfort von den Tausenden Briefen, worin ihm gedankt werde, ohne auch nur einmal etwas von den genauen Inhalten dieser Briefe zu sagen.
Hier dürfte sich wirklich - und in der adäquaten Form - bereits jene deutsche Innerlichkeit kundtun, die der empfindsame Autor beschwört und ausdrückt. Entrüstet weist er den Verdacht zurück, es könnten unter seinen Fans Antisemiten sein: "(Dann) sind die natürlich illegitim, und ich brauche diese tausend Briefe nicht ernst zu nehmen." Sollten Antisemiten wirklich existieren, so sind es Leute, die nicht ernst zu nehmen sind, sie gehören zum "Bodensatz von Ewiggestrigen (Ö), die jede europäische Gesellschaft nun einmal hat".
Mit Deutschland und dem Nationalsozialismus hat dies alles nichts zu tun - auch die Anschläge auf die Asylantenheime sind nicht zurückzubinden an diese Vergangenheit ("Asoziale, die in besonderer Hoffnungslosigkeit und familiärer ..."). Die deutsche Innerlichkeit sucht sich selbst aus jüdischen Quellen heraus, wovon sie "bewegt" werden möchte; in diesem Sinn zitiert Walser den Religionsphilosophen Jacob Taubes und bemerkt: Wer keine Wahl hat - wie die Juden im Falle Hitlers -, "ist auch im Urteil eingeschränkt. Das heißt, er kann nicht beurteilen, was die Faszination anderer ist, die stolpern, die rutschen, die wollen, die fasziniert sind". Die Juden sollen also schweigen, wenn vom Nationalsozialismus oder Antisemitismus die Rede ist. Davon verstehen sie nichts, können sie nichts verstehen.
Bei all dem fragt sich, wie Salomon Korn weiterhin von einer "individuellen, ehrlichen, aufrichtigen Haltung" Walsers ausgehen kann und dem Preisträger lediglich vorwirft, die Gefahr nicht zu sehen, "mißverstanden" zu werden: "Aber ein klärendes Wort, wäre das so schwierig gewesen, ein klärendes Wort?" - wo doch Walser angesichts solcher geradezu flehentlicher Bitten immer wieder mit Entschiedenheit festhält, von seinen Tausenden Briefschreibern eben nicht mißverstanden worden zu sein.
Noch mehr verwundert die unmotivierte Bemerkung Bubis: "(Wenn) alle Ihren Standpunkt so verstanden hätten, wie Sie ihn heute hier erklärt haben, dann hätte ich überhaupt keine Probleme, dann hätte ich keinen Mucks von mir gegeben" - und am Ende erklärt er: "Ich nehme es Ihnen ab, daß Sie die besten Absichten hatten. Aber die Wirkung bleibt die gleiche."
Allerdings fügt Bubis dann doch noch eine zweifelnde Bemerkung hinzu: "Ich bin mir nicht sicher, aber ich nehme es Ihnen ab, weil ich Ihnen nicht das Gegenteil beweisen kann." Es ist, als sei Bubis schlagartig klar geworden, daß er hier in die Falle der Versöhnung getappt und jenem "Mythos des deutsch-jüdischen Gesprächs" auf den Leim gegangen ist, über den Gershom Scholem einmal geschrieben hat: "Wo Deutsche sich auf eine Auseinandersetzung mit den Juden in humanem Geiste eingelassen haben, beruhte solche Auseinandersetzung stets, von Wilhelm von Humboldt bis zu George, auf der ausgesprochenen und unausgesprochenen Voraussetzung der Selbstaufgabe der Juden (...)." (Jungle World, Nr. 49/97)
In seinem Leitartikel, in dem dieser Mythos wie eine Trophäe präsentiert wird, stellt Schirrmacher die Suggestivfrage, "ob die Angst, mißverstanden zu werden, nicht das besorgniserregendste Symptom der deutschen Verhältnisse ist". Fragt sich nur, für wen. Die Angst, von der National-Zeitung mißverstanden zu werden, war für Bubis gewiß immer das erfreulichste Symptom der deutschen Verhältnisse, und ihr Verschwinden hat ihn wie ein Schock getroffen - diesen Schock spürt man auch noch bei der Lektüre des Gesprächs. Ihn kann Bubis nicht zurücknehmen. (Inzwischen hat Dohnanyi das deutsch-jüdische Gespräch seinerseits fortgesetzt und den humanen Geist noch intensiviert, indem er Bubis für die "Intoleranz" verantwortlich machte.) Jean Améry forderte vor über dreißig Jahren in dem Essay "Ressentiments", der so aktuell ist wie nie zuvor und gerade darum aus der Diskussion verschwunden, auf der Seite der Deutschen nichts anderes als "Selbstmißtrauen" - im individuellen ebenso wie im öffentlichen Bewußtsein. Das war der Dorn im Auge, den Martin Walser nunmehr beseitigt hat. Seine Rede in der Paulskirche fiel übrigens in etwa mit Amérys 20. Todestag zusammen. Die deutsche Öffentlichkeit, die Walser feierte, hat diesen Gedenktag ignoriert.



 Nazis am Nil
Nazis am Nil