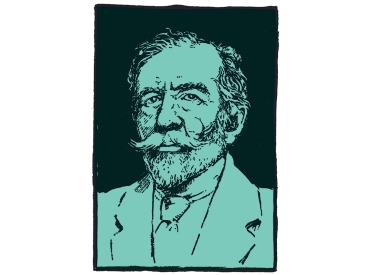Jackie Chan Superstar
"When Bruce Lee kicks high, I kick low. When Bruce Lee acts like a hero, I act like an underdog", beschreibt Jackie Chan seine Arbeitsweise, die ihn am Ende des ausgehenden 20. Jahrhunderts zum vielleicht erfolgreichsten Filmstar werden ließ. Seine Filme sind von den Philippinen bis in die Karibik ein Ereignis - um das zu erfahren, muß man sich nur in einem Land der Dritten Welt einmal ins Kino wagen. Dort gilt der kleine Asiate mit den flinken Fäusten als die späte Rache am amerikanischen Kulturimperialismus, aber wenn Chan so weitermacht, ist er bald auch im Westen ein ausgemachter Held.
In Hongkong starten seine Filme am chinesischen Neujahrsfest und gleichen einem Ereignis von nationaler Bedeutung. In Japan haben sich bereits Fans aus unerwiderter Liebe das Leben genommen. Solche Verehrung erfahren heute eigentlich nur Pop-Stars - nur, daß Jackie Chan dafür nicht attraktiv genug und schon viel zu alt ist. Von Jackie Chan zu sprechen, heißt deshalb, von einem Phänomen zu sprechen. Wie jeder echter Star ist er mehr als die Summe seiner Filme. Jackie Chan ist zugleich sein eigenes Genre: Ein Jackie Chan-Film ist eben ein Film von, mit und über Jackie Chan, den Mythos, den Komiker, den Stuntman.
Jackie Chans Filme mögen einem bestimmten Bauplan folgen, eine Kunst-Persona entwerfen, Martial-Arts und Comedy in virtuosen Slapstick überführen. Aber am Ende des Tages zählen weder Plot noch Budget, sondern die ganz körperlichen, akrobatischen Leistungen ihres Stars, die sich nicht in Dollars, sondern allein an der Zahl der Knochenbrüche am Set messen lassen. Längst sind die Frakturen Teil der medialen Inszenierung des Chan-Mythos geworden, seit er - im Widerspruch zum Illusionismus des Kinos - zu den Schlußcredits die legendären Outtakes ablaufen läßt, mit all jenen Stunts, die schiefgingen.
Oft waren sie lebensgefährlich, doch was die Perfektion betrifft, macht Chan keine Kompromisse. Während der Dreharbeiten zu "Der rechte Arm der Götter", der kantonesischen Antwort auf "Indiana Jones", mußte er sich nach einem Unfall eine Stahlplatte in den Schädel implantieren lassen. Den Fußtritt nach einem Federball in "Dragon Lord" filmte er nach seinen Angaben 1 600 Mal, bis er mit sich zufrieden war, und die Dreharbeiten zum Windkanal-Finale in "Operation Condor" dauerten satte vier Monate. In dem vor allem auf Effizienz bedachten Studiosystem Hongkongs kann sich das nur Jackie Chan leisten.
Den Unterschied zwischen Rolle und realer Person derart zum Verschwinden gebracht zu haben, ist nicht einmal den James-Bond-Darstellern gelungen, die immer eine Rolle verkörpern, die größer ist als sie. 007 hat seine Darsteller überlebt, aber niemand kann Jackie sein - außer Jackie Chan selbst.
Am ehesten läßt sich Jackie Chan deshalb mit dem von ihm bewunderten Buster Keaton und den Komikern der Stummfilm-Ära vergleichen. Mit ihnen teilt er nicht nur den Humor, sondern auch den Appell an den reinen Schauwert des Spektakels. Auf ihre Art sind Jackie-Chan-Filme Musicals ohne Musik. Keine Möglichkeit wird ausgelassen, die Statik des menschlichen Körpers in Bewegung aufzulösen und den bewegten Körper mit statischen Objekten zu konfrontieren - seien es Leitern, Stühle, Jacken oder selbst Fahrräder, die am Ende alle in ausgeklügelten Choreografien zweckentfremdet werden.
Am Schluß von "Projekt B", einem seiner schönsten Filme, kippt eine Mauer auf Jackie Chan herunter. Er wird nur deshalb nicht erschlagen, weil ihn - genau wie Keaton in "Steamboat Bill Jr." - eine Fensteröffnung trifft. In "Projekt A" zollt er Harold Lloyd Respekt, als er nach einer Keilerei am Minutenzeiger einer Turmuhr hängen bleibt. Wenn Jackie Chan der größte Filmstar am Ende dieses Jahrhunderts ist, dann vielleicht auch, weil sich mit Jackie Chan ein Kreis schließt, wo die Schaulust aus den Anfängen des Kinos sich mit der des post-klassischen Films berührt.
Hinsichtlich ihrer Virtuosität lassen die Stunts in seinen Filmen alle Bruckenheimer-Blockbuster mit ihren digitalen Special-Effects alt aussehen. Wenn in "Police Story 3" eine Verfolgungsjagd zwischen Motorrad, Zug und Helikopter damit endet, daß sowohl das Motorrad als auch der Hubschrauber auf dem Zug landen und Chan darauf noch seine Kung-Fu-Kunststückchen zur Geltung bringt, bleibt nur das naiv-kindliche Zirkus-Staunen, daß so etwas möglich ist - und das Glück, dabeigewesen zu sein. Wenn auch nur im Kino.
Diese naive Kindlichkeit spricht auch aus den Rollen Chans selbst. Während Hollywoods Action-Filme von der Mär männlicher Omnipotenz künden, Momente von Masochismus und Humor allenfalls der Selbstermächtigung von Muskelpaketen dienen, ist Chan eine fundamental groteske Figur. Nach qualvollen Jahren in der Peking-Oper-Schule und als Kinderstar schlug sich Jackie Chan Anfang der siebziger Jahre als einer der vielen Bruce-Lee-Nachfolger in einer Reihe von routiniert-langweiligen Kung-Fu-Filmen durch, die alle das Thema vom tumben Bauerntrottel variieren, der irgendwann dann doch den Moment der Genugtuung findet.
Besser wurden diese Filme auch nicht durch ein gelegentliches 3-D-Format oder einen jungen John Woo als Regisseur. Der Durchbruch kam erst, als er das erstarrte Chop-sockie-Schema in Filmen wie "Die Schlange im Schatten des Adlers" und "Drunken Master" mit komödiantischen Elementen durchsetzte und die Kampfszenen ins Balletthafte überführte, im Alleingang so die Kung-Fu-Komödie aus dem Boden stampfte. Jackie Chans Karriere ist von Beginn an an eine viel weichere Vorstellung von Männlichkeit gekoppelt als die seiner Vorgänger oder Konkurrenten. So sehr Chan damit den narzißtischen Machismo Bruce Lees feminisierte, blieb er dabei aber immer ein seltsam frauenloser Held. Auch in den Filmen der achtziger Jahre, die zunehmend Stoffe der chinesischen Volkstradition gegen modernere Agenten- und Abenteurer-Motive eintauschten, verzichtete Chan auf jede sexuelle Zeichnung seiner Figur. Vielleicht ist diese Ungefährlichkeit genauso Bedingung seines weltweiten Erfolgs - kontrastiert man sie mit der bedrohlichen Hypermaskulinität, die im ebenfalls die Vorherrschaft weißer Stars in Frage stellenden Blaxploitation-Zyklus der siebziger Jahre an die Oberfläche trat. Frauen jedenfalls scheinen Jackie Chan zu lieben. "He's got sweet little toes" singen Wild Billy Childishs Thee Headcoates auf einer ihm gewidmeten Single, "Jackie attack - rip cage crack."
Das Spiel mit westlichen Genre-Anleihen zielte nicht zuletzt auf den amerikanischen Markt - nicht immer zur Freude seiner Fans und bisher auch ohne den ganz großen Erfolg, der bisher noch keinem der nach Hollywood exilierten kantonesischen Filmemacher seit der Übergabe an die VR China zuteil wurde. Aus dem Etappensieg "Rumble in the Bronx" scheint er aber eines gelernt zu haben: daß der Weg über die afroamerikanische Community gehen muß, die schon zu Zeiten Bruce Lees "Cinema of Vengeance" einen entscheidenden Anteil an der Kung-Fu-Begeisterung der siebziger Jahre hatte. Nach dem afroamerikanisch-asiatischen Buddy-Movie "Rush Hour", mit dem Chan diesen Weg weiterverfolgte, kommt jetzt "Mr. Nice Guy" in die Kinos. Die kommerziellen Beweggründe dafür dürften ersichtlich sein, und der bereits 1996 entstandene Film ist beileibe keine Meisterleistung, aber zumindest nicht so dümmlich wie der die abgefrühstückten Afrikaklischees wieder auftischende "Jackie Chan ist Nobody" aka "Who Am I?".
Jackie Chan spielt einen australischen Fernsehkoch namens Jackie, dem durch eine Verwechslung zufällig ein Videotape in die Hände gerät, auf dem - wie könnte es anders sein - die schurkischen Aktivitäten des Drogenbarons Giancarlo (Richard Norton) dokumentiert sind. Als sich dessen Handlanger daran machen, das Band wiederzubeschaffen, und Jackies Freundin Miki (Miki Lee) entführen ..., wird einmal mehr deutlich, daß es bei Jackie Chan wahrlich nicht um eine gute Story geht. Action-Spezialist und Chan-Kumpel seit Kinderstar-Tagen, Sammo Hung ("Painted Faces", "Moon Warriors"), inszeniert das erzählerische Minimum solide, mit dem obligatorischen Quentchen Humor, und tritt in rosa Strampelanzug als Fahrradkurier bei einem Cameo-Auftritt kurz in Erscheinung. Ansonsten konzentriert er sich auf das, was er am besten kann: Stunts ins rechte Licht zu setzen.
Chan mag mit den Jahren tatsächlich etwas langsamer geworden sein, aber zwei Szenen reißen es dann doch raus: Auf einem labyrinthischen Rohbau kommt es irgendwann zwischen den Kontrahenten zu einer mittels Türen ausgetragenen Keilerei, die die Zweckentfremdung von Alltagsgegenständen in eine choreographierte Form der Poesie überführt. Etwas brachialer gestaltet sich die zweite lohnenswerte Szene, quasi als B-Version der anti-bourgeoisen Schlußszene von "Zabriskie Point": Mit einem ungefähr zwölf Meter hohen Monstertruck fährt Chan zuerst über gut zwei Dutzend liebevoll aufgereihte Luxuslimousinen und dann quer durch die Villa des mit allen Insignien des Klassenfeindes versehenen Oberschurken. Manchmal fällt es verdammt schwer, es den Genossen zu gestehen: Aber es gibt einfach Menschen, die sehen so was gerne. Immer wieder.
"Mr. Nice Guy". USA 1998. R: Sammo Hung, D: Jackie Chan, Richard Norton, Miki Lee. Start: 17. Juni


 Nazis am Nil
Nazis am Nil