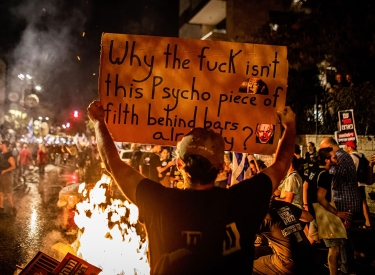Revolution nach rechts
Es ist die Zeit der großen Worte: Nicht weniger als eine »säkulare Revolution« will Israels Ministerpräsident Ehud Barak initiieren. Auch wenn dieser Begriff von den Medien geprägt wurde und Barak lieber von einem Programm der bürgerlichen Reformen spricht, so haben seine Ankündigungen doch für Aufsehen in der politischen Öffentlichkeit Israels gesorgt.
Denn offensichtlich kündigt sich eine grundsätzliche Wende in der Politik Baraks an. Hatte bisher der Friedensprozess mit den Palästinensern und den arabischen Staaten im Mittelpunkt gestanden, so will sich der Regierungschef nun, nach dem Scheitern von Camp David und wegen der nicht gerade verbesserten Beziehungen zu Syrien, innenpolitischen Fragen zuwenden. Barak war häufig dafür kritisiert worden, die Innenpolitik zu vernachlässigen. Nicht zuletzt daraus resultierten die zahlreichen Regierungskrisen, die der Ministerpräsident seit seinem Amtsantritt durchzustehen hatte.
Baraks »säkulare Revolution« hat zunächst zum Ziel, eine Verfassung zu schaffen. Bislang existiert in Israel lediglich eine »kleine Verfassung«, bestehend aus elf Grundgesetzen, die zwischen 1958 und 1992 verabschiedet worden sind. Bereits in ihrer ersten Legislaturperiode hatte die Knesset, das israelische Parlament, festgelegt, dass diese Grundgesetze nicht auf einmal, sondern nach und nach beschlossen werden sollten. Bis Anfang der neunziger Jahre wurden entsprechende Gesetze erlassen, die das politische System, die Rolle der Armee, die Wirtschaft, die Rechtsprechung und den Status von Jerusalem grundsätzlich regelten. Zu diesem Zeitpunkt existierten allerdings noch keine Gesetze, die Grundrechte garantierten.
Alle Versuche, Grundrechte festzuschreiben, scheiterten immer wieder am Widerstand der orthodoxen Parteien. Erst als der heutige Generalstaatsanwalt Amnon Rubinstein zwei Teilaspekte als eigenständige Grundgesetze formulierte, konnte der Widerstand überwunden werden. 1992 wurde ein Grundgesetz zur Menschenwürde und Freiheit verabschiedet, 1992 ein weiteres zur Berufsfreiheit. Aharon Barak, der Präsident des Obersten Gerichtshofes, nannte diesen Schritt bereits 1994 eine »Verfassungsrevolution«. Allerdings hatten alle weiteren Bemühungen, den Gleichheitsgrundsatz, die Rede- und Versammlungsfreiheit und den Primat der Grundrechte vor anderen Gesetzen zu definieren, keinen Erfolg.
Ob Israel überhaupt eine Verfassung braucht, ist unter Verfassungsrechtlern umstritten. Uriel Linn, Vorsitzender der Verfassungskommission der Knesset, hält die Vervollständigung der Grundrechte für ausreichend. Bei den aktuellen Mehrheitsverhältnissen in der Knesset wäre eine vollständige Verfassung sicher nicht durchzusetzen. Der Abgeordnete Avraham Ravitz von der Vereinigten Thora-Partei wollte in solchen Bestrebungen denn auch die »Erklärung eines heiligen Krieges gegen die jüdische Religion« erkennen. Und die Chancen für weitere Grundrechte stehen nicht viel besser.
Baraks Reformprogramm umfasst mehr als den Wunsch, eine Verfassung zu verabschieden. So soll das Religionsministerium abgeschafft, die zivile Ehe eingeführt und die rechtliche Stellung der Frau verbessert werden. Politisch brisanter sind aber zwei weitere Vorhaben. Eine allgemeine Dienstpflicht soll eingeführt werden, die auch die Orthodoxen beträfe - bisher waren sie vom Militärdienst freigestellt. Zudem will Barak Mathematik, Englisch und Sozialkunde zu Pflichtfächern in allen staatlich finanzierten Schulen machen - ein weiterer Eingriff in die Bildungsnetzwerke der orthodoxen Parteien.
Sowohl die Schaffung einer Verfassung, als auch die Säkularisierungsgesetze waren Programmpunkte, mit denen Barak in den Wahlkampf zog und mit denen er die Wahl gewinnen konnte. Aus Rücksicht auf seine orthodoxen Koalitionspartner, insbesondere die starke orthodoxe Shas-Partei, hatte er diese Forderungen aber zurückgestellt. Dass sie jetzt wieder hervorgeholt werden, hat strategische Gründe.
Nach dem Zusammenbruch der Koalition ist Barak auf der Suche nach neuen Mehrheiten. Zu diesem Zweck versucht er zu spalten: einerseits die säkularen rechten Parteien, insbesondere den Likud und die Parteien der russischen Einwanderer, Israel b'Aliyah und Israel Beitenu; andererseits die orthodoxen Kräfte der Shas- und der Vereinigten Thora-Partei. Barak will offensichtlich die Möglichkeit einer Regierung der »nationalen Einheit«, also einer Koalition mit dem Likud testen.
Dabei geht er von der realistischen Einschätzung aus, dass der derzeitige Likud-Vorsitzende Ariel Sharon lieber Außenminister unter Barak wäre als parlamentarischer Hinterbänkler unter Benjamin Netanyahu. Denn die Popularität des ehemaligen Ministerpräsidenten Netanyahu nimmt von Tag zu Tag zu, und Sharon fühlt sich bereits von ihm bedrängt.
Gleichzeitig will Barak Shas zu verstehen geben, dass die Partei viel zu verlieren hat, wenn sie nicht an der Regierung beteiligt ist. So setzt er auf eine riskante Doppelstrategie: Entweder kann er eine neue Regierungskoalition unter Einbeziehung der rechten Kräfte, aber auch der dezidiert säkularen Parteien Meretz und Shinui zustande bringen. Oder er zwingt Shas zur Rückkehr in die Koalition und zur Aufgabe ihrer unberechenbaren Politik. Sollte aber beides misslingen, so sähe sich Baraks One Israel plötzlich als Oppositionspartei einer Regierung aus Likud, Shas und Israel b'Aliyah gegenüber. Dies ist um so wahrscheinlicher, als die orthodoxen Parteien in den letzten Jahren eine deutliche Rechtswende vollzogen haben.
Bei all diesen Planspielen gibt es eine Konstante: Der Friedensprozess kommt nicht voran. Schon Baraks Umorientierung auf innenpolitische Themen zeigt, dass er sich von weiteren Verhandlungen mit den Palästinensern zur Zeit nicht viel verspricht. Eine Koalition mit dem Likud aber würde das vorläufige Ende der Verhandlungen bedeuten. Gleichzeitig will Barak mit seinem Reformplan Druck auf die Palästinenser ausüben und sie zu größeren Zugeständnissen zwingen.
Es scheint, als behalte die israelische Friedensbewegung Recht. Stets hatte sie darauf gedrängt, zuerst die Verhandlungen mit den Palästinensern zu einem wenigstens vorläufigen Abschluss zu bringen, bevor die innenpolitischen Konflikte angegangen werden könnten. Allerdings stellt sich die Frage, ob dies nicht eine etwas kurzsichtige Strategie war. Denn offensichtlich lassen sich die innenpolitischen und außenpolitischen Fragen nicht trennen. Auf innenpolitische Konflikte reagieren bestimmte Teile der israelischen Gesellschaft mit einer außenpolitischen Radikalisierung.
Mit seiner Vernachlässigung der innenpolitischen, vor allem auch der sozialen und kulturellen Konflikte, hat sich Barak selbst die politische Grundlage für eine erfolgreiche Friedenspolitik entzogen. Ob sie durch das Projekt einer »säkularen Revolution« wieder hergestellt werden kann, ist mehr als fraglich.