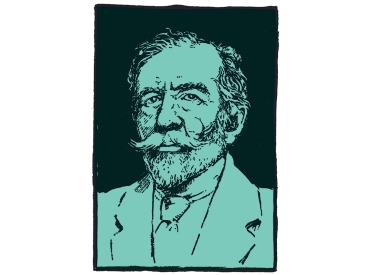Mehr von der Welt
Ein typischer Freudscher Medienversprecher, der dem Spiegel und seiner Anzeigenabteilung mit der Ausgabe vom 22. April dieses Jahres unterlief. Zum Titelthema »Terror gegen Touristen« zeigte der Umschlag ein Videostill des Anschlags auf die Synagoge von Djerba. Blätterte man die Zeitschrift dann auf, fiel einem eine große Ausklappanzeige des Autoherstellers Audi entgegen. Hier war zu sehen, wie ein silbernes Exemplar des neuen A4-Cabriolets den sprichwörtlich endlosen, jungfräulichen und auch schneeweißen Sandstrand hinunterfährt. Nur der Fahrer, sein Audi (mit Frankfurter Kennzeichen) und die Weite. »Mehr von der Welt« lautet der Slogan. Und, zur näheren Erläuterung: »Eigentlich sollten wir jeden Tag damit beginnen, rauszugehen und den Kopf in den Wind zu halten.«
Manch Cabrio-Interessent mag in diesen Zeiten des Terrors gegen Touristen darüber ins Grübeln geraten, inwieweit es sich noch mit dem eigenen Sicherheitsbegehren vereinbaren lässt, rauszugehen und den Kopf schutzlos in den Wind zu halten. Vielleicht wurde deshalb der Audi-Strand so rein und menschenleer retuschiert, kein Selbstmordattentäter, kein Sniper kann sich hier verstecken. Die Risiken, die mit dem Wunsch nach jenem gewissen »Mehr von der Welt« verbunden sind, scheinen per Photoshop wie weggewischt. Djerba ist fern.
Scheinbar. Denn die gängigen Vorstellungen vom beschaulichen Leben an einsamen und nicht ganz so einsamen Stränden können täuschen. Hieß es einst, unter dem Pflaster liege der Strand, muss allmählich damit angefangen werden, unter dem Strand nach dem Pflaster und anderen härteren Gegenständen zu suchen. Und die Rede ist hier nicht von britisch-deutschen »Handtuchkriegen« an den Stränden von Mallorca.
Im vergangenen Jahr machte die walisische Politrockband Manic Street Preachers die Doppelbödigkeit der Urlaubsidylle zum Thema des Videos ihrer Single »So Why So Sad«. Der Clip (Regie: James Thwartes) setzt ein mit der Nahaufnahme eines Baseballs, der in der Faust eines Mannes steckt. Ein kleiner Junge mit einem metallenen Schläger erwartet den Wurf. Die Szene trägt sich an einem Strand zu. Ringsum verstreut: urlaubende Familien, Frauen in Bikinis, Sandburgen. Ein erbauliches Ferienparadies. Zugleich ist der Strand der Ort einer militärischen Operation. Fallschirmspringer in voller Kampfausrüstung führen eine Landung durch. Die Soldaten stürmen über den Sand, einige brechen unter feindlichem Feuer zusammen.
Doch Strandurlauber und Soldaten nehmen keine Notiz voneinander. Sonnenbad und Landeoperation ereignen sich auf unterschiedlichen Wirklichkeitsebenen, als hätte man einen Film von Eric Rohmer mit einem Kriegsfilm überblendet. So tobt der Kampf inmitten der äußerlich friedlichsten aller Situationen - folgenlos. Bis zum Schlussbild, in dem der Baseball zur Handgranate geworden ist, die der Vater dem bereit stehenden Sohn zuwirft.
Zunächst wirkt die Symbolik des Videos eher behäbig. Die rechtschaffenen Manic Street Preachers wollten es mal wieder besonders korrekt und engagiert machen, und so ist eine ganz und gar korrekte und engagierte Parabel über die das gleichzeitige Auftreten von Frieden und Krieg herausgekommen. Ihre Botschaft: Gewalt ist allgegenwärtig, in den Familien, in der Freizeit, im Frieden, man muss nur lernen, diesen Sachverhalt klar zu sehen, und wir, die aufrechten Sozialisten unter den britischen Popbands, wir helfen euch dabei. Und es macht die Sache kaum besser, dass die Gruppe in Zwischenschnitten zu sehen ist, wie sie orientierungslos in einem Bungalow im Wallpaper-Style herumsteht und ihren eher uninspiriert geratenen Song vorträgt, während draußen vor dem Panoramafenster die Fallschirmjäger vom stahlblauen Himmel herunterschweben.
Doch abgesehen von allfälligen Erwägungen darüber, wie hoffnungslos dated, ästhetisch inadäquat oder beflissen didaktisch das alles ausgefallen ist, erweist sich das Landschaftsmotiv, das hier zur Bebilderung eines Problemlieds verwendet wird, als treffend gewählt.
Wahrscheinlich ist der Strand (oder das, was sich in den letzten Jahrhunderten zum Mythos des Strandes verdichtet hat) die ultimative Verkörperung des Appetits auf »Mehr von der Welt«. Anders ausgedrückt: Er ist der Ort einer »Phantasieproduktion«, »Spielplatz und transgressiver Raum par excellence«, wo sich »Natur und Karneval als Prähistorie in einem dialektischen Bild der Moderne überlagern«, wie der Anthropologe Michael Taussig schreibt.
Außerdem, so lässt sich mit Hilfe des »So Why So Sad«-Videos ergänzen: Der Strand ist die dialektische Doppelbühne des Freizeitmenschen und des Elitesoldaten und hin und wieder auch der Schauplatz ihrer Synthese: des Freizeitsoldaten. So enthält der Clip ein Wissen darüber, wie das Bild des Strandes in den doppelten Phantasien über Erholung und Eroberung, Urlaub und Intervention funktioniert.
Michael Hardt und Antonio Negri erklären in »Empire« die Entwicklung des so genannten Rechts auf Intervention zum »bedeutsamsten Symptom« der gegenwärtigen Transformation der supranationalen Rechtsprechung. Dieses Recht leitet sich von der Annahme ab, die dominanten Akteure der Weltordnung seien legitimiert, in Territorien dieser Ordnung zu intervenieren, wenn dort humanitäre Probleme zu verhindern oder zu lösen sind.
Hardt und Negri konzentrieren sich in ihrer Auseinandersetzung mit diesem imperialen Interventionismus auf die juristischen Grundlagen und ihre militärisch-humanitären Effekte. Was sie außen vor lassen und was einen blinden Flecken ihres Buchs ergibt, ist die kulturelle Produktion der Legitimität dieses Interventionismus. Zwar operieren die Autoren selbst äußerst souverän auf dem Feld des Imaginären, indem sie die kollektive Erinnerung an den »Kommunismus« ankurbeln und Begriffe wie »Multitude« und »Empire« wie kleine ideologisch-konzeptuelle Maschinen in die Köpfe pflanzen.
Doch an alltags- oder massenkulturellen Prozessen und Phänomenen scheinen Hardt und Negri weniger interessiert zu sein. Wenn überhaupt, dann kreisen ihre diesbezüglichen Beobachtungen um den Begriff des Postmodernismus, mit dem sie durchaus treffend eine Unternehmens- und Marketingkultur beschreiben, die sich auf Kategorien wie Differenz und Vielfalt beruft. Wie diese Ideologeme einer »postmodernen« Kultur allerdings mit der Politik des Empire verbunden sind, wie Handlungs- und Denkmuster der Individuen mit den Bildern und Sätzen bestückt werden, die sie legitim erscheinen lassen, bleibt weitgehend ein Rätsel.
Dabei ist die Berufung auf die Menschenrechte oder auf die zwingende Logik des Marktes eben nur ein Baustein der Legitimität des imperialen Interventionismus. Unter und neben dem Recht auf Intervention existiert aber zudem eine mächtige Kultur der Intervention. Sie wird über Filme, Tourismus, Autos oder Mode kommuniziert und stellt ein phantasmatisches Wertesystem bereit. Obwohl sie keine Erwähnung in den offiziellen Verlautbarungen zu jener Polizeipolitik der Prävention und Kontrolle finden, die das Vorgehen der »internationalen Gemeinschaft« bestimmt, sind die kulturellen Normen des Abenteuers, der Grenzerfahrung, des überschreitenden Genießens maßgeblich verantwortlich für den Appeal von moralischer Richtigkeit und legaler Berechtigung des Interventionismus. Und hier kommt wieder der Strand als Ort der interventionistischen Phantasieproduktion ins Spiel.
Wie der popkulturelle Zufall es wollte, tauchte das Freizeitsoldaten / Strandmotiv etwa zur gleichen Zeit, als das Manic Street Preachers-Video im Musikfernsehen lief (also Anfang / Mitte 2001), noch in einem anderen, wesentlich erfolgreicheren Clip auf.
Der Regisseur Darren Grant verzichtete auf vergleichbare Bemühungen um Komplexität, siedelte sein Video aber auf ähnlichem imaginären Terrain an. Zu ihrem Nr.1-Hit »Survivor« werden die drei Musikerinnen der R&B-Gruppe Destiny's Child, offensichtlich in Folge eines Schiffbruchs, an einen einsamen Strand gespült. Nachdem die Frauen ihr Bewusstsein wieder erlangt haben, tauschen sie die zerfetzten roten und gelben Kleider gegen Bikinimodelle im militärischen Camouflage-Look aus. So kann der Ausflug ins Landesinnere beginnen, wo sie Wasserfälle, Tempelanlagen, Guerillakämpfer und vertrackte, an soldatischen Drill erinnernde Tanzchoreographien erwarten. Das Geschehen oszilliert zwischen Expedition und Flucht. Am Ende freilich siegt die Einsicht, diese Gegend schleunigst verlassen zu wollen.
Zurück am Strand werden die drei »Überlebenden« von einem Armeehubschrauber aufgesammelt. Das Schlussbild, der Hubschrauber im Goldlicht der Abendsonne, zitiert eine Ikone des Vietnamkriegsfilms. In wenigen Videominuten wurde aus einer Gruppe schiffbrüchiger Partygirls ein schlagkräftiger Invasionstrupp. Krieg oder Urlaub, Militäraktion oder Hedonismus? Warum sich für das eine oder andere entscheiden, wenn man gleich beides erleben kann?
Während die Bedenkenträger von den Manic Street Preachers in einer derartigen Aufhebung der Differenzen von Krieg und Frieden wenigstens noch ein Problem erkennen, liegt der Survivor-Chic von Destiny's Child auf der Linie des herrschenden »Mehr von der Welt«-Appetits. Mit viel Spaß als Treibstoff der Mobilität begibt man sich auf die Eroberungsfahrt und hält an einsamen Stränden und im dschungeligen Hinterland den Kopf in den Wind.
Und klarerweise ist das alles nicht so verdammt ernst gemeint, die Sache mit dem Military-Style und dem Hubschrauber. Der Strand wird zur Bühne eines Pop-Interventionismus, der von der eigenen Lässigkeit und Richtigkeit voll und ganz überzeugt ist und dessen sexy Akteure landen, wo sie eben landen wollen, ganz ungezwungen, wenn auch anspruchsvoll, was Intensität und Qualität des Abenteuers betrifft.
Die glamourösen Cabriofahrer oder R&B-Sängerinnen, die unbeschwert und genussbetont den Strand erobern, sind Archetypen eines Subjekttyps, der im globalen Empire normativen Charakter angenommen hat. Das interventionistische Subjekt sieht Grenzen höchstens als Anlass ihrer selbstgewissen Missachtung. Globalisierung interpretiert es als universale Zutrittsberechtigung, »going places« ist sein bevorzugter Fortbewegungsmodus. Im Imaginären der westlichen Gesellschaften übernehmen allradgetriebene Luxusgeländewagen und andere Gadgets des »enduring freedom« die Aufgabe, die fortwährende Mobilität des interventionistischen Subjekts sicherzustellen. »Von den Wüsten Afrikas bis zu den Gletschern von Neuseeland ist die Welt ein riesiges Abenteuer-Gelände, das nur darauf wartet, entdeckt zu werden«, schwärmt eine Werbebroschüre des Rucksackherstellers The North Face. Allenthalben wird dem interventionistischen Subjekt der Weg geebnet - militärisch, technologisch, juristisch, zivilgesellschaftlich.
Als Leitfigur einer mobilisierten Gesellschaft kann es sich durch das kulturell und juristisch verbürgte Recht auf Intervention in seinem Bewegungsdrang bestätigt sehen; seine Entdeckermentalität und sein Anspruch auf Konsum akzeptieren keine territorialen und sonstigen Grenzen; die Philosophie des »Mehr von der Welt«, wie sie Destiny's Child oder Audi-A4-Fahrer vorleben, ist mit einer tief reichenden Kultur der Krise und der Mobilisierung verwoben.
Dieses Subjekt ist deshalb, wen wundert's, nicht überall gern gesehen. Landschaften, Menschen, Tiere und Pflanzen, die zu Schauplätzen und Objekten seines Interventionismus werden, müssen mit schweren Verwüstungen rechnen. Doch zugleich sind die Einwohner der Territorien, in die interveniert wird, von der (z.B. touristischen) Konsumaktivität des interventionistischen Subjekts, aber auch von seinen (z.B. militärischen) Sicherheitsangeboten abhängig. Manchmal zieht die Intervention auch Investitionen nach sich (oder weckt die Hoffnung auf eben solche). Dafür müssen bestimmte Anforderungen an »Stabilität« erfüllt sein, die von der Weltbank, dem Internationalem Währungsfonds, der UN, einem Touristik-Konzern oder anderen Agenturen des Empire formuliert werden.
Allein für den Tourismus der reichen Länder werden weltweit größte Anstrengungen unternommen, jene »Sicherheit« zu schaffen, die dem interventionistischen Subjekt seine Abenteuer erst ermöglicht. Damit an den Stränden keine Handgranaten, sondern Bälle fliegen, werden aufwändige Sicherheitssysteme installiert. Nicht selten kommen die hierzu erforderlichen Maßnahmen den Interessen repressiver Regimes entgegen, die ihre Bevölkerung scharf kontrollieren, um dem interventionistischen Subjekt seine Überschreitungen zu gewährleisten.
Zum Stichwort Tourismus schrieb das International Peace Research Institute 1999: »Kollisionen zwischen dem paradiesischen Dasein der Urlauber und dem realen Alltagsleben der Einwohner (lassen sich) nicht vermeiden. In einigen Fällen können solche negativen Reaktionen politisch aufgeladen werden, indem die Anwesenheit einer großen Zahl von Auslandstouristen als Symbol der Invasion und des Kulturimperialismus gedeutet wird. Manche einheimischen politischen Gruppen betrachten Mordanschläge auf Touristen als nächsten logischen Schritt in dieser Konfrontation.« Wo das interventionistische Subjekt hinkommt, sorgt es für Ausnahmezustände.
Bisher basierten diese Ausnahmezustände auf der Trennung der Sphären von Tourismus und Terrorismus, von Freizeit und Krieg. Diese Trennung ist jetzt immer schwerer aufrechtzuerhalten. Denn wie Luxor und Kairo (beide 1997), Antalya (1993), Jolo (2000) oder Djerba (2002) zeigen, werden die Ausnahmezustände ihren interventionistischen Verursachern zurückgespiegelt. So heftig, dass sich der »War on Terrorism« zunehmend mit einem unberechenbaren »War on Tourism« verschränkt.
Damit gerät das Modell des interventionistischen Subjekts in eine extreme Krise. Doch dürfte diese Krise weniger zu seinem Ende beitragen als zu einer ideologischen Erneuerung führen. Aus dem spielerischen Pop-Militarismus des Destiny's Child-Videos, das vor dem 11. September 2001 entstand und wie viele andere Inszenierungen in der Massenkultur, die mit dem Todesglamour ausgeweiteter Kampfzonen kokettieren, einer Art Vorkriegsstimmung zugeordnet werden muss, könnte ein hoch gerüstetes Subjekt emporsteigen. Militärische, humanitäre, touristische, ökonomische, soziale und andere Formen des Interventionismus verschmelzen im interventionistischen Subjekt zu neuen, paramilitärischen Hybriden, zu lifestyle warriors und Terrortouristen.
Der »permanente Not- und Ausnahmezustand« (Hardt/Negri), den die internationale Gemeinschaft durch ihre jeweiligen Vertreter (NGO, supranationale Organisationen, die US-amerikanische Regierung usw.) immer dann ausrufen lässt, wenn sie grünes Licht für Interventionen braucht, ist letztlich auch die Grundlage jener Strandkultur, die dem interventionistischen Subjekt seine ambivalenten Phantasieräume zur Verfügung stellt.
Tatsächlich wurden Strände immer wieder zu konkreten Bühnen der militärischen Intervention, sowohl in der Geschichte der Kriege und Eroberungen als auch in ihrer massenkulturellen Weiterverarbeitung - vom D-Day 1944 bis zu den ersten 30 Minuten von »Saving Private Ryan«; oder umgekehrt: von Robert Duvalls wagnerianischer Hubschrauber-Kavallerie, die sich in »Apocalypse Now« den Strand zum Surfen zurechtbombt, bis zur Invasion in Grenada 1989, als die US-amerikanischen Hubschrauber nach dem Vorbild des Coppola-Films zu Wagnerklängen die Strände des Inselstaats anflogen. Das Recht auf Intervention ist nicht zuletzt ein Recht auf die Inanspruchnahme des Paradieses. Das interventionistische Subjekt verkörpert und schafft den Ausnahmezustand, weil es wie selbstverständlich auf seine kulturell legitimierte Souveränität pocht.
Eine aktuelle Anzeige für Malaysia Airlines bringt es auf den Punkt: Auf einem strahlend weißen Lagunenstrand, umschlossen von hellblauem Meerwasser, steht, winzig klein, ein blasshäutiger Mann in Badehose. Der Text enthält die ultimative Drohung: »Vielleicht bleibe ich bis Dienstag. Vielleicht bleibe ich bis Donnerstag. Vielleicht bleibe ich bis Freitag ... Vielleicht bleibe ich hier.«
Weiter entfernt vom »ontologischen Terrain der Multitude« (Hardt/Negri) kann man sich nicht befinden. Aber wie soll man den neokolonialen Appetit auf »Mehr an Welt« bekämpfen, solange man selbst in den kulturellen Phantasieräumen eingesperrt ist, die diesen Appetit erzeugen? Was, wenn man selbst nichts mehr begehrt als den sprichwörtlichen Strand (an dem man in diesem Sommer »Empire« lesen wird)? Kann man das postmoderne Recht auf Intervention bekämpfen, ohne in den »War on Tourism« zu verfallen?
Was sich über das globale Imperium sagen lässt - dass es in einem dialektischen Loop, ad infinitum, die Kräfte hervorbringt, die zu seiner eigenen Zerstörung führen -, gilt ja auch für eine seiner Unterabteilungen, die Kultur. Sie ist die Produktionsstätte für Phantasien, in denen die größten Verheerungen konzipiert werden; aber sie ist eben auch die Ressource zur Herstellung von »Interventionsräumen« (Homi K. Bhabha), in denen (wiederum: kulturelle) Hegemonien bekämpft werden können.
Das Möbiusband der Kultur ist ein perfektes Gefängnis. Trotzdem könnte man wider besseres Wissen mit dem einen oder anderen Ausbruchsversuch beginnen. Zum Werkzeug taugt womöglich die Erkenntnis, dass die Kultur des Strandes das Idealmilieu des interventionistischen Subjekts ist. Denn wie im »So Why So Sad«-Video oder auch in der alten Filmversion von »Planet der Affen«, wo der Strand sich als sandige Decke entpuppt, die über das versunkene New York gebreitet wurde, zeigt sich: Unter dem Strand liegt das Pflaster, die Stadt, das Kriegsgebiet.



 Nazis am Nil
Nazis am Nil