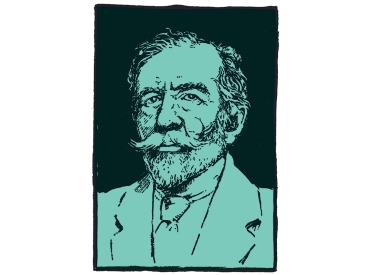Louvre unter Palmen
Wo steht das höchste Gebäude der Welt? Die Einwohner Dubais werden diese Frage demnächst mit »bei uns!« beantworten können. Noch wird geheim gehalten, ob der neue Turm, der in dem Emirat am Persischen Golf errichtet wird, 800 oder 1 000 Meter Höhe erreichen wird. Derzeit wächst er alle vier Tage um eine Etage, insgesamt 189 sollen es am Ende sein. »Burj Dubai« heißt das Projekt, vom arabischen Wort für »Turm« (burdsch oder bordsch). Rundherum entsteht eine Stadt mit 320 000 Luxuswohnungen, Büros oder Grünanlagen, für deren Errichtung im Moment ein Viertel aller weltweit verfügbaren Baukräne auf dem Areal trockener Erde am Golf zusammengezogen worden sind.
Das Ziel ist es, die schnell expandierenden Metropolen in den Boomstaaten Süd- und Ostasiens im Wettstreit der Architekturen zu übertreffen. Bisher besaß Malaysia mit den beiden Petronas Towers, benannt nach dem nationalen Erdölkonzern, in seiner Hauptstadt Kuala Lumpur die – mit über 500 Metern – höchsten Bauwerke des Planeten. Neben dem Turmbau am Golf werden sie aber in Kürze klein aussehen.
Dabei verdeckt die Gigantomanie des Emirats freilich auch bestimmte, begründete Zukunftsängste. Dubai, einem der Mitgliedsstaaten der föderativ zusammengeschlossenen Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), wird in wenigen Jahren das Erdöl ausgehen. Dann ist Schluss mit der bisherigen Hauptdevisenquelle, die – in den letzten Jahren mehr denn je, wegen des hohen Rohölpreises – den Reichtum in der Golfmonarchie sicherte. Wenn es soweit ist, möchte Dubai gewappnet sein, indem es andere Devisenquellen entwickelt. So sollen künftig jährlich 20 Millionen Touristen in die Wüstenstadt gelockt werden, deren Einwohnerzahl zugleich von 1,2 Millionen auf zehn Millionen gesteigert werden soll. Ob diese Perspektive als ökonomisch realistisch gelten kann, darf bezweifelt werden.
Im kleinen Nachbarstaat Abu Dhabi, der ebenfalls zum Staatenbund der Vereinigten Arabischen Emirate zählt und dessen Hauptstadt bildet, kann man die Sache etwas ruhiger angehen. Denn hier reichen die Ölvorräte voraussichtlich noch für über 100 Jahre, so dass sich der Zukunft relativ sorgenfrei ins Auge blicken lässt. Dennoch denkt man auch hier an die Zeit, die nach dem Versiegen der sprudelnden Erdöleinnahmen anbricht. So plant das Emirat, bis zum Jahr 2015 in nordamerikanische, europäische und asiatische Firmen für erneuerbare Energien einzusteigen, um nicht nur im Erdöl-, sondern auch beim Ökogeschäft mit dabei zu sein. Zugleich sollen ab dem kommenden Jahr Autorennen in dem wüstenreichen Land veranstaltet werden.
Der Publikumsrenner, der dem Golfstaat eine starke Anziehungskraft im Bereich des Luxustourismus sichern soll, werden aber voraussichtlich die Museen, die auf künstlich angelegten Inseln vor der Küste von Abu Dhabi errichtet werden sollen. So wird ein Guggenheim-Museum entstehen, das größer ausfallen soll als die bisher bestehenden in New York und Berlin. Das OK der Guggenheim-Stiftung ist bereits eingeholt. Außerdem soll ein zweiter Louvre am Golf entstehen, der dem Original in Paris nachempfunden sein soll. 400 bis 500 Kunstschätze von dort sowie aus anderen französischen Einrichtungen sollen hier ausgestellt werden: Bilder, Skulpturen, Porzellan, Möbel, Juwelen, Antiquitäten.
So ungefähr könnte man es sich vorstellen: Ein paar Stunden Rösten in der Sonne bei über 40 Grad, dann ist es Zeit für einen Ausflug in den Yachthafen – und im Anschluss dann für einen Museumsbesuch. Dazu müssen die Touristen nur vom Strand über die kleine Wasserstraße auf die Insel übersetzen, die vielleicht 500 Meter entfernt liegt. Dort haben sie dann die Wahl zwischen vier erstklassigen Museen von Weltrang, einer Oper und einer Kunstgalerie. Direkt neben dem Guggenheim- liegt das Louvre-Museum. Heute hängen dort Leihgaben aus diversen französischen Museen in Lille, Bordeaux und Lyon. Nach Entrichtung eines sündhaft teuren Eintrittspreises flanieren die Urlauber zwischen den Kunstwerken, bevor sie sich wieder unter die heiße Wüstensonne nach draußen begeben. Zwischendurch machen sie sich in ihren Vier- und Fünf-Sterne-Hotels frisch. Wenn sie sich nicht gleich für einen Sieben-Sterne-Schuppen entscheiden, denn der Bau eines solchen auf der künstlich aufgeschütteten Museumsinsel ist ebenfalls angekündigt.
Bereits 2012 könnte dieses Szenario Wirklichkeit werden. Der Grundlagenvertrag zwischen dem französischen Kulturministerium und dem Golfstaat dazu wurde am 6. März vergangenen Jahres im Emirate Palace unterzeichnet, einem Luxushotel erster Klasse, dessen Eingangshalle einen Kilometer Länge misst und in dem jedem Gast ein persönlicher Butler zur Seite steht. Der damalige Kulturminister Renaud Donnedieu de Vabre war eigens zur Unterzeichnung an den Golf gereist.
Doch in der französischen Kulturwelt hat das Projekt enorme Proteste verursacht. Das Figaro Magazine, das großbürgerliche Wochenendmagazin, das der konservativen Tageszeitung Le Figaro beigelegt ist, hat die Kontroverse kurz vor Weihnachten erneut wiederbelebt. Das Blatt machte Werbung für den »Vertrag des Jahrhunderts«.
Doch worum geht es genau? Der Vertrag zwischen Frankreich und den Emiraten erlaubt es dem Staatenbund, für die Dauer von 20 Jahren den Namen des Louvre für sein geplantes Museum zu benutzen. Daneben sicherte Frankreich der Golfmonarchie auch zu, zehn Jahre lang Leihgaben aus seinen prestigereichsten Museen zur Verfügung zur stellen. Pro Jahr sollen vier temporäre Ausstellungen nach Abu Dhabi ausgeliehen werden. Daneben sollen auch längerfristige Leihgaben im dortigen Louvre ausgestellt werden, wiederum für die Dauer eines Jahrzehnts, wobei die Kunstobjekte spätestens alle zwei Jahre ausgewechselt werden sollen. Nach Ablauf der Periode, so erhofft man sich am Golf, wird das dortige Museum sich selbst eigene Ausstellungsstücke zusammengekauft haben. Als Lizenzgebühr erhält Frankreich rund 700 000 Millionen Euro, davon sind 400 Millionen Euro allein für die Nutzung des Markennamens »Louvre«.
5 100 prominente Leiter und Kuratoren französischer Museen, aber auch Kunsthistoriker und andere Angehörige des Kultursektors haben bis zum vergangenen März ihre Unterschrift unter eine dagegen gerichtete Petition gesetzt. Der damalige Kulturminister de Vabre hatte die Kritiker kurz zuvor im Parlament als eine »Hand voll mürrischer Individuen« bezeichnet. Er ließ sich dadurch nicht von seinen Plänen abbringen, zu denen heute auch seine Nachfolgerin Christine Albanel unverbrüchlich steht.
Was stört die Kritiker an dem Vorhaben? Mit ihrer Unterschrift unterstützen sie explizit einen Standpunkt, den die Museumsdirektorin Françoise Cachin, der ehemalige Leiter des Picasso-Museums in Paris, Jean Clair, sowie ein Professor am Collège de France, Roland Recht, in einem Gastbeitrag für die Pariser Abendzeitung Le Monde dargelegt haben. Dessen Überschrift lautet: »Die Museen sind nicht zu verkaufen!« In erster Linie wird darin moniert, dass den Besuchern der französischen Museen ein Teil der Kunstschätze künftig vorenthalten werde – und dies, um Geschäfte damit zu betreiben. Die drei Urheber des Gastbeitrags betonen zugleich, dass sie nicht generell gegen eine internationale Zusammenarbeit von Museen und gegen das Verleihen seien: »Natürlich muss man Kunstwerke ausleihen, wenn ihr Zustand es erlaubt und wenn ihre Sicherheit gewährleistet ist. Aber kostenlos und im Rahmen von Vorführungen, die einen Beitrag zur besseren Kenntnis der Kunstgeschichte leisten.«
Im übrigen sehen die drei Kritiker darin einen Präzedenzfall: »Mit dem Beispiel des Louvre von Atlanta (in den USA), wo Gemälde, die zu den größten Meisterwerken der Sammlungen gehören, wie ›Et in Arcadia Ego‹ von Poussin, ›Baldassare Castiglione‹ von Raphaël und ›Der junge Bettler‹ von Murillo, für ein Jahr bzw. drei Monate in die reiche Coca-Cola-Stadt verlegt worden sind, im Austausch gegen 13 Millionen Dollar.« Aber, so schreiben sie weiter: »Das Schlimmste kommt erst noch. Das aktuelle Beispiel von Abu Dhabi ist alarmierend.«
Ihnen warf der amtierende Präsident des Louvre, Henri Loyrette, in einer Antwort vor, ein falsches Bild vom Austausch zwischen den Museen zu kultivieren. So schreibt er: »Auch wenn die Unterzeichner des Gastbeitrags in Atlanta nur ›die Stadt von Coca-Cola‹ sehen mögen, so ist doch diese mehrheitlich von Schwarzen bewohnte Stadt auch die Heimatstadt von Martin Luther King mit einem starken kulturellen Potenzial.« Und er gibt an, die finanziellen Motive seien nicht ausschlaggebend für die internationalen Projekte des Louvre: »Die Operation ist zuerst Bestandteil eines Nachdenkens über die Internationalisierung der Museen (…). Der Louvre kann dabei nicht fehlen. Dass ökonomisch dabei etwas auf dem Spiel steht, ist offensichtlich. Das durch diese Operationen eingenommene Geld ist wichtig, das darf man nicht verstecken. Aber man muss daran erinnern, dass der Louvre unter der Französischen Revolution und unter Napoleon als universelles Museum angelegt worden ist.«
Der Kern des Problems dürfte in Wirklichkeit im Charakter der Zusammenarbeit liegen. Hinsichtlich der Kooperation mit Atlanta wird man Loyrette sicherlich Recht geben können. Eine US-Großstadt mit vier Millionen Einwohnern lässt sich zweifellos nicht darauf reduzieren, dass sie der Firmensitz von Coca-Cola ist. Wenn eine Leihgabe den dort lebenden Menschen dazu verhilft, Kunstschätze kennen zu lernen, die sie sonst vielleicht in ihrem Leben nie im Original gesehen hätten, ist daran kaum Kritik zu üben.
Aber das Projekt in Abu Dhabi hat einen völlig anderen Charakter. Auch deswegen schockiert es Teile der Öffentlichkeit derartig. Denn in diesem Falle geht es offenkundig nicht darum, den arabischen Bevölkerungen die Kunstschätze der Welt näher zu bringen. Dagegen wäre nichts einzuwenden gewesen, im Gegenteil. Denkt man daran, wie viele wertvolle Kunstgegenstände beispielsweise aus Ägypten in europäischen Museen (auch im Louvre) lagern, Gegenstände, die dort geraubt oder im 19. Jahrhundert zu einem Spottpreis aufgekauft worden sind, dann wäre es nur gerecht, würde ein beträchtlicher Teil der Sammlungen des Louvre über Jahre hinaus in Kairo ausgestellt. Vorausgesetzt, dies geschähe kostenlos und sie wären den Millionen Einwohnern der Nilmetropole zugänglich. Die Situation der Golfmonarchie Abu Dhabi hat mit einem solchen Szenario aber schlichtweg nichts zu tun.
Die Golfmonarchie ist – ähnlich wie andere Kleinstaaten der Region, deren Reichtum seit den siebziger Jahren wegen der Petrodollars explosionsartig wuchs und deren Oberschicht von fast allen anderen Arabern verachtet und gehasst wird – ausgesprochen bevölkerungsarm. Abu Dhabi, die flächenmäßig größte Monarchie im Staatenbund, hat rund 700 000 Einwohner, die gesamten Vereinigten Arabischen Emirate haben rund vier Millionen. Aber rund 80 Prozent dieser Einwohnerschaft sind Arbeitsimmigranten, größtenteils aus Indien, Pakistan, Bangladesh oder von den Philippinen, die unter teilweise sklavenähnlichen Bedingungen arbeiten. Ihnen dürfte die Ansiedlung von Kunstschätzen wohl kaum zugute kommen. Im ähnlich strukturierten Nachbarstaat Bahrain hat der Monarch das Museum am Freitag, dem wöchentlichen Ruhetag in islamischen Ländern, schließen lassen – mit dem erklärten Ziel, dass Immigrantenfamilien und andere Arme sich dort nicht aufhalten, um von der Klimaanlage zu profitieren. Das Museum von Bahrain ist Touristen und der Oberschicht vorbehalten.
Abu Dhabi ist, wie andere neureiche Kleinstaaten am Golf – aber anders als bevölkerungsreiche Staaten wie Ägypten –, ein Land ohne kulturelle Infrastruktur. Im ganzen Land gibt es so gut wie keine Buchhandlungen, sondern nur Zeitungsläden – wobei die Zeitungen von geringem Interesse sind, da alle Medien der Zensur unterliegen. Die Zensur ist sehr gegenwärtig in Abu Dhabi, wo politische Parteien ebenso wie Gewerkschaften verboten sind und der Monarch weitgehend autokratisch Entscheidungen trifft.
Vor diesem Hintergrund wird in Frankreich auch befürchtet, dass die Verantwortlichen in Abu Dhabi die Kunstgegenstände aus Frankreich sehr selektiv in den »exportierten« Louvre aufnehmen werden. Insbesondere wird angenommen, dass etwa Gemälde mit Nacktdarstellungen oder aber religiösen Themen – die im Zusammenhang mit anderen Religionen als dem Islam stehen – abgelehnt oder zensiert werden könnten. Welche Kunstgegenstände verliehen werden, steht nämlich noch nicht fest. Die Spielregel lautet, dass alle französischen Museen auf freiwilliger Basis Leihgaben an den neuen Louvre im Golfstaat vorschlagen können. Die emiratische Seite sicherte allerdings zu, dass sie keine Leihgaben »aus unvernünftigen Gründen« (pour des motifs déraisonnables) ablehnen wird. Bliebe nur noch darüber zu debattieren, was denn vernünftig oder unvernünftig sei.
Das Figaro Magazine behauptet nun aber wiederum, dass Befürchtungen diesbezüglich völlig unbegründet seien. Christliche Kunst werde jedenfalls nicht ausgegrenzt, was auch schwierig wäre, »denn wie sonst soll man die italienische Malerei seit Giotto (1267 bis 1337) und die gotische Periode Flanderns um Van Eyck (1395 bis 1441) repräsentativ darstellen?« Auch historische Figuren aus der französischen Nationalgeschichte, wie König François I. oder Napoleon Bonaparte, seien auf den an Abu Dhabi ausgeliehenen Gemälden häufig abgebildet.
Schwieriger, das räumt auch das von dem Vertrag begeisterte bürgerliche Wochenendmagazin ein, wird es bei »freizügigen« Darstellungen, auf denen etwa nackte Haut zu sehen ist. Zensur werde aber auf keinen Fall geübt, beruhigt es seine Leser: »Es wird an den französischen Kuratoren liegen, Taktgefühl zu beweisen.« Provokationen wie etwa ein Verleihen des berühmten Gemäldes »L’origine du monde« (Der Ursprung der Welt) von Gustave Courbet gelte es jedoch »zu vermeiden«.



 Nazis am Nil
Nazis am Nil