Die Avantgarde der Sanierung
Nele, Trixi und Fabsi sind traurig. Friedrichshain ist inzwischen genauso öde wie Mitte. »Es gibt keine Freiräume mehr«, schimpft Trixi. Nele ruft kämpferisch: »Die Stadt gehört uns!« Und Fabsi schmollt: »Menno!« Und dafür sind unsere drei Freunde vor zweieinhalb Jahren aus Laatzen, Peine und Görlitz nach Berlin gezogen? Das darf nicht wahr sein! Irgendwer muss was tun! Berlin, das ist bekanntlich ein großer Selbstverwirklichungspark mit Drogen und Medien und so. Der Ort, an dem man erreicht, was man wirklich, wirklich will. Und jetzt soll der Traum vorbei sein?
Ein Glück, dass Nele, Trixi und Fabsi ganz schnell ein neues Friedrichshain finden. Es heißt Neukölln. Und noch viel mehr Glück: Alle Freundinnen und Freunde aus Mitte, Prenzlauer Berg und Kreuzberg sind auch schon in Neukölln. Und siehe da: Ulf und Nanni haben wieder eine Kneipe aufgemacht! Und noch toller: mit den gleichen Möbeln! Doch wenn man in Neukölln auf die Straßen geht, fühlt man sich immer noch ganz authentisch.
Was klingt wie der Anfang eines neuen Romans aus der Hildesheimer oder Leipziger Schreibschule, entspricht leider der Wirklichkeit. Die Infantilisierten, die Kleinkünstler und die Partygängerinnen, die mitgeholfen haben, die Innenstadtkieze im Osten Berlins zu verteuern, indem sie die bis 1990 dort siedelnde Bevölkerung vertrieben, sind längst Opfer ihres eigenen Tuns geworden. Denn so wie sie die Kieze mit Kneipen, offenen Ateliers, Debattierklubs und Fahrradwerkstätten überzogen, werden sie nun durch die Mittelständler aus ihren WGs gedrängt. Die eröffnen dann Bioläden, Kaffeeläden, Holzspielzeugläden und anderes, was auf den ersten Blick der vorhergehenden Kleinkünstlerei sehr ähnlich ist, sich allerdings auf den zweiten Blick, dem Blick auf die Preise nämlich, völlig davon unterscheidet. Nun darf man allerdings die Vertriebenen, die deutsche Geschichte lehrt uns das, nicht immer nur pauschal als Opfer begreifen. Und man darf froh sein, wenn einem mancher Nachbar erspart geblieben ist.
Zudem sind die Städterin und der Städter wandelbare Wesen, was heißt, manche haben an ein und demselben Ort alle Stadtentwicklungsschritte mitgemacht, haben sich also selbst von der derben Ostproletin zur »bewussten Verbraucherin« herabdegradiert. Andere aber haben die Lebensentwürfe, die diese abgelegt hat, willig aufgegriffen, als sie aus Stuttgart oder Kiel in die Hauptstadt zogen, und leben nun an anderer Stelle die, sagen wir mal, Hippie-Phase ihres Vorbilds nach. Nicht jede und jeder also zieht mit der Karawane weiter.
Doch allein das, was sie, also die oben als Infantilisierte Bezeichneten, tun, ist wichtig. Es gibt sie vornehmlich in der Masse. Weil sie in der Masse bleiben, haben sie keine Verantwortung, die sie für sich allein oder für ihre Bank schon mal übernehmen. In der Masse aber können sie einer verlängerten Dauerpubertät nachgehen. Die Infantilisierten bewegen sich, das war schon 1990 absehbar, so lange im S-Bahnring und im Kreis um den Mittelpunkt der Mitte Berlins herum, bis auch das letzte Fitzelchen Ost- und Westrückstand beseitigt ist. Da dieser Prozess in Mitte, Prenzlauer Berg und Friedrichshain als weitgehend abgeschlossen bezeichnet werden kann, geht es nun an die Westbezirke. In Kreuzberg haben die alten Hausbesetzer, die, wenn man so will, eine Avantgarde dieser unfreiwilligen Stadtsanierer darstellten, sich bereits weitgehend eingenistet und die Stadtteilsanierung selbst durchgeführt, selbst der noch vor wenigen Jahren für unbelebbar gehalte Streifen rund um den U-Bahnhof Schlesisches Tor ist inzwischen restlos durchgestaltet.
Bleiben Wedding, Moabit und Neukölln. Um die Kinderarmee der Stadtsanierer aber in einen bestimmten Bezirk zu locken, bedarf es einer gewissen Infrastruktur. Am wichtigsten sind in Berlin dabei die U- und S-Bahnen, danach die Straßenbahnen. Wir wissen, der Unbedarfte muss immer sehen können, wo und wie die Strecke verläuft, den Bus findet er nie von selber. Daher ist das so genannte Nordneukölln, also der Bereich des Bezirks Neukölln, der sich innerhalb des S-Bahnrings befindet, klar im Vorteil. Zwei wichtige U-Bahnen verlaufen hier, dazu dann noch die Ringbahn, die die Vorhut der Kiezeroberer immer wieder leicht nach Friedrichshain und Prenzlauer Berg zurückkutschiert. Zweite wesentliche Vorausbedingung sind billige Mieten, diese gehen oft einher mit einer Bevölkerung, die sich nicht wehren kann, diese ist die dritte Voraussetzung für eine gelungene Sanierung. Entweder hat diese Bevölkerung migrantischen Hintergrund, sodass die Polizei ihren Beschwerden über, beispielsweise, nächtlichen Partylärm sowieso nur selten nachgeht, oder sie ist zumeist so besoffen oder durch anhaltende Armut auf andere Weise ihrer Persönlichkeit beraubt, dass sie eher hilflos als aggressiv ist. Merke: Diese Bevölkerung braucht man nicht nur, um sie verdrängen zu können, man braucht sie zugleich, um sich mit ihr zu schmücken. Das hat Tradition in Preußen, schon die Fürsten des Barock nannten sich Preußen nach jenem Volk an der russischen Grenze, das ihre Vorfahren vom Deutschen Ritterorden nahezu vollständig ausgerottet hatten. Dementsprechend wird von Zugezogenen gern und mit Sensationslust auf die stets betrunkenen Halbobdachlosen vor den Supermärkten verwiesen, deren Zahl allerdings zusehends abnimmt. Man erklärt sie zu einem Teil des eigenen Lebens. Denn sie gehören zum Kiez, zu uns, man selbst gehört aber nie zu ihnen. Wer »Wir« ist, bestimmt der, der spricht. Es spricht, wem zu sprechen erlaubt ist. Der Betrunkene, der pittoreske Prolet aber hat keine Stimme.
Die Bezirke Wedding, Moabit und Nordneukölln liegen, was die letzteren Bedingungen angeht, beinahe gleichauf, doch Neukölln hat den Verkehrsvorteil. Auch die Nähe zu den erfahrenen Brüdern und Schwestern in Kreuzberg gibt der Sanierungsavantgarde in Neukölln eine gewisse Sicherheit. Wenn man eine Prognose wagen darf – noch vor dem Wedding ist Moabit dran, die Verkehrsanbindung dort verbessert sich seit Eröffnung des Berliner Hauptbahnhofs immer mehr, eine Straßenbahn ist bereits in Planung.
Doch zurück nach Nordneukölln. Dort wird mithilfe von Zwischennutzungen, halblegalen Galerien und legalen Kneipen, die aber mithilfe von mühevoll improvisierter Möblierung den Charme des Vorläufigen bewahren wollen, ein Lebensbereich geschaffen, auf den man stolz sein soll. War es vor drei Jahren noch absolut üblich, dass Atze und Hussein, die unweit der Sonnenallee aufgewachsen sind, mit gewissem Stolz ein »Neukölln 44«-T-Shirt auf der Bodybuilding-gestählten Brust trugen (44 bezieht sich auf die alte Bezirkseinteilung Berlins), so tragen diese T-Shirts nun Hänflinge, die unweit von Meißen oder Münster eine glückliche Kindheit erleben durften. Hussein und Atze dagegen sieht man sowieso immer seltener.
Der kindische Stolz auf die Adresse bringt eine merkwürdige Identifikation mit sich. In Berlin war es schon vor dem Fall der Mauer üblich, über frisch hergezogene Westfalen zu witzeln, die sich als »alte Berliner« begriffen. Heute findet man »gelernte Neuköllner«, die mal gerade den Namen der Straße, in der sie wohnen, kennen, schon bei der Querstraße hört die Kenntnis auf.
Diese nun verteidigen Neukölln gegen den Zuzug im Allgemeinen und gegen die Gentrifizierung im Besonderen. Interessant ist das Schlagwort »Gentrifizierung« selbst. Die, die es benutzen, wenden es nämlich in der Regel nicht auf sich selbst an. Sie glauben, genau zu wissen, was sie tun. Und nun verteidigen sie das Wohngebiet, in dem sie wohnen, im Namen der Arbeiterfamilie, die vorher in ihrer Wohnung wohnte. Und schimpfen auf jene, die nachziehen. Ihre Klageabende finden in jenen Kneipen statt, die dort sind, wo vorher eine Proll-Kneipe oder ein libanesisches Männercafé ausziehen musste.
Damit wir uns nicht missverstehen – die Gentrifizierung ist keine schöne Sache, erhöht sie doch die Miet- und die Bierpreise. Aber man muss zugeben, dass man ein Teil von ihr ist, und nicht etwa ein neutraler Verteidiger. Dass man aber selbst die Vorhut jener ist, vor denen man warnt, wird in den ganzen oberflächlichen Gentrifizierungsdebatten, in denen sich die Linke gefällt, nie zugegeben. In die Läden derer, die man zu verteidigen vorgibt, will man allerdings nicht gehen. Darum macht man eigene auf. So war es in Berlin-Mitte, so war es in Prenzlauer Berg, so war es in Friedrichshain, so ist es in Neukölln.
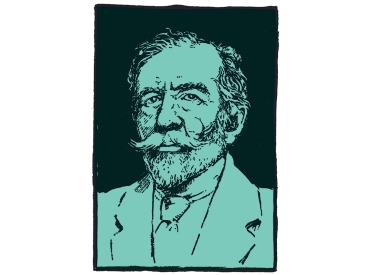


 Rock im Sahel
Rock im Sahel