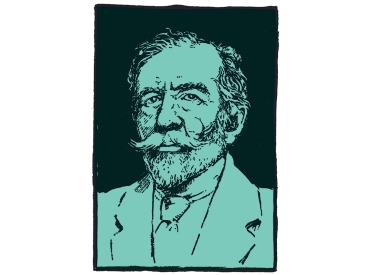Gute Zeiten, schlechte Zeiten auf Italienisch
Seit Jahren hat das deutsche Feuilleton den politisch-kulturellen Verfall Italiens zu beklagen. Für sein linksliberales Publikum ist das kaum auszuhalten. Wie soll man seine Italien-Begeisterung noch rechtfertigen? Wo bleibt das Positive? Die Berliner Literaturwissenschaftlerin Maike Albath hat es endlich wiederentdeckt: den stolz aufgerichteten Straußenvogel des Turiner Einaudi-Verlags. Er war in Italien jahrzehntelang das Markenzeichen für schöne Literatur, gute Übersetzungen und engagierte Essayistik. In ihrem Buch »Der Geist von Turin. Pavese, Ginzburg, Einaudi und die Wiedergeburt Italiens nach 1943« schildert sie die Ursprünge des berühmten Verlagshauses. Sie verfolgt dabei eine präzise Absicht: »Der Geist von Turin ist der Versuch, an ein anderes Italien zu erinnern. An das stille, leise Italien, das im TV-Lärm des Berlusconi-Zeitalters unterzugehen droht.«
Die Rezensenten waren entzückt, sie ließen sich von den Porträts der Turiner Schöngeister bezaubern. Der schmale, in angemessen bibliophiler Aufmachung erschienene Band wurde hochgelobt. Einhellig bescheinigte man der Autorin, ihr Versuch sei gelungen, das Buch vermittle die Hoffnung, Italien könne eines Tages aus dem »Berlusconi-Taumel« erwachen und zu alter, intellektueller Größe zurückfinden.
Mit der klaren Trennung zwischen einem ehemals schönen und nunmehr hässlichen Italien macht es sich die Autorin jedoch zu einfach. Das Turiner Verlagshaus geriet in wirtschaftliche Schwierigkeiten, lange bevor das verachtete »grelle und spektakulär vulgäre TV-Italien Berlusconis« sich durchsetzen konnte. Albath muss selbst eingestehen: »Die Entwicklung Einaudis ließe sich auch als eine Parabel auf den Niedergang der italienischen Linken insgesamt verstehen, die heute taumelnd nach ihrer Identität sucht. Das Haus, das schon seit 1994 zu Mondadori und damit zu Berlusconis Medienimperium gehört, ist auch ein Exempel für die Umwälzungen, die Italien in den letzten Jahrzehnten erfahren hat.«
Während die Politik Nachkriegsitaliens über 40 Jahre lang von der christdemokratischen Partei beherrscht wurde, prägten linke Intellektuelle, Filmemacher und Schriftsteller das kulturelle Leben. In enger Zusammenarbeit mit der Kommunistischen Partei Italiens schuf der Einaudi-Verlag die Meistererzählung von der italienischen Wiedergeburt im Geist des antifaschistischen Widerstands. Der Befreiungskampf der Resistenza gegen den nazifascismo wurde zum Gründungsmythos der Republik stilisiert. »Die Einaudianer stimulierten, lasen und verlegten sich nicht nur gegenseitig, sondern bemühten sich auch noch um gut platzierte Besprechungen in den großen Blättern. Dass sie die Titel selbst herausgebracht hatten und natürlich selbst Partei waren, spielte keine Rolle. Im Gegenteil: Sie wollten den Diskurs bestimmen und kulturelles Territorium besetzen. Sie machten Politik.«
Mitte der achtziger Jahre änderte sich das politisch-kulturelle Klima. In der italienischen Öffentlichkeit begann eine geschichtsrevisionistische Debatte, die den Resistenza-Mythos in Frage stellte. Seit Berlusconis erstem Wahlsieg 1994 hat sich diese Diskussion verschärft. Der Revisionismus zielt darauf, den italienischen Faschismus aufzuwerten und die kulturelle Hegemonie der Linken zu brechen. Als Anfang der neunziger Jahre Journalisten des rechten Spektrums anfingen, an die Verstrickungen führender Nachkriegsintellektueller mit dem faschistischen Regime zu erinnern, ging es weniger um die Aufarbeitung spezifischer Vergehen, sondern allgemein um die Demontage des italienischen Antifaschismus. Einer der berühmtesten Intellektuellen aus dem Einaudi-Umfeld, denen Kompromisse mit dem faschistischen Regime vorgeworfen wurden, war der inzwischen verstorbene Turiner Philosoph Norberto Bobbio. Er aber habe sich – so Albath – den Anschuldigungen »offen und selbstkritisch« gestellt: »Ganz anders als viele seiner deutschen Generationsgenossen, denen ihre Verwicklung mit dem NS-Regime ebenfalls mit großer Verspätung vorgehalten wurde – die Verhältnisse sind allerdings kaum vergleichbar. Der italienische Faschismus unterscheidet sich erheblich vom deutschen Nationalsozialismus; er ist allerdings auch viel weniger aufgearbeitet worden. Auch deshalb gibt es in Italien nicht diese moralische Hysterie, die in deutschen Medien in solchen Fällen häufig geschürt wird.«
Dass sich die deutsche Literaturwissenschaftlerin mit moralischen Urteilen über das Verhalten italienischer Intellektueller während des Faschismus eher zurückhält, lässt sich nachvollziehen (ihre nebenbei vorgenommene Pathologisierung derjenigen, die ihre »deutschen Generationsgenossen« kritisieren, ist dagegen weniger verständlich), doch um den gesellschaftlichen Rechtsruck in Italien zu verstehen und zu begreifen, warum das revisionistische Geschichtsbild mittlerweile hegemonial werden konnte, muss man sich mit der mangelnden Aufarbeitung des italienischen Faschismus und mit den blinden Flecken des jahrzehntelang kultivierten antifaschistischen Selbstbildnisses der italienischen Linken auseinandersetzen.
Der Einaudi-Verlag wurde 1933 gegründet. Der faschistische Diktator Mussolini regierte bereits seit über zehn Jahren, das Regime hatte seine Macht konsolidiert. Albath unterschlägt nicht, dass Einaudi in den ersten zehn Jahren seines Bestehens eine ambivalente Haltung gegenüber dem Faschismus einnahm. Zwar entstammten alle drei Verlagsgründer dem in Turin sehr ausgeprägten liberalen, antifaschistischen Milieu, doch anders als ihr jüdischer Freund Leone Ginzburg konnten Pavese und Einaudi auf Zugeständnisse hoffen, sogar mit dem Regime verhandeln. Albath rechtfertigt und verharmlost die Kompromisse als ebenso geschickte wie notwendige »diplomatische Schachzüge« zur Aufrechterhaltung editorischer Freiräume. Die Rolle, die Einaudi-Mitarbeiter im faschistischen Literaturbetrieb tatsächlich einnahmen, wird keiner kritischen Analyse unterzogen. Die Autorin macht sich grundsätzlich die entlastende Selbstdarstellung Einaudis zu eigen.
Das Schicksal des jungen Verlagsmitarbeiters Giaime Pintor, der sich 1943 für den aktiven Widerstand entschied und nach wenigen Wochen getötet wurde, beschreibt sie als paradigmatisch: »Anfänglich vom Faschismus durchaus angezogen, steht der charismatische Pintor für einen Wandel, den seine Generation durchgemacht hatte: Dass ausgerechnet er sterben musste, bestürzte die Einaudianer. Unzählige Altersgenossen waren von einem ähnlichen Drang wie Pintor getrieben.« Diese Darstellung schreibt nicht nur die Legende von der Resistenza als Massenbewegung fort, sie übergeht leichtfertig die Zeit, die vor dem vermeintlichen »Wandel« lag. Der 1919 geborene Pintor gehörte einer Generation an, die komplett im Faschismus sozialisiert worden ist. Der alte bürgerlich-liberale Antifaschismus, der das Regime als »Krankheit« betrachtete, die das Land überstehen würde, war ihm fremd. Mussolinis Herrschaft schien ihm auf Dauer gestellt. Deshalb betrachtete er auch den konspirativen Antifaschismus der Widerstandsgruppen, der darauf spekulierte, die italienischen Massen könnten sich gegen die Diktatur erheben, kritisch. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs gehörte Pintor zur jungen intellektuellen Führungsschicht des Regimes. Wie viele seiner Weggefährten arbeitete er sowohl für die faschistischen Kulturinstitutionen als auch für den Einaudi-Verlag. Er war ein anerkannter Germanist, als literarischer Vermittler reiste er häufig ins nationalsozialistische Deutschland. Den offiziellen NS-Dichtern konnte er nichts abgewinnen, ihm gefiel der elitäre, antidemokratische Ton eines Carl Schmitt. Erst nach Mussolinis Sturz im Juli 1943 entschied sich Pintor für den patriotischen Befreiungskampf gegen die deutschen Besatzer.
Unzählige seiner Altersgenossen verhielten sich dagegen wie der Verlagsgründer Cesare Pavese. Von der kriegerischen Ästhetik Gabriele D’Annunzios oder Ernst Jüngers angezogen, sympathisierte er nach der deutschen Besetzung Norditaliens für kurze Zeit mit den Nationalsozialisten. Albath zitiert aus seinem Arbeitstagebuch: »Boden und Blut – heißt es nicht so? Die Leute haben den richtigen Ausdruck gefunden. Warum hast du 1940 wohl angefangen, Deutsch zu lernen? Diese Lust, die dir damals mit dem Nutzen zusammenzuhängen schien, war der Impuls des Unterbewusstseins, in eine neue Wirklichkeit eintreten zu wollen. Ein Schicksal, amor fati.« Dieser offenkundigen Faszination für die nationalsozialistische Ideologie fügt Albath die erklärend-entschuldigenden Sätze hinzu: »Paveses plötzliches Bekenntnis zu Blut und Boden klingt eine Spur zu selbstsicher und hat mit Gewissensbissen zu tun. Während seine Freunde ihr Leben riskieren, hatte er sich der Verantwortung entledigt. Dass er sich jetzt in Mythentheorien und Blutsrituale vertiefte, zeigt seine Schwäche in aller Deutlichkeit. Wenn es um Politik ging, war er sehr von den Zeitstimmungen abhängig.«
Ganz anders beschrieb Pavese seine Haltung in dem noch während des Krieges verfassten, deutlich autobiographische Züge aufweisenden Roman »Das Haus auf den Hügeln«. Sein Protagonist gehört zur sogenannten Grauzone, er entscheidet sich während des Bürgerkriegs 1943–45 weder für die Unterstützung der Nazifaschisten noch für den Partisanenkampf und verharrt bis Kriegsende in einem Versteck. Gewissensbisse plagen ihn selten, er steht zu seiner Entscheidung.
Der Begriff der »Grauzone« wurde von Primo Levi geprägt. Auch er ist Einaudi-Autor, doch keiner der ersten Nachkriegsstunde. Der Bericht des ehemaligen Auschwitz-Häftlings, »Ist das ein Mensch«, wurde 1946 zunächst nicht bei Einaudi publiziert. In einem Brief Paveses, der auf die Absage an Levi Bezug nimmt, heißt es: »Wir lehnen generell jedes Buch zu diesem Thema ab.« Die Geschichte der jüdischen Opfer hätte Fragen nach den faschistischen »Rassegesetzen« und einer italienischen Mitverantwortung an der Shoah aufgeworfen. Erst in den späten fünfziger Jahren änderte sich die Verlagspolitik, nun konnte auch Levis Buch erstmals bei Einaudi erscheinen.
In ihrer Darstellung der faschistischen Diktatur bedient sich Albath nicht selten Bagatellisierungen und Verharmlosungen, die für den revisionistischen Vergangenheitsdiskurs in Italien typisch sind. So beschreibt sie die Mussolini-Anhänger als »oberflächlich angepasste Faschisten«, als »Karrieristen mit dem richtigen Parteibuch« und kolportiert den Mythos von den anständigen Italienern: »Immer wieder stellten selbst Polizeipräsidenten jüdischen Flüchtlingen Pässe aus und widersetzten sich amtlichen Anweisungen.« Die Weigerung der Einaudianer, sich mit der faschistischen Vergangenheit einiger Mitarbeiter und der Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden auseinanderzusetzen, lässt Albath unerwähnt. Stattdessen zitiert sie einmal mehr unkritisch Giulio Einaudi, der 1946 die Linie des Verlags vorgibt: »Das Verlagshaus Einaudi hat seine Aktivitäten wieder aufgenommen. Wir tun dies in Erinnerung und im Namen von Leone Ginzburg und Giaime Pintor, die für die Befreiung Italiens gefallen sind, nachdem sie die Entwicklung und die Richtung des Verlags durch ihre moralische Haltung und ihren Geist geprägt haben. Auf dieses Erbe und auf seine Kontinuität ist der Verlag stolz, fühlt sich beiden verpflichtet, baut darauf ohne Reue und Vorbehalte auf.«
Die Unterschiede in den Biografien Ginzburgs und Pintors werden dabei unterschlagen. Ginzburg war zehn Jahre älter als Pintor: Er gehörte seit Beginn der dreißiger Jahren zu jenem konspirativen Antifaschismus, den der Jüngere ablehnte. Das Regime bestrafte seinen politischen Widerstand mit Haft. Infolge der antijüdischen Gesetze verlor Ginzburg die italienische Staatsbürgerschaft, er wurde mit seiner Familie in ein süditalienisches Bergdorf verbannt. Nach Mussolinis Sturz schloss er sich dem römischen Widerstand an. 1944 wurde er bei einer Razzia aufgegriffen und in einer Gefängniszelle der deutschen Besatzer zu Tode gefoltert. Die sozialistisch-republikanische Aktionspartei, der Ginzburg angehört hatte, forderte nach dem Krieg eine klare Abgrenzung von den ehemaligen Faschisten und eine Art re-education für die Generation der im Faschismus sozialisierten Intellektuellen. Giulio Einaudi folgte dagegen der von der Kommunistischen Partei vorgegebenen Linie, die mit dem Faschismus kompromittierten jungen Leute am Aufbau einer »progressiven Demokratie« zu beteiligen, er band sie in die Verlagsarbeit mit ein.
Die problematischen Aspekte dieser Art Vergangenheitsbewältigung werden von Albath nicht thematisiert, stattdessen beschwört sie den antifaschistischen Geist von Turin gegen die »kulturelle Barbarei« des Berlusconi-Regimes. Doch der verklärte Blick auf die Anfangsjahre des Verlags und die unhistorische Fortschreibung des Resistenza-Mythos werden gegen den Revisionismus nichts ausrichten können und kaum zur erhofften kulturellen »Wiedergeburt« Italiens beitragen. »Das Erbe der Via Biancamano – dem Stammsitz des Einaudi-Verlags – ist ein Reservoir, auf das sich zurückgreifen ließe«, schreibt Albath am Schluss ihres Buches. Dies gilt tatsächlich auch für die notwendige Aufarbeitung der faschistischen Vergangenheit: Wichtige Arbeiten zum Thema wurden in den vergangenen Jahren von Turiner Historikern bei Einaudi oder in Verlagshäusern, die von ehemaligen Einaudi-Mitarbeitern gegründet wurden, veröffentlicht. Die Autorin hätte gut daran getan, sich mehr auf den zeitgenössischen, kritischen Geist von Turin zu berufen.
Maike Albath: Der Geist von Turin. Pavese, Ginzburg, Einaudi und die Wiedergeburt Italiens nach 1945. Berenberg, Berlin 2010, 189 Seiten, 19 Euro
Zu Giaime Pintor ist gerade eine Doktorarbeit auf Deutsch erschienen.
Monica Biasiolo: Giaime Pintor und die deutsche Kultur: Auf der Suche nach komplementären Stimmen. Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2010. 586 S., 85 Euro


 Nazis am Nil
Nazis am Nil