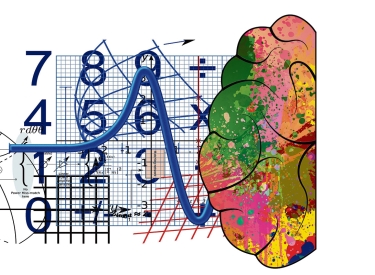Koscher kicken
Mill Hill, Nord-London. Die letzte Station der Underground liegt eine Viertelstunde zu Fuß entfernt. Was junge Männer an einem Donnerstagabend in die Pendlerschlafstadt auf den Hügeln treibt, ist eine Ansammlung von Trainingsplätzen mit Kunstrasen. Auf einem davon bereitet sich Tottenham Chutspah für das nächste Match vor. »Abraham!« klingt es an diesem kalten Abend. »Ariel!« – »Zach!« – »Jono!«
Tottenham Chutspah sind mit einem Durchschnittsalter von 17 Jahren das jüngste Team der Maccabi Southern Football League (MSFL), der größten jüdischen Amateurliga der Welt. Weil es ihre erste Saison ist, haben sie ganz unten begonnen, in der vierten Division. Doch dabei soll es nicht bleiben. Ariel Tamman, der Manager mit braunem Lockenkopf und Jungengesicht, ist angriffslustig. »Klar ist unser Name ein nettes Wortspiel. Aber vor allem heißen wir so, weil chutspa im Hebräischen ›frech‹ bedeutet.«
Fußball und die moderne jüdisch-orthodoxe Community Nord-Londons, die das Leben nach der Tora ausrichtet und doch in die Mehrheitsgesellschaft integriert ist – das verbindet Ariel Tamman und seine Freunde. Sie trafen sich vor sechs Jahren auf dem Immanuel College, einer jüdischen High School. Warum es jüdischer Fußball sein soll anstatt eine gemischte Liga? Fünf der Freunde sitzen verschwitzt im Gemeinschaftsraum des Trainingszentrums. Die Verteidiger Ariel Tamman und Abraham Sofer, Captain Zach Perez, Mittelfeldstratege Sammy Hakimian und Topscorer Jono Goan, der druckreif formuliert: »Hier können wir unsere Liebe zum Fußball mit unserer Liebe zum Judentum verbinden.«
Doch das ist nicht alles. Zach Perez hat früher beim besten jüdischen Jugendteam der Region gespielt, den London Maccabi Lions FC. Bei Spielen »gegen nichtjüdische Teams kam es öfter zu antisemitischen Beleidigungen, meist nach dem Abpfiff«, erinnert er sich. Sammy Hakimian, dessen Eltern aus dem Iran auswanderten, stimmt ihm zu. »Als ich in unserer Schulmannschaft spielte, gab es viele dieser Vorfälle. Verbale, aber auch körperliche.« Schockiert klingen sie nicht, wenn sie davon erzählen. Eher als hätten sie gelernt, diese Situationen als gegeben hinzunehmen.
Der Geist der Community und der Wunsch nach einem Raum, der frei von Antisemitismus ist, standen 1950 an der Wiege der Maccabi Southern Football League. Wer wüsste das besser als David Wolff, seit einer halben Ewigkeit ehrenamtlicher Ligachef. Wolff, 66 Jahre alt, ist ein freundlicher kleiner Herr mit grauem Schnauzer und juvenilem Hoody, der mit leiser Stimme spricht. »Am Anfang ging es darum, dass die Communities untereinander Fußball spielten«, erinnert er sich. »In säkularen Zeiten ziehen Kirchen oder Synagogen nicht mehr viele Menschen an. Fußball ist darum oft das Bindeglied zur jüdischen Community.«
Dass es auch im England der Nachkriegszeit Judenfeindlichkeit gab, »obwohl wir gegen die Nazis gekämpft hatten«, habe den Aufschwung der Liga begünstigt. Dazu kam, dass die Football Association Sonntagsfußball erst in den Sechzigern akzeptierte, obwohl damals wie heute viele säkulare Juden am Shabbat nicht kicken. »Früher«, sagt Wolff, »gab es auch eine jüdische Liga im Norden, und eine weitere in London, in der aber auch nichtjüdische Spieler erlaubt waren.« Heutzutage ist außer der MFSL nur noch die Manchester Jewish Soccer League mit zwölf Teams übrig.
Im Laufe einer Saison versucht David Wolff, jedes Team einmal zu sehen. Die meisten tragen nur den Namen ihres Viertels. Ein paar erinnern an Bunte-Liga-Kalauer, etwa Boca Jewniors, Jewventus oder Athletic Bilbaum. Selten kommt jemand so fromm daher wie der Holy Mount Zion FC, der sich 2005 anmeldete. Vielleicht hätte David Wolff misstrauisch werden sollen, denn bald kamen Beschwerden, bei Mount Zion kickten Nichtjuden, die sich auf den Spielerpässen jüdische Namen gegeben hätten. Als die Sache 2011 aufflog, bescherte das der MFSL internationale Schlagzeilen. Mount Zion zog sich aus dem Betrieb zurück.
Mehr Freude hatte Wolff an dem Aufnahmeantrag, den er Anfang 2012 aus dem orthodox geprägten Quartier Golders Green in Nordwest-London bekam. Die Kommission, bestehend aus einem Spieler pro Mannschaft, hieß die jungen Kicker einstimmig willkommen. Wolff selbst feierte den Namen Tottenham Chutspah in seiner Kolumne zum Saisonbeginn für die Wochenzeitung Jewish Cronicle regelrecht ab. Noch immer ist die Zuneigung ungebrochen. »They are very nice kids. Lovely kids«, sagt er beinahe gerührt. »Ich bin sehr beeindruckt von ihnen.« Das Viertel, in dem die »lovely kids« zu Hause sind, gilt als eines der jüdischsten in ganz London. Die Hauptstraße mit beschaulichen zweigeschossigen Mittelklassehäusern wird am Freitagmittag zur Kulisse für die letzten Shabbateinkäufe. Nicht nur Bäckereien und Supermärkte sind hier koscher, auch indische und chinesische Restaurants haben das entsprechende Zertifikat eines Rabbiners im Schaufenster. Die Aushänge an den Laternenpfählen kündigen Veranstaltungen im Jewish Community Centre an.
Es ist nicht gerade so, dass der Fußball in Golders Green allgegenwärtig ist. Nicht wenige der streng orthodoxen Bewohner haben noch nie von der MSFL gehört. Ariel, Abraham und die anderen tragen als moderne Orthodoxe weder Schläfenlocken noch schwarzen Mantel und Hut. Doch sind sie bekannte Gesichter geworden, seit sie als Tottenham Chutspah jede Woche in den Fußballberichten des Jewish Chronicle stehen. »Viele Menschen sprechen uns darauf an«, sagt Mittelfeldspieler Sammy Hakimian, der auf der Straße regelmäßig Passanten grüßend zunickt.
Ganz anders als in Golders Green sieht es im Osten Londons aus. Das East End, jahrhundertelang erste Anlaufstelle von Immigranten, war einst stark jüdisch geprägt. Bettelarm waren seine Bewohner, und wer es von hier weg schaffte, zog in den Westen der Stadt. Wer blieb, richtete sich in gemischten Quartieren ein, zwischen Nachbarn aus allen Ecken der Welt. Der proletarische Charakter des East End hat auch die dortigen Juden beeinflusst – und ihren Fußball.
Wie es aussieht, wenn West und Ost aufeinanderprallen, zeigt sich an einem windigen Sonntagvormittag im tristen Außenbezirk Ilford. Hier liegt der Platz von Glenthorne United. Beliebt ist er nicht gerade bei Teams aus dem Westen, wegen der langen Anfahrt. »Sie sagen, es ist ein schlepp. Aber für uns gilt das auch, wenn wir zu ihnen müssen.« Glenthorne-Vorsitzender John Featherman ist einer von einer guten Handvoll Zuschauern, die aus dem nächsten Umfeld kommen.
Zwei Hunde sind auch dabei. Den großen braunen hat Featherman nach Gianluca Vialli »Luca« benannt, der kleine weiße heißt Lily. »Nach Lilywhites, dem Spitznamen von Tottenham Hotspurs«, sagt Besitzer Gary Green, dessen Bestattungsunternehmen der Trikotsponsor von Glenthorne ist. »Seit wann eigentlich?« fragt Featherman. »Schon immer«, antwortet Green. Die beiden Mittfünfziger spielen zusammen bei den »Masters«, dem Altherrenteam von Glenthorne.
Dass die Mentalität hier eine andere ist, daran lassen sie keinen Zweifel. »Die Rivalität zwischen Ost- und West-Londoner Juden wird von einer Generation zur nächsten weiter gegeben«, so Featherman, dem man einige Kompetenz unterstellen darf. Er kommt aus dem bürgerlichen Westen, doch seit der Hochzeit mit einem East-End-Girl wohnt er hier, und es klingt, als sei ihm nie etwas anderes über die Lippen gekommen als dieser Slang mit den breiten Vokalen. »Wir im Osten sind mehr down to earth. Vielleicht gehen wir nicht so oft in die Synagoge, wie wir sollten. Aber sie sind auch nicht so religiös, wie es scheint. Sie lassen es nur gerne raushängen.«
Unterschiedlich verlief jedenfalls die Vorbereitung auf das Match. Die Spieler von Tottenham Chutspah gingen nach dem Shabbat gepflegt im jüdischen Viertel aus, während einige der blau gekleideten Glenthorne-Spieler im Nachtleben vollen Einsatz zeigten. Ganz ohne Verluste konnte das nicht gehen, und so steht der drahtige, 27jährige Mittelfeldspieler Andy Levy kurz nach Anpfiff bleich am Spielfeldrand. »Ich bin Ersatz heute. Zu verschädelt«, knurrt der Bauarbeiter. Die Nacht war denkwürdig. »Ich bin aus einem Club geflogen, weil ich mit einem Skelett tanzte, das dort zur Dekoration stand.«
Berührungsängste sind Andy Levy also fremd, was womöglich auch daran liegt, dass sein Alltag nun mal durch das multikulturelle East End geprägt ist. Auf der Trainingsjacke, die Levy noch von seinem vorigen Club hat, ist ein Davidstern. Bezeichnend, denn das einzig wirklich Jüdische in seinem Leben sei eben jüdischer Fußball. »Meine Freunde sind Juden, Muslime oder Sikhs, alles durcheinander.« Aus dem rauen Ton ihres Viertels resultiert ein körperbetonter Fußball – und ein Außenseiterimage, das Glenthorne United sorgsam pflegt. »Wir sind das Sankt Pauli des jüdischen Fußballs«, sagt Andy Levy mit einem Grinsen.