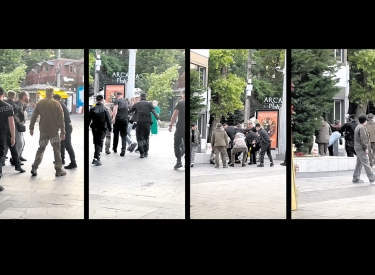»Die Schmerzgrenze ist noch nicht erreicht«
In vielen Medienberichten ist von einem Konflikt zwischen dem reichen, christlichen Süden und dem armen, islamischen Norden Nigerias die Rede. Trifft dieses Erklärungsmuster zu?
Im Prinzip ja, aber diese Struktur hat auch eine Geschichte, über die derzeit nicht berichtet wird. Vor genau 100 Jahren ist Nigeria, wie wir es heute kennen, entstanden. Es wurde am 1. Januar 1914 unter Führung des britischen Gouverneurs Frederick Lugard zwangsvereinigt, der dadurch zum Geburtshelfer vieler der bis heute existierenden Probleme wurde. Mit der Zwangsvereinigung zweier Lebenswelten, die fast nichts gemein hatten, wurde zugleich die Spaltung konstitutiv, auch wenn sie in den vergangenen 100 Jahren immer wieder übertüncht wurde.
Haben wir es also mit einem sezessionistischen oder separatistischen Konflikt zu tun?
Nein. Dieses Thema ist durch, seit ein Teil des Südostens Nigerias sich als Biafra abspalten wollte. Im Sezessionskrieg von 1967 bis 1970 hat eine erstaunliche Allianz aus dem christlichen Südwesten und dem islamischen Norden dies verhindert. Seitdem ist es eine Staatsdoktrin, dass ein »Unfall« wie Biafra, eine Sezessionsbewegung, nicht wieder passieren darf. Diesem Ziel wird fast alles untergeordnet.
Worin besteht der Unterschied zwischen dem Norden und dem Süden Nigerias?
Der Norden war aufgrund historischer Umstände von jeher rückständig. Er war ein vom Rest der Welt fast abgeschlossenes Gebiet, und die britische Kolonialregierung wie auch die ersten Regierungen nach der Unabhängigkeit 1960 haben dafür gesorgt, dass der Norden nicht in das Staatsgebiet integriert wurde, jedenfalls nicht im politischen, kulturellen, bildungspolitischen und ökonomischen Sinne.
Und ausgerechnet die kleine nördliche Oberschicht, die seit 1960 immer mit in den Regierungen saß, hat fast nichts getan hat, um in ihrem eigenen Gebiet Entwicklung zu initiieren. Dieses Trauerspiel lässt sich am besten am Bildungssektor zeigen. Im Norden geht nur jedes dritte schulpflichtige Kind in die Schule, im Süden sind es 70 Prozent.
Der Süden wurde durch eine aggressive Kolonialisierung relativ schnell christianisiert, bis etwa Mitte des 19. Jahrhunderts, und im Rahmen dieser Christianisierung fand auch eine Modernisierung statt. Der Zugang zum Meer war dabei natürlich ein Vorteil, die Hafenstadt Lagos ist regelrecht explodiert, und alles, was modern ist und Veränderung bringt, findet in der Küstenregion statt.
Der Norden hat dann in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts versucht, einen Weg zwischen Islam und Moderne zu finden. Es wurden einige Universitäten für westliches Know-how und vor allem sogenannte Islamiya Schools gebaut. Letztere waren entscheidend. Dort gab es alles, Mathematik und so weiter, aber die erste Fremdsprache neben der vorherrschenden Muttersprache Haussa war arabisch. Englisch war die zweite oder dritte Fremdsprache, auch deshalb wurden die kulturellen Fertigkeiten der Moderne dort nur rudimentär entwickelt.
Und was geschah im Süden?
Dort war es anders. Fast jeder kennt die Namen Wole Soyinka, der 1986 als erster Afrikaner den Literaturnobelpreis gewann, oder Chinua Achebe, Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels 2002. Sie repräsentieren eine Gesellschaft im Süden, die einmal eine Bildungsnation darstellte, in der fast jeder lesen und schreiben konnte, in der die Schulen mit denen in Westeuropa mithalten konnten, und auch die Universitäten ab 1960 hatten internationales Niveau. Vieles ist davon zerstört worden, aber Südnigeria lebt immer noch von der Substanz einer Bildungsexplosion, die dort etwa von 1930, 1940 bis in die achtziger Jahre stattfand. Man kann die Bedeutung hiervon kaum überschätzen.
Wenn Bildung so wichtig für Entwicklung ist, weshalb wendet sich dann Boko Haram ausgerechnet gegen »westliche Bildung«?
Dadurch, dass alle Welt sagt, »Boko Haram« bedeute »Westliche Bildung ist verboten«, wird es nicht wahrer. Das ist eine totale Fehlwahrnehmung und übrigens auch eine Erfindung nigerianischer Medien, die es nicht besser wissen konnten oder wollten. In der ursprünglichen Intention heißt der Name »Betrug und Täuschung sind verboten«, die grassierende Korruption und Bereicherung wurde mit westlichem Lebensstil verbunden.
Es geht Boko Haram nicht gegen »westliches« Wissen per se?
Nein. Ganz im Gegenteil ist Boko Haram ohne die digitale Revolution nicht denkbar. In Nigeria konnte man vor 15 Jahren praktisch nicht telefonieren. Mittlerweile gibt es 126 Millionen Handys. Selbst in den entlegensten Gebieten im Nordosten kann man mobil telefonieren, sozusagen der einzige Beitrag zur Moderne in den vergangenen Jahrzehnten. Boko Haram hat das sehr schnell verstanden und genutzt. Man konnte plötzlich sehen, was im Rest der Welt passierte. Ussama bin Laden wurde zum Popstar, man lernte die Funktion von Märtyrertum und dass man gegen die bösen westlichen Invasoren in Afghanistan, Irak und so weiter etwas unternehmen muss. Und man konnte sehen, dass in Südnigeria eine ganz andere Welt des Überflusses existierte. Aber auch Boko-Haram-Führer Abubakar Shekau kann sich über Youtube nur mitteilen, weil die digitale Welt selbst in dieser entlegenen Gegend existiert.
Wie ist das Verhältnis von Boko Haram zu Militär und Regierungskreisen?
Boko Haram genoss die Unterstützung lokaler Politiker, und einige Gouverneure räumten der Gruppe sogar nach 2009, also nachdem die Führung von Boko Haram in aller Öffentlichkeit vom Militär hingerichtet worden war, noch sichere Rückzugsräume ein. Es gab Zahlungen an Boko Haram. Auch als die ersten Kritiker von Boko Haram in einem Rachefeldzug ermordet wurden – übrigens alles muslimische Imame, keine Christen –, gab es dafür Unterstützung aus einem politischen Sympathisantenumfeld. Erst etwa 2012, als der Rest Nigerias vom Rachefeldzug Boko Harams erfuhr und die Gruppe ihr Aktionsgebiet ausweitete und vor allem in der Hauptstadt Abuja die ersten Bomben legte, sah sich die Zentralregierung zum Handeln genötigt. Davor galt die Sprachregelung, dass das Problem lokal gelöst werden sollte, damit habe man nichts zu tun.
Und hier kam das Militär ins Spiel, das in diesem Konflikt erneut eine sehr dubiose Rolle spielt. Nigeria litt lange Zeit unter verschiedenen Militärregimen, erst 1999, als die Militärs nicht mehr wussten, wie sie das Land unterjochen konnten, traten sie ab und kehrten in die Kasernen zurück. In den Jahren seit 1999 hatte das Militär tatsächlich wenig zu sagen.
Doch dann gab es die neue Krise, und die Militärs wurden aufgefordert, etwas zu tun. Sie sagten: Ja, wir machen das, aber wir brauchen Geld. Selten ist so viel Geld in kürzester Zeit mobilisiert worden wie in den vergangenen Jahren. Es geht um etwa sechs Milliarden Dollar pro Jahr, die für die Bekämpfung der Terroristen benutzt werden sollten. In Wirklichkeit aber versickert ein großer Teil des Geldes in den Taschen der beteiligten Militärs und Geheimdienste, der Polizei und der Politiker, welche die Gelder freigeben. Zudem gibt es ein riesiges Netzwerk ehemaliger Militärs, die über Nacht zu Sicherheitsberatern wurden.
Es ist also ein Geschäftsmodell, in dem in erster Linie die Sicherheitsapparate sich ohne Kontrolle bedienen konnten. Präsident Goodluck Jonathan hat das Schicksal ganzer Landstriche in die Hände der Militärs gelegt, und diese haben die Chance genutzt, wieder an den Tisch des Herrn zu kommen. Das vormals in seine Schranken verwiesene Militär kann jetzt wieder auf Augenhöhe mit der Politik agieren. Und ein Teil des Militärs bereichert sich nicht nur, sondern gehört zum Sympathisantenumfeld von Boko Haram, sonst wäre es der Organisation nicht möglich, so präzise Bomben zu bauen und solche Waffen zu besitzen. Aber in erster Linie sehe ich hier ein zynisches Geschäftsmodell, das auf den Rücken der einfachen Soldaten und der Zivilbevölkerung ausgetragen wird.
Was würden Sie von einer westlichen militärischen Intervention in Nigeria halten, würden Sie dieser eine Erfolgschance geben?
Wenn wir uns die Interventionen der letzten Zeit in Afrika ansehen, etwa in Mali, kann man nicht von einer Erfolgsgeschichte sprechen. Ich schätze die nigerianische Führung so ein, dass sie gute Miene zum bösen Spiel macht und auf das Angebot von Unterstützung eingehen muss. Aber die militärische Führung wird sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Sie werden Gäste willkommen heißen und auch gerne Geheimdienstinformationen aufnehmen, aber sie werden sich nicht das Kommando aus der Hand nehmen lassen. Das unwegsame Kerngebiet von Boko Haram umfasst etwa 70 000 Quadratkilometer, etwa die Größenordnung von Bayern, und ich sehe nicht, wie dort externe Sicherheitskräfte agieren könnten.
Die nigerianische Führung hört, wenn überhaupt, auf die US-Regierung. Sie wird nach außen so tun, als ob sie etwas im Sinne der westlichen Welt täte. Zugleich, und das ist sehr nigerianisch, wird sie dadurch unglaubliche Finanzressourcen von außen mobilisieren. Und wo die landen, ist klar: in denselben Kanälen wie die Militärausgaben.
Das Problem ist nicht die Ausrüstung des Militärs, sondern dass niemand willens und in der Lage ist, eine ordentliche Koordination zwischen Militär, Polizei und Geheimdienst herzustellen. Jede dieser Gruppen ist in erster Linie daran interessiert, sich so viel wie möglich aus dem großen Topf anzueignen. Daran scheitert derzeit jeder Versuch, erfolgreich gegen Boko Haram vorzugehen.
Die Geiselnahme der Schülerinnen hat Nigeria internationale Aufmerksamkeit beschert. Könnte das auch der Moment sein, in dem in Nigeria eine substantielle Reformbewegung entsteht?
Die Spaltung Nigerias setzt sich derzeit in einer traurigen Weise fort. Die Sprachregelung im Süden ist: Die dort oben im Norden sollen ihr Problem selbst lösen. Hinzu kommt ein fast schon unglaublicher Wirtschaftsboom im Süden. Dort brummt es und die großen und mittleren Kapitaleigner investieren und konsumieren wunderbar. Der Süden fühlt sich bestärkt im Vorurteil, dass der rückständige Norden selbst schuld sei und sie man Süden dafür nicht grade stehen sollte. Diese Sicht verstärkt die Spaltung im Land noch.
Für den Präsidenten Jonathan, ein Hydrobiologe aus dem Nigerdelta, der mehr oder weniger durch Zufall und ohne eigenen Beitrag in die Politik und ins höchste Staatsamt gelangt ist, ist die Welt von Boko Haram und der Norden so fremd wie nur irgendwas, das ist für ihn wie Sibirien oder die Antarktis. Selbst in der politischen Klasse im Süden sind die Vorstellungen vom Norden so diffus und von Unkenntnis geprägt, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie der Süden überzeugt werden kann, dazu beizutragen, dass im Norden endlich etwas passiert. Dazu bedürfte es eines Gesellschaftsvertrages. Und im Norden gab es einmal ganz, ganz zarte Pflänzchen an Entwicklung, aber davon ist nichts mehr zu sehen, selbst die Großstadt Kano als einziges Wirtschaftszentrum ist tot. Wie da eine Gesellschaft mobilisiert werden soll, dafür fehlt mir die Phantasie.
Ganz im Gegenteil wird gerade deutlicher als je zuvor, dass der alte Elitenkonsens zur Disposition stehen könnte. Dieser ist neben der Verhinderung eines weiteren sezessionistischen Bürgerkriegs die zweite Staatsdoktrin Nigerias. Er besagt, dass die Eliten in Nord- und Südnigeria sich einmal vor langer Zeit dazu durchgerungen haben, zu sagen, okay, wir leben zwar in unterschiedlichen Welten, aber wir können uns darauf verständigen, dass der Reichtum dieses Landes unter uns einigermaßen gleichmäßig und vor allem reibungslos verteilt wird. Dies geschieht durch eine Struktur, die ich als nigerianische Föderalismusvariante bezeichnen würde. Der Reichtum kommt zu 90 Prozent den doch recht zahlreichen Eliten und der gehobenen Mittelschicht zugute.
Dieser Elitenkonsens müsste aufgehoben werden, wenn den Problemen im Norden wirklich begegnet werden sollte. Das kann ich nicht erkennen, und ich sage Ihnen ganz offen: Die Schmerzgrenze für ein politisches Umsteuern ist meines Erachtens noch längst nicht erreicht. Selbst die Entführung der Mädchen interessiert im Süden kaum jemanden. Ich behaupte sogar, dass schon vor längerer Zeit eine Vorentscheidung gefällt worden ist, den unregierbaren und unterentwickelten Norden einfach aufzugeben.