Ellis im La La Land
Im ersten Moment ist man vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass Bret Easton Ellis’ neues Buch kein Roman ist, sondern nur ein Buch über Bret Easton Ellis. Dabei waren die Notizen zum neuen Roman schon gemacht. Der Autor verwarf das Projekt aber wieder und begann, ein Selbstporträt zu schreiben. Keine Autobiographie im engeren Sinne, dafür eine stimmige Mischung aus Erinnerung, Essay, Polemik und Hollywood-Hommage. Ellis denkt angenehm distanziert über seine Werke nach, darüber, wie sie entstanden sind, welche Wirkung sie hatten.
Es geht um Filme, Bücher und Künstler, mit denen er einverstanden ist, vor allem aber um Sachen, mit denen er nicht einverstanden ist, Safe Spaces, »Weicheier« und Lookismus zum Beispiel. Er wehrt sich gegen eine Debattenkultur, die vor toxischen Meinungen schützen will, und legt sich bevorzugt mit den Millennials an, dort, wo sie zu Hause sind – in den sozialen Medien. Generation X gegen Z also. Aber nicht nur.
Ellis erkor Donald Trump zur hässlichen Ikone der doppelgesichtigen Business- und Celebrity-Kultur.
Ellis, der Skandalchronist der achtziger Jahre, hielt den Moment fest, als der Kapitalismus abstrakt, der Pop hegemonial, die Anzüge teuer waren und die Sexualität als warenförmig imaginiert wurde. »Unter Null«, sein speedgetriebenes Jugendwerk, war das Porträt einer Clique reicher Teenager, die aus Langeweile zu allem fähig waren. »American Psycho«, sein Meisterstück, trieb die Exzesse der Yuppies in Gestalt eines Serienmörders und Wall-Street-Bankers auf die Spitze. Es war das Buch eines Autors, der seiner eigenen Generation dabei zusah, wie sie gegen die Wand fuhr. Und nun das: Der Schöpfer der Alpträume der Achtziger fängt als Kritiker der digitalen Gegenwartskultur wieder neu an.
Nach zwei in jungen Jahren veröffentlichten Kultbüchern ist das Lauern der Öffentlichkeit auf den nächsten Roman teils lästige, teils aufputschende Normalität geworden, wie auch der Spott über mittelmäßige Bücher wie »Glamorama«. Mit der Reflexion über die Form beginnt »Weiß«. Das Ideal der großen Erzählung hat an Strahlkraft verloren, ist durch kleinteiligere Formen ersetzt worden. Warum ihm also nacheifern? Ellis’ Essay gehorcht dem Bedürfnis, sich aus der analogen Welt der Romane in die digitale Welt vorzuarbeiten. Das heißt nicht, dass Internetformate für Ellis Neuland wären, er betreibt einen populären Podcast, schreibt an Web-Serien und ist eine Weile in den sozialen Medien sehr präsent gewesen. Es bedeutet aber, dass der kulturelle Wandel der Formate und Genres in die Reflexion eingeschrieben ist. Alles verschiebt sich, aber wohin?
»Weiß« hebt als Coming-of-Age-Erzählung an. Zwischen schrillem Disco-Musical und soften Teen-Sex-Komödien wächst Ellis im San Fernando Valley der siebziger Jahre auf. Ein normaler Haushalt mit einem irgendwie abwesenden Vater und einer nicht übermäßig besorgten Mutter. Horrorfilme sind das, was den Teenager mehr anzieht als irgendwas sonst. Den Horrorfilm beschreibt Ellis als eine Schule der Resilienz, die er mit John Carpenters traumatisierendem »The Thing« – vorläufig – abschließt. Man sieht: Der Unterschied zum Aufwachsen eines typischen Millennials mit Helikoptereltern ist beträchtlich.
Mit Paul Schraders »American Gigolo« beginnt ein neues Kapitel filmischer Sozialisation. Richard Gere spielt in dem hyperartifiziellen Neo-Noir-Film einen Callboy, dem ein Mord angehängt werden soll. Kein guter Film, schreibt Ellis, aber einer, der den Blick auf Männer verändert hat. Es ist die Art, über Filme zu reden, die einen für das Buch einnimmt, die Verbindung von subjektivem Begehren mit den Maßgaben der Kunst. Exzessiver Konsum von Body-Horror, Blicke auf den Waschbrettbauch des American Gigolo – man kann buchstäblich dabei zusehen, wie das Monster Patrick Bateman in den Kinosälen Kaliforniens gezeugt wird.
Ein dritter Einfluss entstammt der realen Welt: Donald Trump. Ellis erkor den damaligen Promi, Geschäftsmann und Playboy zur hässlichen Ikone der doppelgesichtigen Business- und Celebrity-Kultur. Bateman ist besessen von Trump, teilt dessen Obession für Models und bedient sich derselben infantil-großspurigen Rhetorik wie Trump in seinem Besteller »The Art of the Deal«. Trump ist Batemans ständige Referenz, sein Idol, der Übervater. Trump wird im Buch 40 Mal erwähnt.
Schon bald ist »American Psycho« einer der meistzitierten Buchtitel, ein Synonym für alles, was in den USA faul sein soll. Das Publikum hat das Buch nie vergessen: Auf den Plakaten der großen Protestkundgebungen nach der Präsidentschaftswahl 2016 war »American Psycho« das Synonym für Trump schlechthin.
Dass Ellis auf den Demonstrationen nicht mitlief und nicht explizit »anti-Trump« ist, nehmen ihm viele übel. Es ist die Zeit, in der er einen Bruch ausmacht. Er zeigt sich im Privaten – sein deutlich jüngerer Freund weigert sich nach der Wahl tagelang, das Bett zu verlassen – wie in der Öffentlichkeit. Bekenntnisse gegen Trump werden eingefordert. Ellis definiert sich als Künstler, nicht als Aktivist. Stil kommt vor Haltung, Oberfläche vor Struktur. Er ist der Snob, der sich nicht »trumpen« lassen will wie etwa Bruce Springsteen, dessen Protestsong »We Are Going to Make America Great Again« er zu den Tiefpunkten popkultureller Artikulation zählt. Ellis verteidigt die Freiheit, nicht zu wählen, bezeichnet die Reaktionen seines Umfelds als hysterisch.
»Sicher«, schreibt er, »gab es Menschen – die Dreamer, die Einwandererkinder mit Aufenthaltsrecht beispielsweise, oder diejenigen, die Ziel von Razzien der Einwanderungsbehörde wurden –, die das Recht hatten durchzudrehen. Aber die weiße, obere Mittelschicht an ihren Universitäten, in Hollywood, in den Medien, im Silicon Valley? Wenn man Trump hasste, warum sollte man ihn dann nicht bloß real, sondern auch noch metaphorisch gewinnen lassen?!«
Es sei nicht mehr möglich gewesen, darüber zu reden, warum Trump gewählt worden war, ohne Ausraster zu provozieren. Als er gegen Ende des Wahlkampfs, als die Medien einen sicheren Sieg Hillary Clintons prognostizierten, twitterte, dass er gerade mitten im »blau-demokratischen La La Land« mit ein paar Leuten zu Abend isst, die Trump wählen wollen, brach ein Shitstorm los. »Meine politischen Gespräche drehten sich immer weniger um Politik oder die Kandidaten, sondern um die Art der Berichterstattung, und einigen Leuten kam das so vor, als würde ich Trump verteidigen und nicht die Medien kritisieren.«
Ellis’ Ruhm rührt aus einer Zeit, in der man dagegen sein und trotzdem mitmachen konnte.
Ellis’ Ruhm rührt aus einer Zeit, in der man dagegen sein und trotzdem mitmachen konnte. Heute wird er bei passender Gelegenheit gesperrt, geblockt, entfreundet, ausgeladen. Das Buch ist nicht zuletzt der Versuch, einer »würdelosen Phantasieversion meiner selbst« entgegenzutreten, die in den Empörungszusammenhängen der sozialen Medien entstanden ist. Es herrschten Hysterie, Hypersensibilität und Regression, lautet seine Diagnose. Wer aber, fragt man sich bei der Lektüre manchmal, ist hier eigentlich kindisch?
Von einem Studenten wird Ellis nach seinen Lieblingsbands gefragt. Ihm fällt ein, dass er nichts außer Country mag, und nennt ein paar Namen von Musikern. Der Student reagiert entsetzt. Das Genre teile nicht »unsere Werte«. Country war zur Chiffre des weißen, abgehängten Milieus der Karohemden tragenden Trottel geworden, die einen Schurken aus ihrer Mitte gewählt hatten. Der Popkritiker Ellis weiß das natürlich. Im Gesellschaftsdramolett der Ära Trump nehmen Autor und Student pflichtgemäß die ihnen zugeschriebenen Rollen ein. Hier der kulturelle Diversität versprühende Millennial, dort der einfältige Babyboomer, der nur Volksmusik hört.
Aber das sind Ausreißer. Ernst zu nehmen ist seine Kritik am Zustand der Debatten in der von ihm so genannten Reputationsökonomie dennoch. Der Kult der Liebenswürdigkeit gegenüber allen, die irgendwie auf der richtigen Seite stehen, untergrabe jede Kritik, meint Ellis. Die Reputationsindustrie, angeführt von Facebook, dränge jeden, die fade Konformität der Konzernkultur zu übernehmen, und verwandele die User in Marktteilnehmer mit euphemistischen Profilen. »Alle posten ständig positive Beurteilungen in der Hoffnung, mit gleicher Münze zurückbezahlt zu werden.« Die Kehrseite digitaler Gefälligkeitskultur ist der virale Hass, der schon geringste Verstöße gegen die Konformität wie schwere Verbrechen ahndet.
»Weiß« ist eine energische, dabei ziemlich witzig geschriebene Verteidigung der Redefreiheit, inklusive des Rechts auf abwegige Meinungen, wie etwa die des neurechten Milo Yiannopoulos, den Ellis für einen verpeilten Exoten hält. Damit nimmt Ellis in seinem Umfeld fast schon eine Minderheitenposition ein. Man kann sich fragen, warum er das tut, und unterstellen, dass er ein heimlicher Rechter ist. Eher trifft zu, dass er noch immer der selbstbewusste Autor mit dem funkelnden Stil ist und sich deshalb nicht scheut, um das bessere Argument zu streiten.
»Weiß« ist nicht wirklich die Provokation, die man dem Titel nach erwarten musste. So ganz erschließt dieser sich ohnehin nicht. Eine Selbstbezichtigung, klar, vielleicht eine Wortspielerei, »White/Write«, eine Referenz an ein berühmtes Beatles-Album und eine Verbeugung vor der von ihm verehrten Joan Didion und ihrem Essay »Das weiße Album«. Auf die negative Zuschreibung »alter weißer (schwuler) Mann« fällt der 55jährige eben nicht herein. Zurückgelehnt, manchmal polemisch, aber deutlich um Argumente und Anschlussfähigkeit bemüht, reicht Ellis in diesem Buch Erklärungen nach, die er auf Twitter schuldig bleiben musste. Etwa, warum er das schwarze schwule Coming-of-Age-Drama »Moonlight« für überbewertet, »La La Land« hingegen für unterbewertet hält.
Das Buch ist auch das Tagebuch eines Selbstversuchs, wie das »perfomative Medium« Twitter das Schreiben verändert, an dessen Ende die selbstkritische Einsicht steht, dass der Tweet nicht die beste aller Formen ist: »Twitter spornte den bösen Buben in mir an.«
Das klingt wie ein Versprechen.
Bret Easton Ellis: Weiß. Aus dem amerikanischen Englisch von Ingo Herzke. Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2019, 315 Seiten, 20 Euro.
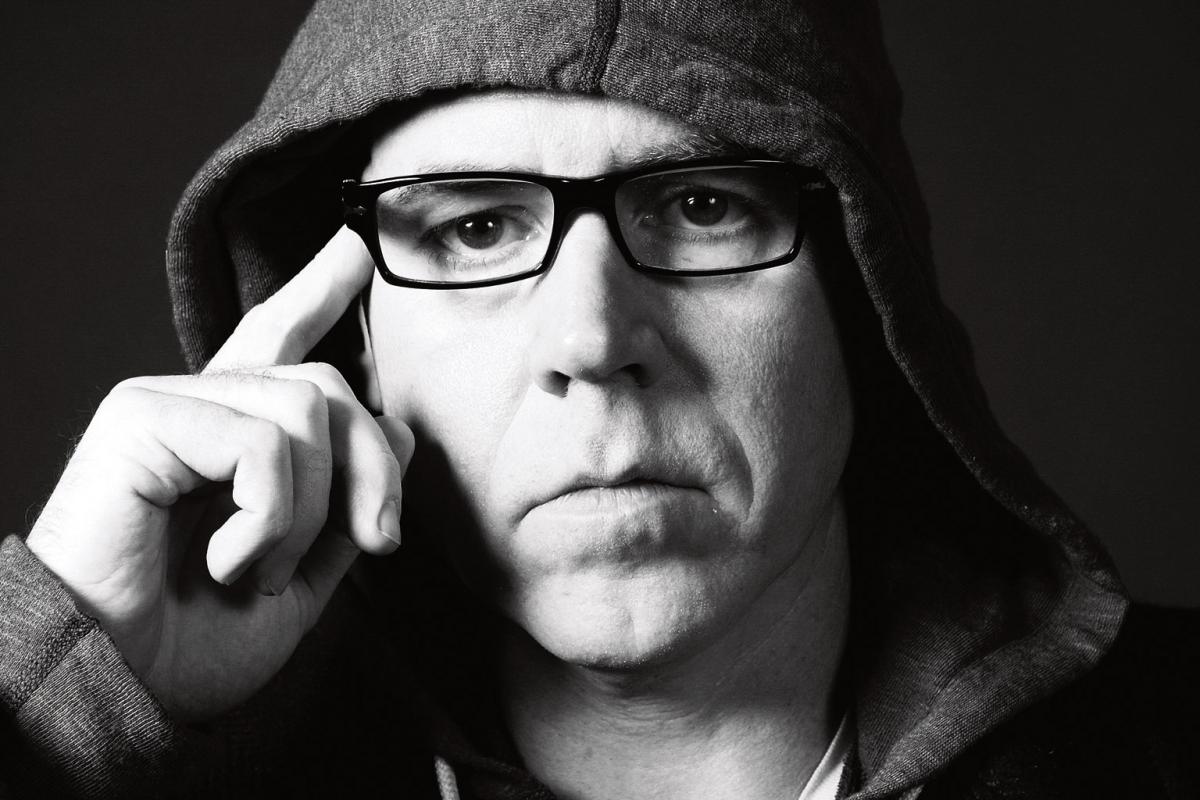

 »Birkenschwester«: Rückwärts zurück
»Birkenschwester«: Rückwärts zurück

