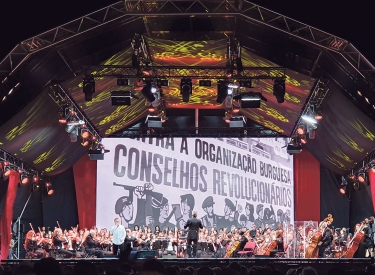Verhängnisvolle Minen
Bei westeuropäischen Touristinnen und Touristen ist Georgien vor allem für seinen halbsüßen Wein, seine käsereiche Küche und seine malerischen Gebirgslandschaften bekannt. Der Tourismussektor boomte in den vergangenen Jahren. Ein Industriezweig, der seine Blütezeit zwar hinter sich hat, aber in Georgien dennoch weiterhin eine Rolle spielt, ist der Bergbau. Besonders in der Region Imeretien, die sich vom zentralgeorgischen Flachland bis in die bewaldeten südlichen Ausläufer des Kaukasus erstreckt, gibt es mehrere Städte, die von ihren Bergwerken leben – und mit ihnen sterben.
»Letzte Woche erst kam ein 26jähriger Kollege in einer der lokalen Minen ums Leben.« Paata Samcharadse, Gewerkschaftsführer
»Letzte Woche erst kam ein 26jähriger Kollege in einer der lokalen Minen ums Leben. Er wird in diesem Moment begraben«, erzählt Paata Samcharadse in seinem kleinen Gewerkschaftsbüro in Tschiatura. »Ich habe eben mit ein paar Kollegen telefoniert, die auf dem Weg zur Beerdigung waren.« Samcharadse hat kurzes, grauweißes Haar und verblasste Tätowierungen auf den Unterarmen. Als junger Mann wollte er eigentlich nicht dem Weg seiner Eltern folgen und wie alle hier im Bergbau schuften. Er lebte von verschiedenen Tätigkeiten, zeitweise arbeitete er auf russischen Baustellen. Als er heiratete und Vater wurde, brauchte er aber eine feste Arbeitsstelle in der Nähe der Familie – so landete er doch im Bergbau. Seit 2005 arbeitet er als Elektromechaniker in einem der Erzreinigungswerke am Rande der Stadt. Nebenbei ist er Vorsitzender der lokalen Sektion der georgischen Bergbau-, Metall- und Chemiegewerkschaft (TUMMCIWG).
Der Bergbau in Tschiatura kam Ende des 19. Jahrhunderts auf. In den steilen Felswänden entlang des Flusses Qwirila wurde das in der Stahlproduktion wichtige Übergangsmetall Mangan entdeckt. 1905 kam die Hälfte des weltweit geförderten Mangans aus Tschiatura. 18-Stunden-Schichten waren zur Zarenzeit in den Bergwerken die Regel. Ein junger Revolutionär namens Koba mischte sich damals unter die lokalen Kumpel. Mit Hilfe seiner Agitation wurde Tschiatura bald zur wichtigsten Stadt der Bolschewisten in Georgien. Viele Jahre später, nachdem sich das Zarenreich in die Sowjetunion und Koba in Josef Stalin verwandelt hatte, blühte Tschiatura auf. Um den Transport von Mensch und Material zwischen Minen, Verarbeitungswerken und Wohnbezirken zu verbessern, wurden Dutzende Seilbahnen gebaut. Wie riesige rostbraune Girlanden strecken diese sich heutzutage kreuz und quer durch die Schlucht.
Im Niedergang
Seit der Glanzzeit Tschiaturas hat sich viel verändert. Die Einwohnerzahl ist auf etwa 15 000 gesunken. Die Minen gehören mittlerweile Georgian American Alloys (GAA), einer Firma mit Hauptsitz in Miami. Der Kommission für internationalen Handel der Vereinigten Staaten zufolge wird GAA von der ukrainischen »Privat-Gruppe« kontrolliert, der unter anderem der ukrainische Oligarch Ihor Kolomojskyj angehört. Die meisten der Seilbahnen stehen seit einigen Monaten still und warten darauf, vielleicht doch noch einmal renoviert zu werden. Auch die Arbeitsbedingungen der Bergleute haben sich erheblich verschlechtert. 2016 wurde in mehreren der örtlichen Bergwerke ein neues System eingeführt, wonach zwei Mannschaften abwechselnd 15 Tage am Stück zwölf Stunden lange Schichten am Tag arbeiten. Für Samcharadse ist das unbegreiflich. »Man kann keine zwölf Stunden unter Tage arbeiten, das geht einfach nicht. Der Achtstundentag sollte eine Selbstverständlichkeit sein, den hat man sich ja vor 100 Jahren erkämpft«, sagt er mit einem bitteren Lachen.
Das Wohl der Belegschaft hat für GAA jedoch anscheinend keine Priorität. Die Firmenleitung rechtfertigte den neuen Arbeitsplan als eine durch die schwierigen Verhältnisse auf dem internationalen Markt erzwungene Sparmaßnahme. Obwohl Tschiaturas Bevölkerung wegen der zentralen Bedeutung der Minen im Leben aller über einen besonderen Zusammenhalt verfügt, gelang es den Gewerkschaften nicht, ausreichend Widerstand zu leisten. Diese Unfähigkeit, sich vorhandenes Mobilisierungspotential zunutze zu machen, ist typisch für die institutionell schwachen Gewerkschaften Georgiens. Bis zu 90 Prozent der gut 3 000 GAA-Angestellten in Tschiatura sind Gewerkschaftsmitglieder, doch gehören nur etwa zehn Prozent zu jener Gewerkschaft, der Samcharadse vorsteht. Etwa ebenso viele sind Mitglieder einer »gelben Gewerkschaft«, deren Führung von der Unternehmensleitung benannt wird. Die allermeisten Kumpel gehören jedoch nach wie vor der aus Sowjetzeiten stammenden Altgewerkschaft an, die noch immer, wie damals, vor allem Freizeitangebote bereithält, statt den Arbeitskampf zu organisieren.
Die TUMMCIWG nimmt noch am ehesten die Rolle einer seriösen Gewerkschaft wahr, doch auch sie tut sich schwer damit, den lokal durchaus existierenden Kampfgeist praktisch werden zu lassen. Besonders deutlich wurde dies zuletzt im Frühling 2019, als fast die gesamte GAA-Belegschaft wild streikte – ohne Unterstützung irgendeiner der drei örtlichen Gewerkschaften.
Streik ohne Gewerkschaft
»Das war alles spontan, völlig unorganisiert und überhaupt nicht nach dem Gesetz«, erinnert sich Samcharadse. Die Wut der Beschäftigten richtete sich vor allem gegen das 2016 eingeführte Schichtsystem. Neben den zwölfstündigen Schichten sieht dieses nämlich unter anderem vor, dass die Angestellten für die Dauer ihrer 15 aufeinanderfolgenden Arbeitstage in unternehmenseigenen Unterkünften bei den Minen leben müssen. Die Eingänge der Unterkünfte werden von Polizisten bewacht, und nicht einmal Beschäftigte, deren Wohnungen in der Nähe der Minen liegen, dürfen nach Hause zu ihren Familien. Außerdem waren die in den Unterkünften servierten Mahlzeiten den Beschäftigten zufolge regelmäßig unzureichend, verspätet oder ungenießbar.
»Wenn die Minen schließen, gibt es hier keine Arbeit mehr.« Vitali Turdsiladse, ehemaliger Minenarbeiter
Am 15. Mai 2019 platzte einem Trupp der Bergleute schließlich der Kragen. Sie besetzten den Platz im Stadtzentrum Tschiaturas, wo sowohl die Stadtverwaltung als auch die GAA-Unternehmensführung ihren Sitz hat, und begannen einen Hungerstreik. Mehrere nähten sich aus Protest die Lippen zu. Als die Unternehmensleitung mit Drohungen statt Kompromissbereitschaft antwortete, eskalierte die Lage weiter. Am 27. Mai ging dann die gesamte Stadt auf die Barrikaden und hielt eine Art lokalen Generalstreik ab. Geschäfte blieben geschlossen und Tausende Einwohnerinnen und Einwohner protestierten auf den Straßen. Die Liste der Forderungen war mittlerweile länger geworden, es ging nicht nur um die Arbeitsbedingungen, sondern auch um die durch den Bergbau verursachte Umweltverschmutzung. Ein Teil des gewonnenen Erzes wird mit Lastwagen von den Minen zu den Reinigungswerken transportiert. Dies hat zur Folge, dass die gesamte Stadt mit einer Schicht aus schwarzem, gesundheitsschädlichem Staub bedeckt ist. Der Fluss, der durch die Stadt fließt, ist wegen des von den Reinigungswerken abgelassenen Schlamms schwarz wie Kaffee.
Nachdem die georgische Regierung sich schließlich gezwungen gesehen hatte, sich in den Konflikt einzuschalten, kam die Unternehmensleitung den Streikenden doch noch entgegen. Sie versprach Lohnerhöhungen, bessere Arbeitsbedingungen und neue Produktionsroutinen, die der Luft- und Wasserverschmutzung ein Ende machen sollten. Auch wenn sich die Arbeitsbedingungen in den Minen Tschiaturas noch immer nicht nennenswert verbessert haben, ist diese Episode doch ein Hoffnungsschimmer.
Tödliche Kohle
Ein paar Autostunden westlich, in der Bergbaustadt Tqibuli, ist die Lage noch finsterer. Statt Mangan wird hier Kohle gefördert. Auch hier gibt es kaum einen Haushalt, in dem nicht mindestens ein Familienmitglied im Bergbau arbeitet. Längst ist die Blütezeit vorbei, die Tqibuli nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte. Damals brachte der Bergbau Menschen aus der ganzen Sowjetunion in die Kleinstadt: Russen, Ukrainer, Armenier. Zeitweise hatte die Stadt 40 000 Einwohner. Heutzutage hört man in Tqibulis Straßen nur noch Georgisch, und in der damals gebauten Fußballarena mit Platz für 18 000 Zuschauer könnte man mittlerweile den gesamten Ort versammeln. Nach der Dämmerung lassen die wenigen erleuchteten Fenster in den ansonsten dunklen Plattenbauten erkennen, dass Tqibuli ein sterbender Ort ist.
Ein Spaziergang auf den Friedhöfen der Stadt zeigt, dass dies nicht nur im übertragenen Sinne der Fall ist. Angesichts der Todesrate in Tqibulis Kohlestollen erscheinen selbst die Verhältnisse in Tschiaturas Manganminen noch erträglich. Auf den örtlichen Friedhöfen muss man nicht lange suchen, um Gräber der Opfer der Bergwerke zu finden. In Georgien ist es üblich, die Verstorbenen auf ihren Grabsteinen mit einem Porträt zu verewigen. Die vielen Gesichter relativ junger Männer, die die Grabsteine Tqibulis zieren, machen deutlich, wie viele Söhne der Stadt vorzeitig gestorben sind.
Einer von ihnen war der 37jährige Mirab Kolondadse, der in einer Januarnacht 2011 bei einer Explosion unter Tage umkam. »Wir arbeiteten seit etwa einem Jahr zusammen, wir kannten einander«, erzählt sein damaliger Kollege Witali Turdsiladse im Wohnzimmer seiner Plattenbauwohnung. Er schenkt den süßen, klebrigen Pflaumenwodka ein, den seine Frau Marina zu Hause herstellt, und fährt fort: »Wir hatten fast Feierabend und sollten noch eine letzte Sprengung vornehmen. Aber dann ging alles zu früh in die Luft.« Im Gegensatz zu seinem jüngeren Kollegen überlebte Turdsiladse knapp. »Ich hatte an 60 Prozent meines Körpers Verbrennungen, niemand glaubte, dass ich es schaffen würde.« Kollegen erinnern sich, wie Turdsiladse geschrien habe, dass er es nicht aushalte und lieber sterben würde. Anderthalb Jahre und zahlreiche Operationen später konnte er schließlich das Krankenhaus verlassen. Seit dem Unfall ist Turdsiladse arbeitsunfähig und lebt von einer Invaliditätsrente von umgerechnet etwa 65 Euro monatlich.
In Tqibuli gehören Geschichten wie diese zum Alltag. Allein 2018 starben zehn Kumpel in den Kohlestollen. Über die Jahre haben die etwa 1 500 Bergleute der Stadt immer wieder Streiks und Proteste organisiert, um den Minenbetreiber, LTD Savachro Sakhli Saknakhshiri, dazu zu bewegen, die katastrophale Sicherheitslage zu verbessern. 2016 stürmten sie sogar die Büroräume der Unternehmensleitung. Aber abgesehen von Veränderungen, die Gewerkschaftsvertreter als reine Kosmetik kritisieren, wurde nichts unternommen.
Falsche Reformen
Die hohe Sterblichkeit sei eine Folge mehrerer Probleme, sagt Gaga Isakadse, der örtliche Vorsitzende der TUMMCIWG, der in Tqibuli ungefähr 90 Prozent der Bergleute angehören: »Zum einen ist die Technik größtenteils veraltet. Außerdem bezahlt das Unternehmen Akkordlohn, weshalb man gezwungen ist, so hastig wie möglich zu arbeiten und Sicherheitsvorschriften zu ignorieren, um einen halbwegs anständigen Monatslohn zusammenzubekommen.«
Dass Bergbaukonzerne wie GAA in Tschiatura und Saknakhshiri in Tqibuli überhaupt so fahrlässig mit ihren Beschäftigten verfahren können, haben sie nicht zuletzt dem ehemaligen Präsidenten Micheil Saakaschwili (2004 bis 2013) zu verdanken. Dessen Regierung schaffte im Rahmen ihrer wirtschaftsliberalen Reformen 2006 die Aufsichtsbehörde für Arbeitsplatzsicherheit ab und beschnitt Arbeitnehmerrechte. In internationalen Wirtschaftszeitungen warb die damalige Regierung stolz damit, dass die georgische Wirtschaft eine der am stärksten deregulierten weltweit sei. Studien zeigen, dass sich die Anzahl tödlicher Arbeitsunfälle seither verdoppelt hat. Ein im August 2019 veröffentlichter Bericht von Human Rights Watch, der sich mit der Situation in Tschiatura und Tqibuli beschäftigt, kommt zu dem Schluss, dass mangelnde Arbeitnehmerrechte einer der Hauptgründe für die hohe Todesrate unter den Bergleuten sind.
Die Unternehmen haben mit Verweis auf die Konkurrenz auf den internationalen Märkten immer wieder damit gedroht, Betriebe zu schließen, falls die Belegschaft zu hohe Forderungen stellen sollte. Die Lage in den vom Bergbau abhängigen Gemeinden Tschiatura und Tqibuli zeigt: Solange es die Minen gibt, gehen die Bergleute in ihnen zugrunde, doch ohne die Minen wäre der ganze Ort am Ende.
In den vergangenen Jahren scheint immerhin die Politik aufgewacht zu sein. 2015 wurde die Aufsichtsbehörde für Arbeitsplatzsicherheit wiedereingeführt. Auch wenn Gewerkschaften sie als zahnlos kritisieren, ist das zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Nach dem jüngsten tödlichen Unglück in der Mindeli-Mine in Tqibuli im Juli 2018, bei dem vier Kumpel in einer Explosion ums Leben kamen, zwang ein Gericht den Minenbetreiber Saknakhshiri, die Kohleförderung auszusetzen, bis alle Sicherheitsmängel beseitigt sind. Nur einige Monate zuvor, Anfang April 2018, waren bereits sechs Bergleute gestorben, als eine Decke in der Mindeli-Mine einbrach. Nach dem Unglück vom Juli mussten die Beschäftigten ein gutes Jahr lang verschiedene Renovierungsarbeiten vornehmen. Im Herbst 2019 wurden die Bergwerke schließlich unter neuer Führung, die beteuert, der Sicherheit den höchsten Stellenwert einzuräumen, wieder in Betrieb genommen – bisher ohne weitere Todesopfer.
Viele Einwohnerinnen und Einwohner Tqibulis befürchten aber, dass es sich hierbei nur um ein politisches Manöver handelt. Es wird gemunkelt, die Bergwerke würden nur noch bis zu der im kommenden Herbst anstehenden Parlamentswahl betrieben, um sie danach endgültig dichtzumachen. Für Familien wie die Turdsiladses wäre das verheerend. »Wenn die Minen schließen, gibt es hier keine Arbeit mehr. Die Jüngeren fahren jetzt schon oft nach Polen oder in die Tschechoslowakei«, gemeint ist Tschechien, »um in den dortigen Minen zu arbeiten«, sagt der Familienvater. Auch sein 27jähriger Sohn Malchas ist Bergarbeiter. »Wenn die Minen schließen, werde ich denselben Weg gehen müssen – was denn sonst«, fügt dieser schweren Herzens hinzu.


 Weil es kein Wasser gab
Weil es kein Wasser gab