Sharia, Einheit, Autarkie
Die Taliban haben den nächsten Schritt zur Verstetigung ihrer Macht in Afghanistan vollzogen. Dazu beriefen sie vom 30. Juni bis zum 2. Juli eine »Große Versammlung der Ulema Afghanistans« – die Ulema sind höhere islamische Geistliche, im Gegensatz zu den nur elementar gebildeten Mullahs – nach Kabul ein, deren 5 000 Teilnehmer aus dem ganzen Land das Regime religiös legitimierten. Auch einige Stammesälteste und Geschäftsleute seien geladen gewesen – ausschließlich Männer. Alle waren von den Taliban-Verwaltungen in den Provinzen und Distrikten ausgewählt worden. Diese hatten in einem Brief der Vorbereitungskommission die Anweisung erhalten, nur Personen zu entsenden, die den »Jihad« der Taliban unterstützt hatten. Die Vorbereitungskommission hatte der Erste stellvertretende Ministerpräsident Abdul Ghani geleitet, besser bekannt als Mullah Baradar, der auch einer der drei Stellvertreter des Obersten Führers der Taliban, Hibatullah Akhundzada, ist. Dissens war damit von vornherein ausgeschlossen.
Das Treffen fand in der Polytechnischen Universität von Kabul statt. Deren Studenten wurden kurzfristig aus ihren Wohnheimen auf dem Gelände geworfen, um die Teilnehmer unterzubringen. Die Taliban trafen scharfe Sicherheitsmaßnahmen, durchsuchten Häuser in benachbarten Wohnvierteln und richteten nahe des Tagungsorts zusätzliche Kontrollposten ein.
Afghanistan wird zu einem islamischen Gottesstaat, der – im Gegensatz zum benachbarten Iran – nicht einmal symbolische parlamentarische Elemente aufweist. Letztlich handelt es sich um ein Ein-Mann-Regime.
Trotzdem kam es zu Anschlagsversuchen. Am Eröffnungstag schlugen zwei Geschosse in der Nähe der Versammlung ein, richteten aber keinen Schaden an. Immerhin wurde die Tagung sicherheitshalber unterbrochen. Afghanischen Medien zufolge übernahm eine »Nationale Befreiungsfront« (eigentlich: Nationale Befreier-Front; Jabha-je Melli-je Azadegan) die Verantwortung für den Anschlag. Am Freitag vorvergangener Woche durchsuchten die Taliban ein Gebäude in Kabul und erschossen drei Menschen, die geplant haben sollen, von dort aus erneut die Versammlung zu beschießen.
Aus der Versammlung berichten durften nur das Staatsfernsehen und -radio sowie die ebenfalls von den Taliban kontrollierte offizielle Nachrichtenagentur Bakhtar. Kritik am Ausschluss von Frauen von der Versammlung entgegnete – offensichtlich ohne jede Ironie – der Zweite stellvertretende Ministerpräsident der Taliban, Abdul Salam Hanafi, im afghanischen Fernsehen: »Die Frauen sind unsere Mütter, unsere Schwestern, und wir respektieren sie. Wenn ihre Söhne in der Versammlung sind, bedeutet das, dass sie (die Frauen, Anm. d. Red.) auch beteiligt sind.«
Schon Tage vor dem Treffen hieß es gerüchteweise, der Anführer der Taliban, Mawlawi Hibatullah Akhundzada, auch er ein Geistlicher, werde kommen und eine Rede halten. Seit dem Sieg der Taliban im vorigen August war er nur einmal öffentlich aufgetreten, bei einem Freitagsgebet in Kandahar. Dann schwebte Hibatullah tatsächlich per Hubschrauber am Versammlungsort ein, einer Art Traglufthalle, wie sie in Deutschland als Riesenbierzelt verwendet wird. Die bundeseigene Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit hatte sie 2002 dort für die Vorgängerregierung errichtet.
Bei der Ankunft des wohl etwa 70jährigen erneuerten die Anwesenden durch Handheben ihre Bai’a, den Gefolgschaftseid, für ihn als Amir al-Mu’minin (Oberhaupt der Gläubigen) und Anführer des Islamischen Emirats – also als geistlicher und weltlicher Führer Afghanistans.
Die Legitimation, die die Ulema Hibatullah und dem von ihm geführten Emirat verliehen, beruht auf der Formel Sharia (islamisches Recht) plus Geschlossenheit der Reihen und Autarkie. Afghanistan wird so zu einem islamischen Gottesstaat, der – im Gegensatz zum benachbarten Iran – nicht einmal symbolische parlamentarische Elemente aufweist. Letztlich handelt es sich um ein Ein-Mann-Regime, denn Hibatullah steht als Emir sogar über den Ulema, deren Rat er ignorieren kann.
In seiner Rede legitimierte Hibatullah diesen Zustand. Er sagte, Allah habe den Heiligen Krieg gegen die »Ungläubigen« zum Sieg geführt. Davor habe »20 Jahre lang niemand vom Islam, niemand von der Sharia sprechen können. Dafür ging man ins Gefängnis, wurde gefoltert.« Deshalb müsse man nun nicht länger warten, die göttliche Ordnung auf Erden sei errichtet. Das sei der Wunsch des Volkes.
Die Schlussresolution der Versammlung war offenbar vorgefertigt und umfasst elf Punkte. Sie wurde nur verlesen und pauschal durch Handheben bestätigt. In ihr heißt es, die Legitimität des Islamischen Emirats gründe darin, dass es »die unangefochtene Kontrolle über das ganze Land« ausübe, »Sicherheit und Gerechtigkeit im Land« schaffe und ein islamisches System »der ewige Wunsch unserer gläubigen Nation« sei. Scheich Mohammed Sayed Hashemi aus der Provinz Balkh sagte: »Die Mujahedin (die Kämpfer der Taliban, Anm. d. Red.) haben ihre Pflicht mit dem Jihad sehr gut erfüllt. Nun ist es die Verantwortung der Nation, das islamische System zu unterstützen und den Herrschern zu folgen.«
Den Krieg der vergangenen 20 Jahre beschrieb Hibatullah in Worten, die an Samuel Huntingtons These vom clash of civilizations erinnern: »Die Ungläubigen der Welt« hätten Afghanistan bekämpft, aber nicht »des Bodens oder des Geldes wegen – es ging nur um eines: Ideen und Glauben. Unsere Ideen und unser Glaube sollten zum Schweigen gebracht werden.«
Dieser Krieg »dauert an« und werde »bis zum Tag des Jüngsten Gerichts« weitergehen. »Wir werden ihn nicht lassen, und sie werden ihn nicht lassen.« Der Westen habe zwar »keinen einzigen Soldaten mehr auf afghanischem Boden«, sei also »weggelaufen«, führe den Krieg aber weiter, indem er versuche, Fitna, also Zwietracht, zu säen und »Propaganda« gegen die Taliban zu betreiben. Es werde »keinen Kompromiss zwischen dem Islam und dem Unglauben« geben.
»Die Welt« wolle nicht, »dass Afghanistan, die afghanische Regierung, nach ihren eigenen, unabhängigen Vorstellungen agiert, sondern ihren Anweisungen folgt. Aber unsere Arbeit, unser System, unsere Menschen, unsere Prinzipien sind nicht eure Sache. Mischt euch nicht ein«, sagte Hibatullah an die westlichen Staaten gerichtet. Afghanistan sei nun »unabhängig«, werde sich nicht den Forderungen des Auslands beugen und seinen eigenen Weg gehen, den die Sharia vorgibt. Der sei »in den alten Büchern« vorgezeichnet, deshalb brauche man »nicht so viele Diskussionen«. »Wir akzeptieren bei der Sharia keine Kompromisse«, sagte er. »Unser Herr ist Allah, nicht ihr.«
Aufforderungen, die Einheit der Taliban-Bewegung nicht durch öffentliche Diskussionen zu gefährden, zogen sich als roter Faden durch Hibatullahs Rede. Er sagte, das »Überleben des Emirats hängt davon ab, dass wir alle vereint bleiben«.
Ökonomisch propagiert Hibatullah Autarkie. Er sagte, Afghanistan solle sich »nicht auf die Hilfe der Welt« verlassen. Die Wirtschaft des Landes werde davon »nicht wieder in Ordnung gebracht. Das müssen wir selbst machen.« Stattdessen sollten die afghanischen Geschäftsleute investieren. Ähnlich simpel hörte sich sein Vorschlag an, wie den Opfern des Erdbebens von Ende Juni zu helfen sei: »Wenn ihr zwei Fladen Brot habt, lasst ihnen eines und esst selbst nur das andere.«
Den Afghanen außerhalb des Landes sagte er: »Organisiert keine Verschwörungen, zerstört nicht den Frieden. Wenn ihr das tut, werdet ihr bestraft.« In diesem Punkt wurde die Schlussresolution noch deutlicher. Sie bezeichnet jegliche »bewaffnete Opposition«, sogar »jegliche Art von Opposition gegen das herrschende islamische System, die im Gegensatz zur islamischen Sharia und nationalen Interessen steht« (also wohl auch Proteste von Frauen gegen ihre Entrechtung), als »Rebellion und Korruption auf Erden«. Deren »Zurückweisung« sei »obligatorisch für das Emirat und die ganze Nation«. Mit »Korruption auf Erden« werden im Iran Todes- und andere Urteile gegen Oppositionelle begründet.
Eine Absage erteilte Hibatullah auch den Politikern der alten, von den westlichen Staaten gestützten Regierung und Forderungen nach ihrer Einbeziehung in ein wenigstens annähernd inklusives Regime. Man habe ihnen trotz ihrer »in der Geschichte einmaligen Verbrechen« Amnestie gewährt, aber das bedeute nicht, dass man sich mit ihnen an einen Tisch setzen müsse. »Lasst euch beraten«, sagte er, »aber nicht von schlechten Menschen.« Im Land gebliebene Politiker wie der ehemalige Präsident Hamid Karzai und sein Rivale Abdullah Abdullah waren nicht zu der Versammlung eingeladen, die Taliban beanspruchen ein Machtmonopol. Hibatullah sagte: »Ihr habt die Bai’a geleistet. Wenn ihr mich euren der Sharia gemäßen Emir nennt, werdet ihr mir folgen.«
Hibatullah hielt nicht die erwartete politische Grundsatzrede, sondern eher eine Predigt, wie sie freitags in Afghanistans Moscheen zu hören ist, mit viel Rhetorik und Koranzitaten, die eine strikte Abgrenzung zur Außenwelt zum Inhalt hatte. Das Thema Frauenrechte und Mädchenbildung berührte Hibatullah nicht einmal. Im Plenum wagte nur ein einziger Teilnehmer, die Wiedereröffnung der Mädchenschulen vorzuschlagen. Die Schlussresolution blieb diesbezüglich vage und stellte die »Notwendigkeit moderner Bildung« fest. Schon vorher hatte der Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid bei einer Pressekonferenz klargemacht, dass Hibatullah dabei ohnehin das letzte Wort haben wird. Nach seiner harschen Zurückweisung ausländischer Einmischung ist kaum zu erwarten, dass er seine Position zu höheren Mädchenschulen noch revidieren wird.
Nur einige prominente Taliban-Führer deuteten im Plenum latente interne Meinungsunterschiede an. »Ratet uns, wie man eine Außenpolitik formulieren kann, die zur Anerkennung unserer Regierung führen kann«, sagte der Verteidigungsminister Muhammad Jakub, ein Sohn des Taliban-Gründers Mullah Omar. Innenminister Sirajuddin Haqqani plädierte dafür, die Expertise von Mitarbeitern der alten Regierung zu nutzen. Aber niemand wagte es, generellen Dissens zu Hibatullahs Kurs zu äußern. Unklar bleibt freilich, welche Debatten bei den Taliban in welcher Schärfe hinter den Kulissen stattfinden.
Zum Abschluss kündigte der Taliban-Führer an, man werde jetzt ähnliche Versammlungen in den Provinzen einberufen, »damit sie ihre Unterstützung für das Emirat erklären«.
Widerstand an mehreren Fronten
Völlig unangefochten ist die Herrschaft der Taliban aber nicht. Sie sehen sich gleich an mehreren Fronten mit bewaffnetem Widerstand konfrontiert. Dahinter stehen vor allem Fraktionen, die bis zu ihrem Machtverlust im vorigen August als Verbündete der westlichen Staaten gegen die Taliban kämpften.
Seit vorigem August haben sich etwa ein Dutzend solcher Gruppen gebildet. Am bekanntesten ist die Nationale Widerstandsfront (NWF, Jabha-je Muqawamat-e Melli). Sie ist vor allem im Panjshir-Tal aktiv, einer alten Hochburg des Kampfs schon gegen die sowjetische Besatzung (1979–1989) und gegen das erste Taliban-Regime (1996–2001). Fast täglich meldet ihre sehr aktive Medienabteilung Angriffe auf die Taliban. Am 17. Juni hat die NWF nach eigenen Angaben einen Hubschrauber der Taliban abgeschossen und dessen Besatzung gefangengenommen.
Gruppen der bewaffneten Opposition können den Taliban vor allem deshalb gefährlich werden, weil sie sich auf ethnische Gruppen stützen, die in Nord- und Zentralafghanistan die Bevölkerungsmehrheit stellen.
Anführer der Front ist der 33jährige Ahmad Massoud, ein Sohn des bekanntesten antisowjetischen Mujahedin-Kommandanten, Ahmad Shah Massoud, den 2001 al-Qaida-Agenten ermordeten. Massoud junior wurde auch von westlichen Unterstützern als Führungsfigur im Kampf gegen die Taliban langfristig aufgebaut. Unter anderen studierte er an der britischen Militärakademie von Sandhurst. Aber auch er war nicht in der Lage, im September 2021 die Taliban bei ihrer Eroberung des Panjshir zu stoppen, das als letzte der 34 Provinzen des Landes an sie fiel (Jungle World 34/2021).
Massoud behauptet, über 4 000 Kämpfer zu verfügen, darunter lokale Milizen und ins Panjshir geflohene Spezialkräfte der alten, US-gestützten Regierungsarmee. International ist er gut vernetzt, unter anderem mit einem offiziellen Verbindungsbüro in Washington. An Mitteln für Lobbyarbeit fehlt es offenbar nicht. Im Mai sagte Donald Trumps ehemaliger Sicherheitsberater, der weit rechts stehende Republikaner John Bolton, Massouds Front verfüge über »starke Unterstützung« im US-Kongress. Afghanische Medien schreiben der NWF Aktivitäten auch in den Provinzen Takhar und Baghlan zu. Auch in der Provinz Balkh und Parwan sollen sich Kämpfer der NWF angeschlossen haben.
Aber selbst viele ehemalige Kampfgefährten seines Vaters haben eigene Ambitionen und erkennen Massouds Führungsrolle nicht an. Dazu gehört Amrullah Saleh, der früher Direktor des Geheimdiensts und Erster Vizepräsident unter Präsident Ashraf Ghani war und sich unmittelbar nach dessen Flucht zum amtierenden Staatsoberhaupt erklärt hatte. Er soll von der NWF getrennte bewaffnete Gruppen im Panjshir-Distrikt Bazarak unterhalten und – wie Massoud – möglicherweise ins benachbarten Tadschikistan pendeln, wo auch die NWF ein Büro unterhält. Die tadschikische Regierung bestreitet das.
Ein von mehreren ehemaligen Warlords im Mai in Ankara gegründeter Oberster Rat zur Nationalen Rettung schließt weder Massoud noch Saleh ein. Man traf sich in der Luxusvilla von Abdul Rashid Dostum, einem berüchtigten Milizenführer und ehemaligen Verteidigungsminister Afghanistans.
Dazu kommen weitere selbsterklärte Widerstandsgruppen, von denen viele nur im Internet existieren dürften. Von den wirklich aktiven sind neben der NWF die Freiheitsfront Afghanistans (Jabha-je Azadi) und die Azadegan-Front, die den Anschlag auf die Taliban-Tagung in Kabul verübt haben will, am bedeutendsten. Die Freiheitsfront meldete sich im März erstmals öffentlich und soll vom früheren Armeestabschef und Verteidigungsminister, General Yasin Zia, angeführt werden. Über die Azadegan ist noch weniger bekannt.
Zu mehr als zu kleineren Scharmützeln und Anschlägen auf Taliban-Patrouillen war auch die NWF bisher nicht in der Lage. Diese Gruppen kontrollieren kein Territorium und haben keinen Zugang zu Rückzugsgebieten in Nachbarländern. Die Regierungen der USA und Großbritanniens erklärten, dass sie keine Versuche unterstützten, das Taliban-Regime militärisch zu stürzen.
Mehdis Meuterei
Ende Juni gab es sogar eine Meuterei in den Reihen der Taliban. Angeführt wurde sie von Mawlawi Mehdi Mujahid, dem einzigen Angehörigen der überwiegend schiitischen Minderheit der Hazara, der jemals eine höhere formale Position bei den Taliban innehatte. Auch Mehdi selbst ist Schiit. Nach ihrer Machtübernahme hatten die Taliban ihn zum Geheimdienstchef in der Hazara-Provinz Bamyan ernannt, setzten ihn im März aber wieder ab. Offenbar befürchteten sie, er könne sich dort eine Hausmacht aufbauen.
Mehdi soll auch kritisiert haben, dass die Taliban die höheren Mädchenschulen nicht wiedereröffneten und dass sie Hazara benachteiligten. Daraufhin zog er sich mit 150 Bewaffneten in seinen Herkunftsdistrikt Balkhab in der Provinz Sar-e Pol zurück und vertrieb den dortigen Taliban-Gouverneur. Seine Meuterei finanzierte er durch die Besteuerung der Kohletransporte aus den örtlichen Gruben.
Zunächst versuchten die Taliban, Mehdi per Verhandlung wieder auf Linie zu bringen. Als das scheiterte, griffen sie an und vertrieben Mehdis Kämpfer nach viertägigen Kämpfen aus seinem Hauptquartier in Tarkhoj, dem Distriktzentrum von Balkhab. Mehdi und seine Truppe begaben sich in die umliegenden Berge, sprachen aber von einem »taktischen Rückzug« und behaupteten, die Taliban in Tarkhoj umzingelt zu haben. Tatsächlich meldeten Sicherheitsanalysten in Kabul danach weitere Angriffe auf die Taliban in Tarkhoj. Bei einer Attacke am 28. Juni sollen 23 Kämpfer getötet worden sein, die meisten von ihnen Taliban.
Afghanischen Oppositionsmedien zufolge exekutierten die Taliban danach unbeteiligte Zivilisten sowie gefangene Mehdi-Kämpfer. Nach UN-Angaben wurden mindestens 27 000 Menschen durch die Kämpfe vertrieben. Selbst wenn Mehdi sich in den Bergen halten kann, dürfte eine Zusammenarbeit mit anderen aufständischen Gruppen schwierig sein. Sie misstrauen ihm wegen seines zeitweiligen Bundes mit den Taliban.
Den Taliban können diese Gruppen vor allem deshalb gefährlich werden, weil sie sich auf ethnische Gruppen stützen, die in Nord- und Zentralafghanistan die Bevölkerungsmehrheit stellen. Bei den Taliban hingegen dominieren die Paschtunen, die größte ethnische Gruppe in Afghanistans fast 40 Millionen Menschen zählender Bevölkerung. Viele afghanische Hazara, Usbeken, Tadschiken und Turkmenen interpretieren die Taliban-Unterdrückung als Politik gegen ihre jeweilige ethnische Gruppe. Sollten sich solche Revolten ausbreiten, könnten sie die Taliban-Herrschaft in halb Afghanistan zumindest destabilisieren.
Auch der lokale Ableger des »Islamischen Staats« (IS) ist weiter aktiv. Seine Terroranschläge fordern zwar weiterhin viele Opfer in der Zivilbevölkerung, zuletzt im Juni bei einem Anschlag auf den letzten verbliebenen Tempel der letzten im Land verbliebenen Angehörigen der religiösen Minderheit der Sikhs in Kabul. Aber die Gruppe gefährdet mangels einer nennenswerten sozialen Basis im Land das Machtmonopol der Taliban nicht.
Auch wenn die Unzufriedenheit mit der Unterdrückungspolitik der neuen Machthaber weit verbreitet ist, bleibt eine breitere Mobilisierung für die Widerstandsgruppen bisher aus. Viele in Afghanistan identifizieren die Anführer der Taliban-Gegner mit der systemischen Korruption der Vorgängerregierung und mit Kriegsverbrechen. Die talibankritische Internetzeitung Hasht-e Subh fragte, wie man sicher sein könne, dass diese »gescheiterten Politiker ihr Verhalten der Vergangenheit ablegen könnten«. Vor allem aber herrscht Kriegsmüdigkeit, so dass sich viele mit der Taliban-Herrschaft arrangieren.
Die Strukturen der seit 2001 entstandenen modernen Zivilgesellschaft, aus deren Reihen eine Opposition erwachsen könnte, sind im August 2021 weitgehend zusammengebrochen. In Afghanistan fehlt es ihr an geschützten Räumen und Mitteln und an Rechtsschutz sowieso.




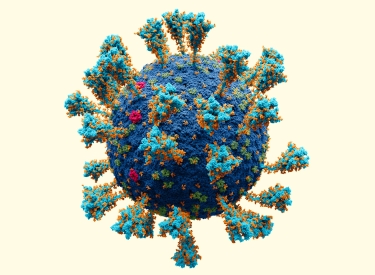
 Noch lange nicht zu Ende
Noch lange nicht zu Ende