Naher Osten: Es geht erst einmal um politische Emanzipation
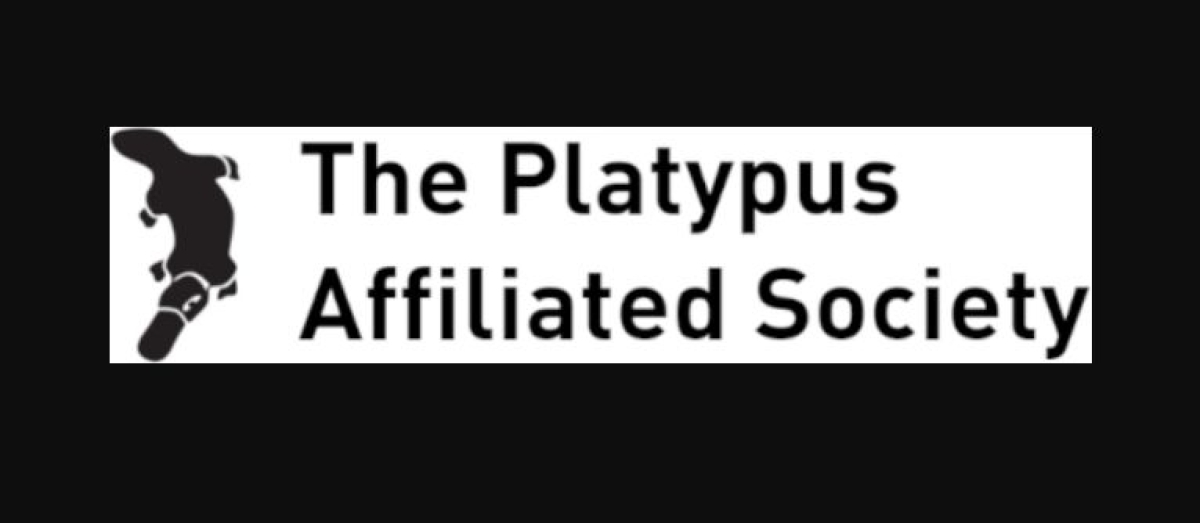
Im Anschluss an eine recht hitzige Diskussion über die Linke und den Ukrainekrieg, zu der mich die Platypus Affiliated Society im Winter 2022 eingeladen hatte, interviewte mich Sebastian Vogel im Anschluss. Daraus wurde ein fast vierstündiges Gespräch, das sehr viele Themen anriss und aus dem Platypus nun fast eineinhalb Jahre später eine verschriftliche Fassung publiziert hat. Im Anschluss spiegele ich die Teile die im weitesten Sinne Themen anreißen, die mit dem Nahen Osten zu tun haben.
Sebastian Vogel: Die Linke – auch zum Beispiel Foucault – setzte riesige Hoffnungen in die Iranische Revolution. In gewisser Art und Weise war das ja auch eine Vorstellung von bürgerlicher Revolution.
Thomas v. der Osten-Sacken: Nein, das war es nicht. Foucault hat das Spannungsverhältnis nicht ausgehalten, dass antibürgerlich nicht heißt, alles Bürgerliche abzulehnen. Das Bürgertum tritt mit einem Versprechen auf, das es nicht einlösen kann, weil es Freiheit immer nur als Freiheit des Eigentümers realisiert – was aber wesentlich besser ist als andere Systeme, in denen es selbst diese Freiheit nicht gibt. Die bürgerliche Haltung kippt in eine radikal antibürgerliche um: weil in der Zirkulationssphäre ein Versprechen aufscheint, das in der Produktionssphäre nicht eingehalten wird, soll die Zirkulationssphäre weg.
Baathisten sind nicht reaktionär, sondern hochmodern und haben, wie die Nazis, eine hochmoderne antimoderne Ideologie.
Diese Reflektionen werden in der Dialektik der Aufklärung auch getätigt. Der Impuls, dieses bigotte und verlogene System mit allem Drum und Dran einfach wegzuräumen, ist mir durchaus sympathisch, aber das endet, wie bei Rabehl, Mahler und Jürgen Elsässer – oder auch Henri de Man oder Bodo Strauß – im Deutsch-Nationalen und Spiritistisch-Völkischen beziehungsweise in der Anlehnung an Diktatoren und Autokraten wie Putin.
Wie siehst du die Aufgabe der Linken in solchen Ländern wie dem Irak?
Sie muss das nicht-existente Bürgertum substituieren. Eine starke Linke gab es in diesen Ländern nie, sondern nur eine starke leninistische, an der Sowjetunion orientierte Bewegung. So konnten im Nahen Osten Islamisten und Faschisten wie die Baath-Partei, die panarabische Bewegung und die Muslimbrüder die neu aufstrebende Klasse für sich organisieren. Deren Antiimperialismus verleitete die West-Linke zu dem Missverständnis, dass sie als Feinde ihrer Feinde ihre Freunde seien.
Der panarabische Nationalismus war bis zu den 70ern in einer Krise und der Islamismus stieß in die so entstandene Lücke hinein. Zeigen diese reaktionären Kräfte also auch verpasste Möglichkeiten auf, da sie auf Krisen reagierten, die auch emanzipatorische Kräfte hätten nutzen können?
Die sind nicht reaktionär, sondern hochmodern und haben, wie die Nazis, eine hochmoderne antimoderne Ideologie. Natürlich war es nie so attraktiv, in den Wald bei Heidelberg zu gehen, wie in Paris am Hof zu sitzen und eine Mätresse zu haben, also entwickelten sich völkische Ideologien darüber, wie wichtig und schön es sei, im Wald herumzulaufen, sich große Gedanken zu machen, Bier zu trinken und an den Traditionen festzuhalten. Mit der Globalisierung des Kapitalismus merkten Menschen überall auf der Welt, dass es zwar nur dieses eine Freiheitsversprechen gibt, aber sie nie daran teilhaben können. Davon profitieren die antimodernen Bewegungen.

(Wand in Tunis im Januar 2011, Bild: Thomas v. der Osten-Sacken)
Die West-Linke musste feststellen, dass sie global keine Rolle mehr spielt. Die einen haben sich mit dem realitätsfremden neuen Establishment verbunden und sich Gendersprache und genderneutrale Toiletten zur Aufgabe gemacht. Die anderen heften sich dagegen an diese vermeintlichen Gegner des Systems. Währenddessen verschiebt der globalisierte Kapitalismus die Produktion in die Peripherie und sorgt dort für immer unerträglichere Lebens- und Arbeitsbedingungen. Die Metropolen werden von der ursprünglichen sozialen Frage entfremdet – in ihnen wird der Kampf um Teilhabe zunehmend ein identitärer.
Weil wir gerade über die Aufgabe von Marxisten in der sogenannten Dritten Welt und über die bürgerliche Revolution geredet haben: Was wäre die Aufgabe von Marxisten in Großbritannien, Frankreich und den USA, in denen es erfolgreiche bürgerliche Revolutionen gab?
Die systeminhärenten Widersprüche aushalten. Das ist das Unattraktivste, was es gibt; das ist Dialektik heute. Man muss gegen die dem System inhärenten autoritären Tendenzen liberale Freiheiten hochhalten, obwohl sie ein Selbstwiderspruch sind. Das System, das global grässliche Autoritarismen hervorbringt, ist nämlich auch das einzige, das die schlimmsten Auswüchse davon beseitigen kann.
Menschen in Syrien, im Irak, in Russland, in China, jetzt in Hongkong gehen auf die Straßen und sagen „Wir wollen Demokratie, wir wollen Freiheit“. Das ist mir hochgradig sympathisch, auch wenn die Emanzipation in der politischen Sphäre allein nicht vollständig sein kann.
Unser Problem heute ist, dass die Veränderungen in Militär und Produktion den Menschen überflüssig machen. 20 Jahre nach dem Einmarsch in Afghanistan wird das Land den Taliban unter der einzigen Prämisse überlassen, dass sie nicht zu viele Flüchtlinge produzieren sollen. Man hält Leute in solchen abgehängten Regionen noch nicht einmal mehr als Konsumenten über Wasser, sondern verhindert nur fürs Erste, dass sie verhungern. Wir werden während des Krieges und der globalen Weizenknappheit sehen, ob dieser Konsens auch aufgekündigt wird. Zudem werden irgendwelche Eliten oder Rackets bezahlt, die schon im Vorfeld Menschen verunmöglichen zu fliehen. Weil sich die Vorstellung von der Gleichheit der Menschen so nicht halten lässt, sind wir wahrscheinlich irgendwann gezwungen, alte religiöse Vorstellungen gegen neue Ideologien, die zunehmend die Ungleichheit betonen, hochzuhalten. (...)
Wie verstehst du den Begriff der Diktatur des Proletariats in Marx‘ Werk und hat das heute noch Relevanz?
Das hatte schon in den 1920er-Jahren keine Relevanz mehr. Marx übernimmt den Diktatur-Begriff aus der Antike: Die Athener waren sich darüber bewusst, dass in einem Krieg nicht auf der Agora mit jedem attischen Bürger darüber diskutiert werden kann, was zu tun sei, also entschieden sie sich, für die Periode von in der Regel einem Jahr einen Diktator zu wählen, der während des Ausnahmezustands die Polis regiert, also wichtige demokratische Entscheidungsprozesse außer Kraft setzt. In diesem Sinne bedeutete für Marx die Diktatur des Proletariats eine Übergangsperiode, in der die Klasse, die kein Privateigentum hat, die Transformation der Gesellschaft in eine nicht auf Privateigentum fußende Gesellschaft gegen die Inhaber durchsetzt und dafür temporär gewisse Regelungen außer Kraft setzt. Vorausgesetzt ist aber die demokratische Entscheidung dazu und die Begrenztheit der Dauer. Heute wird der Diktatur-Begriff dagegen für alles Mögliche andere benutzt. (...)
Du hast auf dem Podium „The Crisis of the Ukraine and the Left“3 Karl August Wittfogel genannt. Was ist das Besondere an seiner Schrift über den asiatischen Despotismus?4 Was ist der Unterschied zu klassisch-marxistischen Begriffen wie Bonapartismus, autoritärer Staat und Imperialismus?
Wittfogel ist ein Marxist und der Begriff der asiatischen Produktionsweise taucht bei Marx schon auf. Er behandelt das Problem, vor dem auch Lenin stand: Die Revolution im rückständigen Russland sollte der Zündfunke für eine Revolution in Deutschland sein. Weil das nicht funktionierte und der Kommunismus sich nicht durchsetzen konnte, tendierte die Sowjetunion dazu, ein Imperium zu werden und bemächtigte sich der Arbeitskraft barbarisch vermittels des Gulag-Systems und im Zuge eines Modernisierungsprogramms, mit dem Arbeiter mehr als selbst zu den Hochzeiten des Manchester-Kapitalismus ausgebeutet wurden. Das erinnert an die starken asiatischen Staaten. In Ländern wie China, Mesopotamien und Ägypten, deren Organisationsform nicht auf freier, durch Regen bewässerter Landwirtschaft gründete, muss die Wasserverteilung zentral organisiert sein und ist das Eigentum unsicher. Wittfogel zufolge kann sich dieses System nicht aus sich heraus verwandeln und bürgerliche Gesellschaft entwickeln, sondern höchstens die Spitze austauschen.

Im 20. Jahrhundert lösten Rohstoffe das Wasser in seiner Bedeutung ab. Putin reagierte uf den entfesselten Kapitalismus, indem er Russland in eine Tankstelle verwandelt und dafür gesorgt hat, dass das ehemalige Privateigentum an Produktionsmitteln in die Hände einer Clique kommt, die mehr oder weniger ununterscheidbar vom Staat ist. Sogleich schaffte er sämtliche mit dieser Entfesselung in den 90er Jahren entstandenen Freiheiten ab. Dieselbe Entwicklung sahen wir im Irak unter Saddam Hussein, größtenteils im Iran unter Khomeini und in China.
Das Problem mit der Weltpolizei USA ist eher, dass sie sich zu früh zurückziehen und insofern Ausbeutungsverhältnisse verschulden.
Menschen in Syrien, im Irak, in Russland, in China, jetzt in Hongkong gehen auf die Straßen und sagen „Wir wollen Demokratie, wir wollen Freiheit“. Das ist mir hochgradig sympathisch, auch wenn die Emanzipation in der politischen Sphäre allein nicht vollständig sein kann. 2011 hat in Ägypten das Militär die Staatsspitze ausgetauscht, aber an den ganzen Strukturen nichts geändert. Das haben die Leute, die in Ägypten für eine Revolution auf die Straße gingen, verstanden, aber dann muss ja noch irgendwie die bürgerliche Gesellschaft kommen – und sie entsteht einfach nicht von innen heraus.
Lenin war sich auch bewusst, dass die Russische Revolution zwar von der sozialistischen Partei angeführt wurde, aber einen bürgerlichen Charakter hatte.
Lenin wusste das und Wittfogel ist kein Anti-Leninist! Lenin wollte die Amerikanisierung Russlands und mochte den großrussischen Chauvinismus nicht. Dann fiel ihm die Nationalitätenfrage vor die Füße, auf die die Linke nie eine Antwort hatte. Es gibt sogar, wie Wittfogel schreibt, Schriften von Lenin, in denen er auf den Begriff der orientalischen Produktionsweise Bezug nimmt und deren Veröffentlichung er später selbst verbietet.
Hier ist die Auseinandersetzung zwischen Rosa Luxemburg und Lenin sehr bedeutsam: Rosa Luxemburg hat das Problem erkannt, dass einerseits die nicht-russischen Teile des russischen Imperiums unterdrückt wurden und ein Recht haben, sich davon zu lösen. Aber auf der anderen Seite das pauschale Erklären irgendwelcher Nationalitäten zum revolutionären Subjekt nach hinten losgehen muss, weil die eigentliche Idee nicht die Schaffung nationaler Identitäten ist, sondern ihre Auflösung in einer Assoziation freier Produzenten. Darin liegt, Wittfogel zufolge, der Selbstwiderspruch, der später zum Stalinismus führte: Die KPdSU wurde zum revolutionären Subjekt erklärt, aber eignete sich den Staat an, statt ihn aufzulösen. Dann war, wie im Zarenreich, der Staat wieder der Akteur der vermeintlichen Modernisierung. Ebenso haben in den 90ern diese mit dem Staat verschmolzenen, alten KP-Heinis in Russland die großen Firmen unter ihre Kontrolle gebracht und den nationalen Reichtum völlig unproduktiv in Yachten, in Villen in London usw. angelegt. Das ist der Kern der Analyse orientalischer Despotie.
Du meintest auf dem Podium “The Crisis in Ukraine and the Left”,6 dass der Begriff Imperialismus mal eine gewisse Schärfe hatte, die er heutzutage verloren hat. Welche Schärfe hatte er und warum hat er diese heutzutage verloren?
Im 18. und 19. Jahrhundert haben die kapitalistischen Metropolen die Ressourcen der Welt unter sich aufgeteilt und lokale Produktionsformen zerstört. So entstand der Imperialismus-Begriff sowohl positiv („Britisches Weltreich“, „White Man’s Burden“) als auch negativ, was Lenin prägte („Imperialismus als höchste Stufe des Monopolkapitalismus“).
Einerseits stehen wir nach den zwei Weltkriegen, in denen Deutschland das britische Weltreich ausblutete und sein eigenes Kolonialreich verloren hat, vor einer ganz anderen Situation. Andererseits wird der Begriff des Imperialismus nie auf seinen etymologischen Kern zurückgeführt: „Imperium“. Man dachte im 19. Jahrhundert immer an die maritimen Imperien wie Frankreich und Großbritannien und nicht an die Landimperien wie vor allem Russland. Wenn es heute ein Imperium gibt, dann ist es Russland. Russland ist der letzte Nicht-Nationalstaat und auch das war Lenin immer bewusst. Deshalb gab es eine Sowjetunion und deshalb hat er den Imperialismus-Begriff so stark gemacht, damit niemand nachfragte, wie Russland im 19. Jahrhundert entstanden war. Das ist das einzige Imperium, das nie zerfallen ist.
Mein Problem ist aber nicht die Definition von Imperialismus, sondern wer als Antiimperialist auftritt.
Der politische Begriff von Imperialismus heute wird den USA unterstellt, die nicht nur der Nationalstaat schlechthin sind, sondern mit Ausnahme von Puerto-Rico und teilweise den Philippinen nie ein Interesse daran hatten, unmittelbar Herrschaft auszuüben, sondern immer indirekte Herrschaft ausgeübt haben. Damit waren sie nach 1945 der dritte antiimperialistische Akteur neben Deutschland und Japan. Auch die Kriege der USA in den letzten 20 Jahren sind sicher keine imperialistischen Kriege. Sie wollten im Irak, Haiti und Afghanistan miese Regimes stürzen und für Freiheit, Demokratie und Freihandel sorgen. Dass das nicht funktioniert hat, lässt sich wieder mit Wittfogel erklären. Den USA ist auch nicht der Vorwurf zu machen, dass sie Saddam stürzen wollten, um das Öl abzugreifen: Es gab faire Lizenzvergaben des irakischen Öls und einen Großteil haben chinesische Firmen ersteigert. US-Imperialismus ist Freihandel, der versucht, den Zugang zu Rohstoffen und Verkehrswegen offen zu halten. Das ist auch, was vorher die Briten gemacht haben. Das Problem mit der Weltpolizei USA ist eher, dass sie sich zu früh zurückziehen und insofern Ausbeutungsverhältnisse verschulden.
Mein Problem ist aber nicht die Definition von Imperialismus, sondern wer als Antiimperialist auftritt. Der Iran, die Türkei und der Islamische Staat haben sich als antiimperialistische Akteure gegen die USA aufgespielt, aber wollten selbst Imperien schaffen: der Iran das persische Imperium, Erdoğan das Osmanische Reich und der Islamische Staat das alte arabische Großreich. Antiimperialismus ist seit Ewigkeiten eine widerliche Ideologie, bei der sich Maoisten, iranische Revolutionäre, die panarabische Bewegung und Islamisten treffen.
Du hast auf dem Podium7 Christopher Hitchens als wichtige Figur erwähnt. Wie steht der Marxismus zum Krieg?
Für Marx selbst war der Krieg ein Geburtshelfer. Bis in die 50er Jahre hatten Linke diesen Friedensfetisch nicht. Das mag man positiv oder negativ sehen. Zum ersten Mal kam diese Phraseologie 1939 in Zusammenhang mit dem Molotow-Ribbentrop-Pakt auf, bei dem die stärkste kommunistische Partei Westeuropas, die Kommunistische Partei Frankreichs, sagte, dass das ein innerimperialistischer Krieg sei, der uns nichts angehe. Durch die Tatsache, dass 1941 die Sowjetunion in den Krieg gezogen wurde, konnte man die Zeit zwischen 1939 und 1941 immer wunderbar ausklammern.

(Bild: Titelseite der Zeitung der KPF im Sommer 1939, Bildquelle: Wikimedia Commons)
Kommunisten machen nachträglich den Sozialdemokraten zum Vorwurf, dass sie 1914 den Krieg unterstützten, aber der Hauptgrund dafür war, dass sie Moskau als Hort der Reaktion sahen und ein Krieg auch zur Befreiung des Proletariats in Russland beigetragen hätte. Dass man als Marxist uneingeschränkt für Frieden sein müsse, ist ein U-Boot des Stalinismus aus den 50ern. Heute ist diese Argumentation aus Ostermarsch-Bewegung, DDR und Kaltem Krieg selbstverständlich und reichert sich mit der Vorstellung an, dass noch ein Krieg die globale Apokalypse bedeuten würde. Die traditionellen Linken und Marxisten hatten nie ein großes Problem mit bewaffneten Auseinandersetzungen, sondern betrachteten z.B. die napoleonischen Kriege als Modernisierungsschübe und Napoleon als den Weltgeist zu Pferde.
Kant unterscheidet den bewaffneten und den ewigen Frieden. Der Begriff des ewigen Friedens hat für Marxisten wie Rosa Luxemburg hohe Relevanz.
Ja, aber als Assoziation freier Produzenten. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Frieden und Friedhofsruhe. Wie Wolfgang Pohrt sagte, ist Frieden an sich kein Wert. Für Freiheit und Gerechtigkeit lohnt es sich zu kämpfen, aber nicht für einen Frieden, der ungerechte Verhältnisse stabilisiert. Man denke an den Begriff „Arbeitsfrieden“ oder die Losung „Nie wieder Krieg, denn wir haben Dresden erlebt“. Im Sinne der Kritischen Theorie muss man sagen: Die Deutschen haben der Welt gezeigt, dass es Schlimmeres als Krieg gibt, und aus deutscher Sicht zu behaupten, Krieg sei das Allerschlimmste, ist ein revisionistisches Verbrechen. Wären die Alliierten 1937 in Deutschland einmarschiert, wäre der Menschheit eine Katastrophe und der Holocaust erspart geblieben. Also sagt der Buchenwaldschwur in seiner Reihung auch, dass gegen Faschismus ein Krieg immer eine legitime Form ist.
Linke wie Paul Berman und Christopher Hitchens haben Krieg gegen einen faschistischen Diktator wie Saddam Hussein, von dem sich die Leute nicht selbst befreien können, als gerechtfertigtes Mittel angesehen. Das ist marxistische Tradition. George Orwell hat 1941 geschrieben, dass es in den meisten Kriegen eine Seite gibt, die mehr für den Fortschritt, und eine Seite, die mehr für die Reaktion steht. Ich bin kein großer Freund des ukrainischen Staates, aber er steht momentan für etwas Unterstützenswertes und die Aussage, wir bräuchten vor allen Dingen Frieden, ist im Moment objektiv eine Parteinahme für Putin.
Wie hat sich dein Denken in den letzten 20 Jahren verändert? Würdest du sagen, dass man aus 9/11, Afghanistan, Irak usw. Lehren ziehen kann?
Das Denken verändert sich ständig, weil die Gegebenheiten sich verändern, und wenn nicht, wird es starr und dogmatisch. Die Schwierigkeit ist, dass man nicht opportunistisch werden möchte, aber versuchen muss, neue Entwicklungen zu verstehen. Ich komme immer wieder bei dem Widerspruch an, dass augenblicklich nichts so notwendig wäre wie eine starke globale Linke und nichts gleichzeitig so wenig in Sicht ist. Es bräuchte einen Neuanfang, der an dem Adorno-Diktum festhält, dass die Herausforderung ist, weder an der Macht der anderen noch an der eigenen Ohnmacht irre zu werden.
Durch die ganzen Brüche – Flüchtlingskrise, 9/11 oder Intifada und Irakkrieg – habe ich ganz viele Weggefährten verloren. Das Ideal des kollektiven Handelns scheitert daran, dass man sich letztlich auf einen Hauptwiderspruch als kleinsten gemeinsamen Nenner einigen muss und die Nebenwidersprüche ausklammert. Linkssein heißt heute, in einer absoluten Minderheitenposition zu sein. Die Idee, dass es irgendwo ein revolutionäres Subjekt gibt, für das man nur die Führung übernehmen muss, hat sich als vollkommen verheerend erwiesen.
Die große ungelöste Frage ist, wie Kritik und Praxis vermittelt werden können. Linke sind immer wieder daran gescheitert und haben entweder nur noch Kritik gemacht oder sich in der Praxis verloren. Man muss sich diesem Widerspruch in der Radikalität der Kritischen Theorie stellen, ohne der Resignation von Kritischer Theorie zu verfallen. Es ist eine Frage aufs Ganze, ob Menschen etwas zu essen haben, einen guten Rechtsanwalt, wenn sie im Knast sitzen, die Freiheit zu sagen, was sie denken, ohne verhaftet zu werden, oder ein Dach über dem Kopf. Aber eine darauf zielende Praxis wird nie zu einer großen revolutionären Befreiung führen. Das ist das Spannungsverhältnis in dem alten Pro Asyl-Spruch „Der Einzelfall zählt“: Man darf sich nicht im Einzelfall verlieren und muss eingestehen, dass die Summe der Einzelfälle vermutlich das große Ganze nicht verändert.